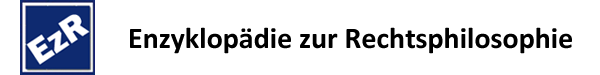Straftheorien
Erstpublikation: 08.04.2011
- Einleitung
- Was ist der Zweck der strafgesetzlichen Normen?
- Sind Strafnormen gegenüber Betroffenen legitim?
- Welcher Sinn kommt strafgerichtlichen Verurteilungen zu?
- „Absolute“ Theorien
- Prävention von zukünftigen Straftaten
- Spezialprävention
- Generalprävention
aa) Negative Generalprävention
bb) Positive Generalprävention
cc) Fazit
- Expressive Straftheorien
- Ist die Verhängung von Kriminalstrafe gegenüber den Bestraften legitim?
- Zusammenfassung von Thesen
- Bibliographie
- Verwandte Themen
I. Einleitung
1. Die Fragestellung
1
Der Frage: „Warum Kriminalstrafe?“ kann man sich in einer deskriptiven Weise nähern. Wer so vorgeht, beschreibt die Praxis staatlichen Strafens aus einer rechts- oder kultursoziologischen Perspektive oder beschäftigt sich mit (sozial-)psychologischen Erklärungen, die die emotionalen, teilweise unbewussten Antriebe entschlüsseln, die hinter gesellschaftlichen und individuellen Strafbedürfnissen stehen. Bedürfnisse, die tiefenpsychologisch und psychoanalytisch zu erklären seien, können Quellen strafrechtlicher Praktiken sein (Haffke 1976; Streng 1980; Morselli 2001). Aus einer religionssoziologischen Sicht können Strafbedürfnisse als Indiz für die tiefe Verankerung religiöser Vorstellungen gewertet werden, die durch Verachtung „sündiger Menschen“ als „Feinde Gottes“ gekennzeichnet sind (Lüderssen 2010, S. 479).
2
Deskriptive Ansätze fördern eine distanzierte bis skeptische Einstellung gegenüber der Institution Kriminalstrafe (s. z.B. Kunz 2004). Wer sich der historischen Faktoren und sozialpsychologischen Mechanismen bewusst ist, die hinter Wertungen stehen, ist meist weniger geneigt, diese als unhinterfragbare Selbstverständlichkeit zu behandeln. Die entscheidende Frage ist dann, ob Strafe nur Ausdruck von (möglicherweise atavistischen) Emotionen und/oder nur Produkt kontingenter historischer Prozesse und dadurch geprägter Geisteshaltungen ist. Wäre dem so, müsste diese Erkenntnis entweder zu abolitionistischen Forderungen oder zum resignierten Sich-Abfinden mit dem Hässlichen, aber Unvermeidbaren führen. Oder gibt es Rechtfertigungen, die soweit zu überzeugen vermögen, dass man sie nicht als scheinrationale Verhüllungen des Gewachsenen und Irrationalen zu den Akten legen kann? Diese normative Perspektive soll im Folgenden zugrunde gelegt werden. Das Ergebnis kann an dieser Stelle schon angedeutet werden: Eine Straftheorie, die einen einfachen Ansatz „aus einem Guss“ präsentiert, ist nicht in überzeugender Weise zu begründen. Wenn man jedoch bereit ist, sich auf komplexere Überlegungen einzulassen, ist es möglich, Argumente zu entwickeln, die insgesamt die Notwendigkeit und Legitimität von staatlicher Strafe hinreichend begründen (anders Lüderssen 1995, S. 387 ff.).
3
Die folgende Abhandlung beschränkt sich auf die Institution der Kriminalstrafe, während die Berechtigung eines „zweispurigen Systems“, das auch Maßregeln der Besserung und Sicherung vorsieht, ausgeblendet bleibt. Der Schwerpunkt liegt bei einer normativen Betrachtungsweise und nicht bei rechtstatsächlichen Fragen, die Untersuchungsgegenstand der Kriminologie sind. Zwar ist auch bei der Beschäftigung mit Straftheorien die Frage nach den Wirkungen von Sanktionen unvermeidbar, worauf aber jeweils nur kursorisch eingegangen werden kann.
2. Die Struktur der Untersuchung
4
Einer verbreiteten Herangehensweise entspricht es, zwei Oberbegriffe zu nutzen, nämlich „absolute“ und „relative“ Straftheorien. Überblicksaufsätze und Lehrbuchdarstellungen arbeiten oft mit diesem dualistischen Schema (Frister 2009, S. 16 ff.; Momsen/Rackow 2004, S. 337; Rengier 2009, S. 12 ff.). Abweichend davon soll hier ein anderer Zugang gewählt werden (s. auch Weigend 2007, Rn. 61; Hassemer/Neumann 2010, Vor § 1 Rn. 105). Die gängige Zweiteilung in „relative“ und „absolute“ Straftheorien vermag schon deshalb nicht zu überzeugen, weil nicht geklärt ist, was das „Absolute“ einer Theorie ausmacht. Die deutsche Diskussion krankt daran, dass sie zu undifferenziert alle nicht-präventionsorientierten Begründungen als „absolut“ tituliert, obwohl es auch jenseits des Anliegens der Deliktsprävention rationale, an Allgemein- und Individualinteressen ausgerichtete Begründungen für Kriminalstrafe gibt. Diese passen besser unter die Überschrift „expressive Straftheorien“ (s. Rn. 29 ff.) als unter das Etikett „absolut“.
5
Außerdem ist die allgemein formulierte Frage nach dem Zweck der Strafe ungeeignet, einer Untersuchung sinnvolle Form zu geben. Vielmehr ist es erforderlich, sie in Einzelfragen aufzufächern, um zu verhindern, dass Ausführungen zum „Sinn der Strafe“ gemacht werden, die bei genauerer Betrachtung nur Teilaspekte betreffen. Insbesondere ist zu differenzieren zwischen den Fragen: „Soll der Staat Strafen erstens androhen und zweitens verhängen? Gibt es (auch in Anbetracht der finanziellen Lasten für die Allgemeinheit) überzeugende Gründe, die Praxis staatlichen Strafens aufrechtzuerhalten?“ und „Darf es (in Anbetracht dessen, was den dadurch belasteten Personen zugemutet wird) strafrechtliche Verbote und strafgerichtliche Verurteilungen geben?“. Auf beide Dimensionen ist einzugehen, was in straftheoretischen Abhandlungen nicht immer geschieht, und die unterschiedlichen Fragen bedingen unterschiedliche Antworten. Wer dagegen nach einer uniformen Formel für die Straftheorie sucht (für „axiologische Geschlossenheit“ Pawlik 2004a, S. 53), geht explizit oder implizit davon aus, dass Überlegungen zur Begrenzung staatlicher Eingriffe den Überlegungen zur Begründung dieser Maßnahmen entsprechen müssten (so etwa Kaufmann 1967, S. 555 f.). Diese Annahme ist jedoch falsch (Greco 2009, S. 248 f.). Vielmehr setzt eine umfassende Begründung staatlicher Zwangseingriffe voraus, dass diese Begründung offensichtlich konträren Interessenlagen gerecht wird. Es kann nicht genügen, nur auf die Interessen aller oder einiger vom Eingriff Profitierender zu verweisen, sondern es muss auch gegenüber denjenigen, die gegen ihren Willen Eingriffsadressat werden, begründet werden, warum sie ausgewählt, warum sie für die Verfolgung der Interessen anderer zuständig sein sollen (Schünemann 1998, S. 114; Frisch 1998, S. 142; Neumann 1998, S. 150; Weigend 2007, Einl. Rn. 66). Umgekehrt gilt, dass Argumente zur Zuständigkeit der Eingriffsadressaten nur eine notwendige, aber keine hinreichende Begründung sind (Schünemann 2002, S. 330). Sie können nicht begründen, warum die Allgemeinheit die Kosten zur Unterhaltung eines Strafjustizsystems auf sich nehmen sollte. Es wäre deshalb nicht überzeugend, präventive Effekte nur als Sekundär- und Begleitphänomene einzuordnen (so aber Frisch 1998, S. 140 f., 144 f.). Zu unterscheiden ist ferner zwischen dem Eingriff, der bereits im Strafgesetz steckt und dem Eingriff, der in der Verhängung einer Strafe liegt (Greco 2009, S. 228 f.).
6
Die Frage nach dem „Sinn der Strafe“ ist in folgende Teilfragen zu präzisieren:
- Was ist der Zweck der strafgesetzlichen Normen? (Rn. 8 ff.)
- Sind Strafnormen gegenüber Betroffenen legitim? (Rn. 11 ff.)
- Welcher Sinn kommt strafgerichtlichen Verurteilungen zu? (Rn. 13 ff.)
- Ist die Verhängung von Kriminalstrafe gegenüber den Bestraften legitim? (Rn. 41 f f.)
7
Erschöpfend ist das Thema „staatliche Strafe“ damit nicht abgehandelt. Es bleibt die fünfte Frage, wie Strafe ausfallen soll. Hier wären die Grundsätze zu begründen, die für die Art der Sanktionen, die Strafzumessung und die Gestaltung des Vollzugs leitend sein sollen. Im Hinblick auf den beschränkten Raum konzentriert sich meine Abhandlung auf die in der vorstehenden Rn. aufgezählten vier Punkte, die die Straftheorie im engeren Sinn betreffen. Strafzumessung und Vollstreckung sind davon getrennt zu erörtern. Zwar ist es eine häufig mindestens implizit gemachte Annahme, dass die Wahl der straftheoretischen Argumente die Leitlinien für die Strafzumessungstheorie präjudiziere. Diese Annahme liegt etwa der These zugrunde, dass negative Generalprävention nicht in die Straftheorie integriert werden könne, weil sich hieraus für die Strafzumessung Folgeprobleme ergeben würden (Jakobs 1991, 1. Abschn. Rn. 29 ff.; Köhler 1997, S. 44; Pawlik 2004b, S. 218; Momsen/Rackow 2004, S. 337), oder dass die Theorie der positiven Generalprävention abzulehnen sei, weil sich hieraus keine Orientierung für Art und Höhe der Strafe ergebe (Frisch 1998, S. 134 ff.). Die These, dass Strafzumessungsregeln aus der Straftheorie im engeren Sinne abzuleiten seien, ist jedoch nicht überzeugend. Das einzelfallbezogene Unwerturteil kann und muss anderen Regeln folgen als die Begründung dafür, dass es gesetzliche Strafandrohungen und eine Praxis des staatlichen Strafens geben sollte (s. zu der Differenzierung zwischen der Rechtfertigung der Existenz einer Institution und der Rechtfertigung von Organisations- und Verteilungsregeln gegenüber denjenigen, die vom Betrieb der Institution persönlich betroffen sind, Hart 1968, S. 3 ff.; Hoerster 1970, S. 278; Ashworth 1998, S. 67 f.; von Hirsch 2005, S. 45).
II. Was ist der Zweck der strafgesetzlichen Normen?
8
Es lässt sich schwerlich bestreiten, dass Strafgesetze einem Zweck dienen: Es handelt sich um einen Akt der Kommunikation. Zu erörtern ist allein, wer der Adressat und was der Inhalt der Mitteilung ist. Zwei Erklärungen sind vorstellbar. Einem minimalistischen Ansatz zufolge enthalten Strafgesetze nur eine Ermächtigung und Anweisung für die Strafverfolgungsbehörden, die alternative Erklärung sieht in ihnen (auch) eine Botschaft an diejenigen, die der Strafgewalt des Staates unterworfen sind. Die erste Position wird teilweise Hobbes zugeschrieben (so Byrd/Hruschka 2007, S. 961), was aber zweifelhaft ist, weil Hobbes zwar als Adressaten der Strafgesetze nur die „öffentlichen Diener“ nennt (Hobbes, S. 239), zuvor aber explizit alle bürgerlichen Gesetze als Befehle an die Bürger und als verhaltensregulierende Regeln bezeichnet (Hobbes, S. 228). Ein minimalistischer Ansatz ist in einem zeitgenössischen Rechts- und Verfassungsstaat unpassend. Insbesondere wäre das Rückwirkungsverbot (Art. 103 Abs. 2 GG) nicht verständlich, wenn Strafgesetze lediglich als Ermächtigungen im Verhältnis von Exekutive und Legislative zu verstehen wären. Die Informationen, die in Strafgesetzen stecken, richten sich vielmehr auch an die davon (potentiell) betroffenen natürlichen Personen, die den Regulierungsansprüchen unterliegen.
9
Umstritten ist, ob Strafnormen auf Imperativen basieren (dazu Binding 1916, S. 42 ff.; Kelsen 1934, S. 22 ff.; Hoyer 1996, S. 43 ff.; s. zu der normtheoretischen Auseinandersetzung Renzikowski 2001). Dagegen könnte vorgebracht werden, dass in einem freiheitlichen Staat Konzepte wie „Befehle“ und „Pflicht zur Gehorsam gegenüber dem Staat“ (s. zu solchen Vorstellungen Binding 1916, S. 42 ff.) problematisch sind. Hieraus folgt allerdings nicht, dass Strafnormen keine kommunikative Funktion zukommt, da sie als Appell oder als Aufforderung verstanden werden können, sich im Interesse der Mitbürger normkonform zu verhalten. Strafgesetze sollen formal und öffentlich zentrale Werte der Gemeinschaft ausdrücken und den Bürgern gute Gründe dafür geben, sich in bestimmter Weise zu verhalten (Duff 1998, S. 184 ff.; krit. zu solchen Vorstellungen Greco 2009, S. 398 ff.). Unabhängig davon, ob man von der Existenz primärer Verhaltensnormen ausgeht, ist anzunehmen, dass jedenfalls die Sanktionsnormen verhaltenslenkend wirken sollen. Hierfür ist der Begriff Androhungsgeneralprävention gebräuchlich; dahinter steht die Vorstellung, dass Strafankündigungen abschreckend wirken. Das Konzept der Androhungsgeneralprävention ist in der Geschichte der Straftheorie fest verankert. Es findet sich etwa als selbstverständlich vorausgesetzte Prämisse bei Kant, der im Abschnitt zum Notrecht in der „Metaphysik der Sitten“ ausführt, dass ein Strafgesetz „beabsichtigte Wirkung“ (Kant, S. 343) habe, was nur als Verweis auf die abschreckende Wirkung (bei Kant: der Todesstrafe) verstanden werden kann. Ausführliche Überlegungen dazu, dass es zur Verhinderung von Rechtsverletzungen eines psychologischen Zwanges bedarf, stellen im 19. Jahrhundert z.B. P. J. A. Feuerbach und Schopenhauer an (Feuerbach, §§ 12 ff.; Schopenhauer Bd. I, S. 433 f., dort S. 435 auch Verweise auf ältere Quellen; zu Schopenhauers Straftheorie Hoerster 1972 und Küpper 1990).
10
Wie bei jedem folgenorientierten Konzept ist zu klären, ob es auf zutreffenden Annahmen über menschliches Verhalten beruht und ob erwartete Effekte tatsächlich eintreten. Es ist nicht einfach, die Wirkung der Strafgesetze von den präventiven Wirkungen zu isolieren, die auf strafgerichtliche Verurteilungen zurückzuführen sind. Eine Messung wäre nur möglich, solange es bei einem (neugeschaffenen) Gesetz noch keine Verurteilungen gibt. Bei etablierten Gesetzen sind Überlagerungen in Rechnung zu stellen. Der Frage nach dem Nachweis kann hier nicht umfassend nachgegangen werden. Es muss genügen, darauf zu verweisen, dass es eine plausible Annahme ist, in beschränktem Umfang verhaltensbeeinflussende Wirkung schon von den Strafgesetzen zu erwarten (Hoerster 1970, S. 272 f.; Schmidhäuser 1971, S. 88 ff.; Koriath 2004, S. 69; Kuhlen 1998, S. 58; Weigend 1999, S. 933; Greco 2009, S. 364 ff.). Verhaltensdispositionen und Wertvorstellungen werden zwar durch andere Faktoren beeinflusst und abweichendes Verhalten durch nicht-rechtliche soziale Kontrolle reguliert (Stratenwerth 1995, S. 9; Hassemer 2000, S. 207). Trotzdem ist davon auszugehen, dass innerhalb des so vorgeprägten Rahmens Strafdrohungen den Ausschlag geben können. Aus der Tatsache, dass Strafgesetze oft missachtet werden, ist nicht abzuleiten, dass gesetzliche Strafandrohungen stets wirkungslos seien. Es bleiben Situationen, in denen die Persönlichkeitsstruktur des Erwägenden und die konkrete Situation Spielraum für eine abwägende Entscheidung lassen. Für eine vollständige Beschreibung der Zusammenhänge ist genau genommen die Bezeichnung „Androhungsgeneralprävention“ unzureichend, vorzugswürdig ist insoweit „Ankündigungsgeneralprävention“ (s. Rn. 12). Bei entsprechend disponierten Bürgern spielt nicht nur die Drohung und die Erwartung möglicher Strafverfolgung eine Rolle, sondern es kann bereits die Verkündung des Gesetzgebers, dass das beschriebene Verhalten illegal sei, genügen.
III. Sind Strafnormen gegenüber Betroffenen legitim?
11
Anders als bei der Verhängung von Kriminalstrafen, die gegenüber den verurteilten Gesetzesbrechern zu rechtfertigen sind, steht an dieser Stelle eine andere Gruppe im Vordergrund: die normtreuen Personen. Zwar wird durch die Verhaltensnorm nicht belastet, wer an dem beschriebenen Verhalten prinzipiell nicht interessiert ist. Aber diejenigen, die tatsächlich durch das Strafgesetz zu einer Verhaltensanpassung bewegt werden, werden durch die gesetzliche Norm belastet. Ihnen gegenüber gilt es, dies zu rechtfertigen. An dieser Stelle besteht eine durchlässige Stelle zwischen Kriminalisierungstheorie einerseits und Straftheorie andererseits. Nur wenn aufgezeigt werden kann, dass es (nach meiner Auffassung: mit Verweis auf die Rechte anderer, s. Hörnle 2005, S. 65 ff.) legitim ist, individuelle Handlungsfreiheit einzuschränken, sind Verhaltensnormen legitim.
12
Zu klären bleibt, wie es sich mit der Sanktionsnorm verhält. Dass diese sich an die Allgemeinheit wendet und niemanden persönlich aus der Masse heraushebt, genügt nicht für eine problemlos zu bejahende Legitimation (a.A. Leyendecker 2002, S. 82). Es könnte in Frage gestellt werden, ob ein nicht nur Appelle, sondern auch Strafandrohungen vorsehendes Gesetz auf einem angemessenen Verständnis des Verhältnisses von Staat und Bürger beruht. Das Wort „Drohung“ weckt Bedenken (Hassemer 2009, S. 108), und zwar Bedenken, die sich nicht nur auf die Gruppe der potentiell Tatgeneigten beziehen, sondern auf die Gesamtheit aller, die der Strafgewalt unterliegen. Trifft Hegels Einwand zu, dass Bürger wie Hunde, gegen die man den Stock erhebe, behandelt würden (Hegel, Zusatz zu § 99; Duff 1998, S. 184 f.)? Ist Androhungsgeneralprävention zwangsläufig „krude“ und „Einschüchterung“ (so Hassemer 2000, S. 208 f.; ders. 1998, S. 34)? Eine bejahende Antwort konzentriert sich ausschließlich auf das Wort „Drohung“. Die Legitimität von Sanktionsnormen ist jedoch nicht an die Bezeichnung „Androhungsgeneralprävention“ gekoppelt. Zu einem modernen Rechtsstaat, der nicht auf dem Gedanken eines Machtungleichgewichts zwischen „Obrigkeit“ und Untertanen beruht, passt besser die Bezeichnung „Ankündigung von Sanktionen“. Solche Ankündigungen fungieren als Anreize, die innerhalb komplexerer Entscheidungsmechanismen eine Rolle spielen. Anders als bei Tieren, bei denen Verhaltenssteuerung nur mittels eines feststehenden Reiz-Reaktionsmechanismus möglich ist, kann bei menschlichen Akteuren mehr unterstellt werden. Entscheidend ist erstens, dass Menschen (in der Regel) die Sinnhaftigkeit der zugrunde liegenden Verhaltensanforderung nachvollziehen können und zweitens, dass auch Klugheitsregeln als Gründe verstanden werden können (Greco 2009, S. 379 ff.; ähnlich Kuhlen 1998, S. 60 f.). In persönlichen Interaktionen zwischen zwei Individuen mag der Einschluss von Klugheitsregeln unter Umständen als unaufrichtige, unethische Manipulation erscheinen. Hieraus ist aber entgegen Duff (Duff 1998, S. 185) nicht abzuleiten, dass der Staat die in Normen gegossene Kommunikation mit allen Bürgern an den hohen moralischen Ansprüchen für einen mitmenschlichen Umgang ausrichten müsse. Pragmatischere Standards, die sowohl moralische Ansprechbarkeit als auch die Neigung zur Vermeidung von Nachteilen voraussetzen, sind insoweit nicht verwerflich.
IV. Welcher Sinn kommt strafgerichtlichen Verurteilungen zu?
1. „Absolute“ Theorien
a. Die verbreitete Fokussierung auf „Kant und Hegel“
13
Was ist gemeint, wenn auf eine „absolute“ Straftheorie verwiesen wird? Wer diesen Begriff verwendet, denkt darüber meist nicht intensiv nach. Es sind in der Regel diejenigen, die den Sinn strafgerichtlicher Verurteilungen in der Prävention zukünftiger Straftaten sehen, die die Gegenposition „absolute Theorie“ nennen und damit alle Argumente zusammenfassen, die nicht auf Generalprävention oder die Beeinflussung des Täters (Spezialprävention) setzen. Hinzu kommt ein weiteres Problem, nämlich die in Deutschland verbreitete Gleichsetzung von „absoluter Straftheorie“ mit Kant und Hegel. Die Konzentration auf historische Texte (s. z.B. Schild 2002; Wilms 2005) führt dazu, dass analytische Arbeit vernachlässigt wird. Vor allem verkennt diese Vorgehensweise, dass aus der Perspektive des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen und die daraus resultierende Last bei der Rechtfertigung des Strafjustizsystems nicht im Vordergrund standen. Strafbegründung muss heute aber innerhalb der Prämissen unserer Verfassung stattfinden (Rössner 2001, S. 978). Anstatt den ausgetretenen Pfaden zu folgen, die zu Textpassagen vor allem aus Kants „Metaphysik der Sitten“ und Hegels „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ führen, ist zu analysieren, welche Überlegungen als „absolute Begründungen“ eingeordnet werden könnten und ob diese überzeugen.
b. Ansätze, die man als „absolut“ bezeichnen könnte
14
Erstens könnte schon der Anspruch, dass der Sinn einer strafgerichtlichen Verurteilung überhaupt begründet werden müsse, zurückgewiesen werden. Maurachs bekannte Formel von der „zweckgelösten Majestät“ der Vergeltungsstrafe (Maurach 1971, S. 77) könnte so verstanden werden – Majestäten unterliegen gegenüber ihren Untertanen keinen Begründungspflichten. Die Behauptung fehlender Begründungsnotwendigkeit ist jedoch in einem modernen Rechtsstaat nicht ernsthaft zu vertreten. Dies gilt zum einen, weil die Verhängung von Kriminalstrafe ein sehr erheblicher Grundrechtseingriff ist, sowohl in der Form des sozialethischen Unwerturteils als auch in den Auswirkungen für Freiheit oder Vermögen. Zum anderen ist die Ausgabe großer Summen für die Kriminaljustiz gegenüber der Gemeinschaft der Steuerzahler in rationaler Weise zu begründen. Dieselben Einwände treffen die zweite, mit der ersten verwandte Variante, die sich aus der Formulierung „zweckgelöst“ ergibt. Es kann nicht der Verweis darauf genügen, dass es eine intrinsisch gute moralische Handlung sei, Übeltaten zu bestrafen (so Moore 1997, S. 159 ff.). Damit wird verkannt, dass Grundrechtseingriffe zu legitimieren sind, wofür die Angabe „intrinsisch gut“ nicht ausreichen kann, sondern ein Zweck anzugeben ist (Frisch 2000, S. 275; Leyendecker 2002, S. 73; Freund 2009, S. 2; Hassemer 2009, S. 94). Dasselbe gilt für die Rechtfertigung von Staatsausgaben, die nicht mehr nach dem Belieben eines absoluten Herrschers getätigt werden können. Die Thesen „es muss nicht begründet werden“ oder „Strafe muss keinem Zweck dienen“ sind umstandslos zu verwerfen.
15
Der Notwendigkeit, einen Zweck anzugeben, ist nicht (dritte mögliche Variante einer „absoluten Straftheorie“) mit dem Verweis Rechnung zu tragen, dass Strafe Schuld vergelten sollte. Umstritten ist, ob Kant eine solche Aussage trifft. Es liegt nahe, die Passage, die mit dem Satz beginnt „Richterliche Strafe … kann niemals bloß als Mittel, ein anderes Gute zu befördern, für den Verbrecher selbst oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muss jederzeit nur darum wider ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat;“ (Kant, S. 453) als Bekenntnis zu einer Vergeltungsstrafe zu verstehen (zu der gängigen Einordnung z.B. Klug 1968; Becchi 2002, S. 552 ff.). Betont man das Wort „bloß“, ist aber auch die Auslegung möglich, dass Kant lediglich pure Nützlichkeitserwägungen ausschließen wollte (Mosbacher 2004, S. 219). Nach einer ähnlichen Lesart verweist Kant auf den Grundsatz „keine Strafe ohne Gesetz“ und das Legalitätsprinzip (Byrd/Hruschka 2007, S. 960 ff.). Kants Werk liefert Anknüpfungspunkte für unterschiedliche, jeweils durchaus plausible Interpretationen (Greco 2009, S. 73 ff.). Der Auslegungsstreit kann hier dahinstehen; festzuhalten ist für unsere Zwecke, dass mit dem Bezug auf Vergeltung nicht zu begründen ist, warum auf eine (wie immer auch verstandene) persönliche Schuld Strafe folgen müsse. Dass mit Strafe auf ein in der Vergangenheit liegendes, zu tadelndes Geschehen reagiert wird, gehört zum Begriff der Strafe (Schmidhäuser 1971, S. 44; Neumann/Schroth 1980, S. 6; Neumann 2007, S. 438). Aber mit dem Verweis auf Vergeltung ist die Frage nach dem „warum“ nicht zu begründen.
16
Eine vierte Variante des Versuches, eine „absolute“ Straftheorie zu beschreiben, könnte darauf pochen, dass es gelte, „der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen“ (Formulierung bei Pawlik 2004a, S. 12). Aber auch diese Überlegung vermag nicht zu überzeugen. Gerechtigkeit verweist auf bestimmte Modi der Verteilung (von Gütern und immateriellen Vorteilen wie von Nachteilen). Gerechtigkeit kann oder soll zum Leitkriterium werden, wenn über das Wie einer Verteilung zu entscheiden ist (s. die klassische Ausarbeitung zur Verteilungsgerechtigkeit bei Aristoteles, Buch V), was aber voraussetzt, dass die Grundsatzentscheidung, etwas verteilen zu wollen oder zu müssen, bereits getroffen wurde (Pawlik 2004a, S. 56).
17
Eine fünfte mögliche Version einer „absoluten“ Straftheorie bringt vor, dass mit Strafe ein Zweck verfolgt werde – aber kein in weltlichen Gedankengebäuden verortbarer, sondern ein Zweck, der (nur) auf der Basis von religiösen Überzeugungen nachvollzogen werden kann. Es können sich unterschiedliche Argumente aus christlichen oder anderen religiösen Lehren ergeben. Zum einen wäre bei Vorstellungen anzusetzen, die Gott (oder Göttern oder anderen den Menschen übergeordneten Wesen) ein Interesse an menschlichen Angelegenheiten zuschreiben, und zwar ein Interesse, das sich auch auf die Sanktionierung von Übertretungen erstreckt. Die Vorstellung eines alttestamentarischen strafenden Gottes oder eines zu erwartenden Jüngsten Gerichts ließe sich heranziehen, um zu fordern, dass die irdischen Regeln parallel dazu ausgerichtet werden müssten. Dabei drängt sich allerdings der Einwand auf, dass eine Verdoppelung von Reaktionen erklärungsbedürftig wäre. Zum anderen könnten neutestamentarisch geprägte Vorstellungen von Sühne als Eigenleistung des Christen entwickelt werden, etwa darauf verweisend, dass Leiden durch Strafe eine christliche Tugend sei und sittlichen Wert habe (Pius II, S. 221 f.). Sieht man die Gottesrolle weniger als strafende denn als Gnade gewährende, könnte man auch darauf abstellen, dass weltliche Strafen dem Täter im Jenseits den Zugang zu voller Gnade eröffneten (Weitzel 2007, S. 32).
18
Es ist nicht erforderlich, dies im Detail auszuarbeiten. Denn wie auch immer die theologischen Anknüpfungspunkte beschaffen sind: Wenn man zu einer rechtlichen Perspektive wechselt, werfen sie unüberwindbare Probleme auf (Neumann/Schroth 1980, S. 14 f.). Die in einem Rechts- und Verfassungsstaat erforderlichen Grundstrukturen ziehen straftheoretischen Konzepten Grenzen. Zu diesen Grundstrukturen gehören Anforderungen an die Art und Weise der Begründung: Diese muss unabhängig von Glaubensinhalten sein. Inwieweit Staatsorgane generell, etwa auch bei Organisationsentscheidungen und Leistungsgewährungen, davon absehen müssen, religiöse Prämissen in Begründungen zu übernehmen (s. zu Begründungsneutralität Huster 2002, S. 98 ff.), kann für unsere Zwecke dahinstehen. Jedenfalls können Grundrechtseingriffe nicht mit dem Willen Gottes oder dem Schicksal der Betroffenen im Jenseits legitimiert werden.
2. Prävention von zukünftigen Straftaten
a. Spezialprävention
19
Eine spezialpräventive Rechtfertigung von Strafverhängungen nimmt an, dass durch Strafe das zukünftige Legalverhalten der Täter in vorteilhafter Weise zu beeinflussen sei. Vorstellbar ist ein solcher Effekt durch die abschreckende Wirkung der Strafverhängung und Strafvollstreckung (Individualabschreckung), durch gezielte therapeutische Intervention (Stichwort: Besserung) oder durch die Beschränkung der Möglichkeit zukünftiger Tatbegehung (Stichwort: Unschädlichmachung, s. von Liszt und zu dessen Marburger Programm Naucke 1982). Beschäftigt man sich damit, ob auf diese Weise die Existenz und die Tätigkeit der Strafjustiz aus der Perspektive der Allgemeinheit sinnvoll zu begründen ist, stellen sich folgende Fragen: Sind die behaupteten Wirkungszusammenhänge empirisch nachzuweisen? Und: Sind Effekte in einer Größenordnung zu erwarten, die es rechtfertigen, ein kostenintensives Strafjustizsystem zu unterhalten?
20
Individualabschreckung ist nur zu beurteilen, wenn Vergleiche angestellt werden: zwischen Personen, gegen die Kriminalstrafe verhängt wurde, und solchen in ähnlicher Ausgangslage, die vom Strafjustizsystem nicht erfasst wurden. Soweit es hierzu Befunde gibt, fallen diese negativ aus: Die Tatsache, strafgerichtlich verurteilt worden zu sein, scheint sich nicht messbar günstig auf die Rückfallwahrscheinlichkeit auszuwirken (s. zur Austauschbarkeit von Sanktionen Göppinger 2008, § 30 Rn. 55 f.). Geringfügig optimistischer fallen zeitgenössische Angaben zur Resozialisierung durch Behandlungsmaßnahmen aus. Das vor einigen Jahren geprägte, behandlungspessimistische Schlagwort „nothing works“ ist vermutlich zu undifferenziert: Interventionen, die auf Zielgruppen zugeschnitten sind, können bescheidene Erfolge vorweisen (Dölling 2003, S. 606). Grundsätzlich gilt aber, dass die Erfolgsaussichten vom Alter des zu Sozialisierenden und der sozialen Nähe der Beteiligten abhängen (Rössner 2001, S. 978). Die Annahme, dass staatliche Organe bei erwachsenen Personen regelmäßig stabile Verhaltensänderungen bewirken könnten, ist deshalb selbst dann fragwürdig, wenn die zu Resozialisierenden freiwillig mitwirken. Vergleichsweise einfach ist dagegen für einschneidende Maßnahmen der „Unschädlichmachung“ plausibel zu machen, dass diese wirken: Jahrzehntelange Inhaftierung verhindert zwangsläufig, dass die Inhaftierten erneut straffällig werden (jedenfalls außerhalb der Anstalt).
21
Welche Schlüsse sind aus der Erkenntnis zu ziehen, dass der Eintritt von Individualabschreckung zweifelhaft ist, sich resozialisierende Maßnahmen allenfalls in geringfügigem und nur Unschädlichmachung in größerem Umfang auf die Rückfallzahlen auswirkt? Nicht abzuleiten ist, dass dies hinreichende Gründe wären, ein Strafjustizsystem zu finanzieren. Selbst wenn es gelingt, durch gezielt auf geeignete Täter zugeschnittene Behandlungsprogramme die Rückfallwahrscheinlichkeit von (um eine hypothetische, aber nicht realitätsfremde Zahl zu nennen) 70 % auf 60 % zu senken, wäre dies ein Nutzen, der gegen sehr beträchtliche Kosten abzuwägen wäre. Bei einer Kosten-Nutzen-Abwägung wären Interventionen sinnvoller, die nicht den Umweg über aufwendige Tatermittlungen und -nachweise nehmen, sondern direkt und unmittelbar bei ungünstigen Sozialbedingungen ansetzen. Richtete man den Blick nur auf das zukünftige Verhalten von Personen, wäre es effektiver, die Gelder, die heute in die Strafjustiz fließen, stattdessen in z.B. frühkindliche Förderung zu investieren. Kosten-Nutzen-Analysen würden vermutlich auch auf Unschädlichmachung ein eher kritisches Licht werfen, wenn man die hohen Kosten pro Hafttag in Betracht zieht. Zur Sicherungsverwahrung bei einem Hang zu besonders schweren Delikten soll hier nicht Stellung genommen werden. Als allgemeineStrategie in Reaktion auf häufig vorkommende, nicht allzu schwere Delinquenz empfiehlt sich dieser Ansatz aus der Perspektive der Allgemeinheit nicht, wenn diese an Straftatenprävention, aber auch am angemessenen Einsatz öffentlicher Ressourcen interessiert ist.
22
Auf Spezialprävention wäre zurückzukommen, wenn Sanktionsarten und die Gestaltung der Vollstreckung zu erörtern wäre. Die bei Strafrichtern nicht selten anzutreffende Vorstellung, man müsse „etwas Sinnvolles“ aus dem Akt der Bestrafung machen und den Täter im Hinblick auf zukünftiges Verhalten unterstützen, steht vor dem Hintergrund, dass sie die Institution Strafjustiz als nicht hinterfragte Selbstverständlichkeit sehen. Bei den Entscheidungen, die das „Wie“ einer Bestrafung betreffen, können spezialpräventive Anliegen berücksichtigt werden. Das anders gelagerte Problem, die Existenz eines Strafjustizsystems zu rechtfertigen, ist damit jedoch nicht zu lösen.
b. Generalprävention
aa) Negative Generalprävention
23
Die Verhängung von Kriminalstrafen ist grundsätzlich eine notwendige Konsequenz, wenn man Androhungsgeneralprävention für legitim hält. Ohne einen hinreichend hohen Anteil aufgeklärter Taten und Verurteilungen wäre mit einer verhaltenssteuernden Wirkung von Strafnormen nicht zu rechnen (s. zur Notwendigkeit, leere Drohungen zu vermeiden, Feuerbach § 16; Schopenhauer, S. 434). Die Vermutung, dass es solche Wirkungen gibt, ist nicht nur eine alte (s. zur Rechtsgeschichte Birr 2007, S. 63 ff., 73 ff.), sondern auch plausible Annahme (Schmidhäuser 1971, S. 65 ff.; Rössner 2010, S. 703 ff.), die durch neuere empirische Befunde bestätigt wird. Analysen auf der Meta-Ebene, die eine Vielzahl von rechtstatsächlichen Untersuchungen auswerten, zeigen beständige Ergebnisse: Wie Personen die Wahrscheinlichkeit strafrechtlicher Folgen einschätzen, ist grundsätzlich geeignet, ihre Verhaltensentscheidungen zu beeinflussen (Bottoms/von Hirsch 2010).
24
Damit ist allerdings nicht gesagt, dass dieser Effekt bei allen Straftaten in gleicher Weise festzustellen ist. Wenn, was zu vermuten ist, die Stärke abschreckender Effekte in Abhängigkeit vom Deliktstyp schwankt, könnte es eine rationale Lösung sein, strafgerichtliche Verfolgung nur selektiv anzustreben. Im Gegensatz zur Androhungsgeneralprävention verursacht Strafverfolgung erhebliche Kosten. Für Delikte, bei denen mit nüchternen Kalkulationen potentieller Täter zu rechnen ist (etwa: Steuerhinterziehung), sind zwar auch in Anbetracht der Kosten regelmäßig erfolgende gerichtliche Verurteilungen als „Back up“ der Androhungsgeneralprävention vermutlich erforderlich. Bei Delikten, die typischerweise in emotionsgeladenen Kontexten, insbesondere nach einer persönlichen Interaktion mit dem Opfer begangen werden, könnte die Beurteilung anders ausfallen.
bb) Positive Generalprävention
25
Die Verhinderung zukünftiger Straftaten erstrebt auch der Ansatz, der den Verweis auf Generalprävention mit dem Adjektiv „positiv“ kombiniert. Ein Unterschied zur negativen Generalprävention liegt in der Bestimmung des Personenkreises, auf dessen Verhalten Einfluss genommen werden soll. Während Abschreckung gegenüber Individuen praktiziert werden soll, die selbst die Begehung einer Straftat in Erwägung ziehen, geht die These von der positiven Generalprävention davon aus, dass Strafurteile Personen ansprechen, die (regelmäßig) normtreu sind. Deren Bereitschaft, die Normenordnung als verbindlich anzuerkennen und sich entsprechend zu verhalten, werde unterminiert, wenn Normbrüche unwidersprochen blieben (s. zur Sicherung von Erwartungen durch Recht Luhmann 1970, 177 ff.; zu Verhaltensmodellen und Variationen Baurmann 1994, S. 368; Hassemer 1998, S. 41 ff.; zum Ansatz Jakobs’ Rn. 31).
26
Nachzuweisen sind solche Zusammenhänge kaum. Der Versuch, dies zu tun, würde einen tatsächlichen Ausfall von Strafjustiz als „natürliches Experiment“ voraussetzen, was nur unter extremen Bedingungen gesellschaftlicher Anomie vorstellbar ist. Es würde sich dann die komplizierte Aufgabe stellen, erstens den die Strafverfolgung betreffenden Teilaspekt von anderen Anomiephänomenen zu isolieren, und zweitens fehlende Abschreckung von Individuen ohne prinzipielle Normanerkennung von der Verunsicherung bei zuvor überwiegend normkonformen Personen abzugrenzen. Auf der Ebene der Plausibilität ist aber festzustellen, dass ein Zusammenhang von gerichtlicher Normbestätigung und späterem Legalverhalten in der Bevölkerung vermutlich besteht. Für eine detaillierte Analyse wären weitere Punkte anzusprechen, etwa, inwieweit die Geltungskraft von Normen situationsabhängig ist und die Bedingungen für Normakzeptanz komplexer und vielschichtiger sind, als Idealvorstellungen von positiver Generalprävention sie beschreiben (Schneider 2004, S. 331 f., 335). In ein hinreichend komplexes straftheoretisches Modell ist aber der Faktor „Sicherung von Normgeltung durch Kriminalstrafe“ auch dann zu integrieren, wenn nicht unter allen Umständen ein geradliniger Wirkungszusammenhang zu postulieren ist.
27
Eine andere Frage ist, inwieweit das Bemühen um positive Generalprävention zu Grundannahmen unseres Rechtssystems passt. Eine ernstzunehmende These verweist auf die Präventivwirkung des Nichtwissens (Popitz 1968). Aus dieser Sicht ist die gleichmäßige Verfolgung aller Normbrüche schädlich, weil dadurch für gesetzestreue Bürger offensichtlich würde, wie schlecht es um die Normbefolgungsbereitschaft vieler anderer steht. Von einer Theorie der positiven Generalprävention ausgehend, wäre eine bewusst selektive Strafverfolgung zu empfehlen. Es ist außerdem zu vermuten, dass die Folgen ausbleibender Normbestätigung stark deliktsabhängig sind. Studien zu den evolutionären und hirnphysiologischen Voraussetzungen moralischen Verhaltens deuten darauf hin, dass bei einer günstigen frühkindlichen Entwicklung Verhaltensdispositionen entwickelt werden, die grundlegenden moralischen Verhaltensanforderungen entsprechen. Geht es um die Vermeidung von Gewalttaten gegenüber anderen, ist die in frühen Lebensphasen entwickelte Fähigkeit zu Empathie wesentlich (s. Lehrer 2009, S. 162 ff.). Wenn früh entwickelte Anlagen die Einhaltung der (auch) im Strafgesetz enthaltenen Verhaltensnormen begünstigen oder sogar erzwingen, ist die Gefahr einer Erosion von Normgeltung wahrscheinlich gering. Anders dürfte es sich bei den vielen Delikten verhalten, bei denen Täter keine Konfrontation mit einem sichtbar durch die Tat leidenden Individuum aushalten müssen. Unter solchen Umständen kommt Rechtsnormen und ihrer tatsächlichen Durchsetzung größere Bedeutung zu.
cc) Fazit
28
Dass es strafgerichtliche Verurteilungen geben sollte, ist mit dem Verweis auf Generalprävention dem Grundsatz nach zu begründen. Dabei integriert das plausibelste Modell sowohl das Bemühen, das Verhalten von tatgeneigten Personen zu beeinflussen (negative Generalprävention), als auch das Bestreben, die Orientierungen von grundsätzlich normtreuen Personen zu unterstützen (positive Generalprävention), da sowohl Unterschieden zwischen Individuen als auch unterschiedlichen Deliktstypen Rechnung zu tragen ist (Kuhlen 1998, S. 62 f.; für die Einordnung der positiven Generalprävention als Sekundärphänomen Schünemann 1998, S. 113, 119 ff.). Allerdings müsste ein daran orientiertes, strikt zweckrationales Strafjustizsystem auf das Legalitätsprinzip verzichten und sich für selektive Strafverfolgung entscheiden. Dies ist jedoch kein Grund, eine generalpräventive Begründung für Strafverhängungen wieder zu verwerfen. Es bedarf vielmehr eines nicht folgenorientierten, also deontologischen Zusatzprinzips wie dem Gleichbehandlungsgrundsatz oder der Ergänzung um andere Strafzwecke, dazu unten Rn. 36 ff.
3. Expressive Straftheorien
29
Expressive Theorien haben mit präventionsorientierten Theorien gemeinsam, dass sie Kriminalstrafe einen Zweck beimessen, der auf legitime Interessen von Menschen aufbaut. Es geht aber nicht um die Beeinflussung der Straftatenhäufigkeit in der Zukunft, sondern um Interessen, die sich auf den Umgang mit vergangenem Verhalten beziehen. Expressive Theorien betonen die kommunikativen Funktionen von Strafurteilen. Unterscheiden kann man einen normorientierten expressiven und einen personenorientierten expressiven Ansatz. Personenorientiert expressiv sind Konzepte, denen zufolge die im Strafurteil steckende Botschaft bestimmte Personen ansprechen soll (den Täter oder das Tatopfer), während normorientierte expressive Straftheorien Botschaften betonen, die sich an unbestimmte Adressaten, die Allgemeinheit, richten (Stichwort: Normbestätigung).
a. Normorientierte expressive Straftheorien
30
Eine Variante expressiver Straftheorien sieht die Aufgabe der Kriminalstrafe darin, moralische Wertungen und Verhaltensanforderungen zu bekräftigen. Zu finden ist ein Fokus auf der Bekräftigung moralischer Normen bei angloamerikanischen Autoren, die Strafrecht ohne Weiteres als praktizierte Moralphilosophie begreifen, ohne den Unterschied zwischen Rechtsnormen und moralischen Verhaltensanforderungen zu thematisieren (s. z.B. Hampton 1992, S. 12 zu “false moral claims”, denen durch die Strafe widersprochen werden müsse). Vollzieht man diesen Unterschied in Rezeption der Kantischen Trennung von Rechts- und Tugendlehre nach, muss eine moralzentrierte Theorie der Strafe auf den Einwand stoßen, dass hierin keine angemessene Aufgabe des Staates liegen kann (Bastelberger 2006, S. 118 f.).
31
Anders kann die Beurteilung ausfallen, wenn es um die Bestätigung von rechtlichen Verhaltensnormen geht. Ein in der deutschen Diskussion etwa von Günther Jakobs vertretener Ansatz beginnt mit Überlegungen, die in ähnlicher Weise unter dem Stichwort „positive Generalprävention“ (s. Rn. 25 ff.) angestellt werden. Eine Straftat enthalte eine Botschaft, die nicht ignoriert werden könne. Es bedürfe der Entgegnung mit einem Widerspruch, um eine Erosion der Norm zu verhindern (Jakobs 2008, S. 111 ff.; ähnlich Frisch 1998, S. 139 ff.). Jakobs verzichtet darauf, eine Zunahme von Straftaten zu prognostizieren, wenn Widersprüche gegen eine Straftat unterblieben. Da der Fortbestand gelungener Formen menschlicher Kooperation sich vermutlich auch auf die Straftatenhäufigkeit auswirkt, besteht aber jedenfalls ein mittelbarer Zusammenhang mit dem Ziel „Prävention zukünftiger Delikte“. Es ließe sich darüber diskutieren, ob die Thesen Jakobs und verwandte Ansätze, die nicht in empirisch überprüfbarer Weise auf psychologische Prozesse verweisen, sondern nur auf kommunikative Prozesse (s. z.B. Gómez-Jara Diéz 2005 und zur Normbestätigung durch deklarativen Sprachakt Hamel 2009, S. 122 ff.), auch bei der positiven Generalprävention verortet werden könnten. Es liegt jedoch näher, sie in die Kategorie der expressiven Theorien einzuordnen.
32
Wenn der Widerspruch als solcher erforderlich ist, weil die Verständigung über Normen als Essenz von Gesellschaften verstanden wird (Jakobs 2008, S. 61 ff.), kann expressive Strafe als Selbstzweck gedeutet werden, der weder empirisch untersucht werden muss noch untersucht werden kann (Neumann 2007, S. 444). Dass Normen um ihrer selbst willen bekräftigt werden sollen, wird verschiedentlich als schwaches Argument angesehen (Mosbacher 2004, S. 220). Teilweise wird eine normorientierte expressive Theorie sogar als absolute Straftheorie eingeordnet (Küpper 1990, S. 211; Koriath 2004, S. 59), was nicht überzeugt, da Strafe nicht zweckfrei konzipiert wird. Der Verweis auf den Eigenwert von Normen weckt jedoch den Verdacht einer abstrakt-lebensfremden, nicht an den Interessen von Menschen ausgerichteten (Calliess 2001, S. 109) oder sogar in zynischer Weise die Verletzung von Individuen ausblendenden Theorie (Koriath 2004, S. 56). Diese Argumente weisen auf die Eindimensionalität und Ergänzungsbedürftigkeit des Konzepts der Normverdeutlichung hin, nicht allerdings auf seine Unrichtigkeit. Wenn Rechtsnormen sich als förderlich für friedliches Zusammenleben und Wohlergehen von Menschen erwiesen haben (wenn „das Individuum in der Gesellschaft sein Auskommen findet“, Jakobs 2008, S. 107), leuchtet es ein, dass sie im Falle der Missachtung durch expliziten Widerspruch bestätigt werden sollten (Feijoo Sánchez 2007, S. 88 ff.).
b. Personenorientierte expressive Straftheorien: Kommunikation mit dem Täter
33
In der deutschen Diskussion spielen personenorientierte expressive Ansätze keine große Rolle (anders aber in der zeitgenössischen englischsprachigen Literatur im Schnittbereich von Strafrecht und Philosophie, Duff 2001; Bomann-Larsen 2010, S. 15 f.). Eine Variante personenorientierter expressiver Straftheorien stellt auf die Notwendigkeit einer tadelnden Reaktion gegenüber dem Täter ab. Hintergrund ist die von Peter Strawson formulierte Feststellung, dass es zwei unterschiedliche Formen gibt, auf das Fehlverhalten anderer zu reagieren: entweder mit einer objektivierenden Einstellung, die den Täter als zu kontrollierendes Wesen (ähnlich einem gefährlichen Tier) begreift, oder mit einer teilnehmenden Einstellung, die den anderen als Teilnehmer an sozialen Beziehungen behandelt (Strawson 1974). Während Schopenhauer in seiner bekannten Metapher davon ausging, dass es genüge, einem „Raubthier“ einen „Maulkorb“ anzulegen (Schopenhauer I, S. 431), ist die Grundannahme kommunikationsorientierter Straftheorien, dass grundsätzlich eine teilnehmende Einstellung erforderlich sei und eine objektivierende Haltung nur in Ausnahmefällen eingenommen werden dürfe. Für die strafgerichtliche Verurteilung bedeutet dies, dass gegenüber den Schuldfähigen eine reaktive Haltung erforderlich ist und Strafe einen an den Täter adressierten Tadel beinhalten muss (von Hirsch 1993, S. 9 ff.; ders. 2005, S. 48 ff.; Hörnle/von Hirsch 1995, S. 270 ff.; Duff 1998, S. 189; Günther 2002, S. 216 ff.; s. ausführlich zur Bedeutung von alltäglicher und strafrechtlicher Missbilligung Hamel 2009, S. 99 ff., 150 ff.). Die Bedeutung des Unwerturteils lässt sich in zweierlei Weise begründen: soziologisch und/oder normativ. Die soziologische Begründung setzt bei einer Beschreibung gesellschaftlicher Praktiken an und stellt den Bezug zum Strafrecht her, indem funktionale Zusammenhänge thematisiert werden (die Akzeptanz strafgerichtlicher Urteile hänge davon ab, dass diese fundamentale gesellschaftliche Praktiken widerspiegelten). Unabhängig von rechtstatsächlichen Argumenten überzeugt die normative These: Die Bevorzugung teilnehmender Einstellungen ist bei jeder Form des interpersonalen Umgangs, auch innerhalb von staatlichen Verfahren, vorzugswürdig.
34
Im Einzelnen kann man Tadel in unterschiedlicher Weise sehen: als erforderliche Form einer anderweitig zu rechtfertigenden Bestrafung, als Selbstzweck oder als Mittel zu einem weiteren Ziel, nämlich der Selbstreform oder Sühne des Täters. Nach dem ersten Ansatz handelt es sich um eine Modalität, die mit dem Akt der strafgerichtlichen Verurteilung zwingend verbunden ist, die aber keine eigenständige Rechtfertigung der Institution Strafjustiz erlaubt (Neumann 2007, S. 439). Man kann die tadelnde Kommunikation mit dem Täter aber nicht nur als definierendes Element der Institution „Kriminalstrafe“ begreifen, sondern als Selbstzweck. Der Unterschied würde sich dann zeigen, wenn in einem Strafrechtssystem (etwa wegen Entfallens aller Strafvollstreckungsmöglichkeiten) eine Übelszufügung nicht mehr möglich wäre. Wer Tadel nur als Modalität der Verurteilung zu einer Übelszufügung ansieht, müsste unter solchen Umständen auf strafgerichtliche Verurteilungen verzichten – zu einer anderen Schlussfolgerung kommt man, wenn Tadel mit eigenem Wert neben der Übelszufügung steht.
35
Noch einen Schritt weiter geht, wer Tadel als Mittel zu einem Ziel einsetzt, nämlich zur Förderung von Selbsterkenntnis und Selbstverbesserung des Täters. Unter dem Stichwort „Sühnetheorie“ werden solche Überlegungen häufig der absoluten Straftheorie zugeschlagen, was jedoch nicht überzeugend ist, da es sich um ein zweckorientiertes Konzept handelt. Ein anspruchsvolles Modell dieser Art hat Anthony Duff entwickelt (Duff 1986, S. 47 ff., ders. 1998, S. 191 ff.; ders. 2001, S. 75 ff.), das beim angemessenen Umgang mit Fehlverhalten und individueller Buße in moralisch orientierten Gemeinschaften seinen Ausgangspunkt nimmt (s. zu Versöhnungsleistungen durch Buße Duff 1986, S. 64 ff.; ähnlich Lampe 1999, S. 268 ff.). Gegen Duffs Ansatz ist jedoch einzuwenden, dass derartige Gemeinschaften sich in ihrem Daseinsgrund entscheidend vom Staat unterscheiden. Kriminalstrafe kann nicht nach dem Vorbild von menschlichen Zusammenschlüssen modelliert werden, die auf moralische Verbesserung des Einzelnen angelegt sind. Die Ausübung von Zwang ist nicht mit einer angestrebten Selbstverbesserung des Täters zu rechtfertigen (so zu Recht schon Schopenhauer I, S. 431; Schmidhäuser 1971, S. 58).
c. Personenorientierte expressive Straftheorien: Kommunikation mit dem Opfer
36
Die kommunikative Funktion von Strafe kann außerdem mit Blick auf das Straftatopfer hervorgehoben werden. Offensichtlich kann mit diesem Gedanken eine vollständige Straftheorie nicht begründet werden, nämlich soweit nicht, als Delikte ohne individuelle Tatopfer zu ahnden sind. Dies ist jedoch nur dann ein relevanter Einwand, wenn man von der wenig überzeugenden Prämisse ausgeht, dass für das gesamte Spektrum möglicher Delikte in uniformer Weise der Sinn strafgerichtlicher Verurteilungen bestimmt werden müsse. In den gängigen Darstellungen zur Straftheorie tauchen diejenigen nicht auf, die durch die Tat geschädigt (oder konkret gefährdet) wurden. Die traditionelle Sicht ist kollektivistisch geprägt (Hörnle 2006, S. 951). Erst in jüngster Zeit wird (nunmehr aber intensiv) darüber debattiert, ob es ein legitimes Interesse des Opfers an einer Bestrafung des Täters geben kann (Murphy 1990; Reemtsma 1999; Walther 1999; Günther 2002; Hassemer/Reemtsma 2002; Holz 2007; Burgi 2007; Hamel 2009).
37
Bedenken gegen die Anerkennung solcher Individualinteressen könnten sich darauf stützen, dass Strafbedürfnisse möglicherweise nicht bestehen, weil Betroffene finanzielle Kompensation oder eine Entschuldigung vorzögen. Die Annahme, dass Tatopfern schon mit finanzieller Kompensation oder einer außergerichtlichen Verständigung gedient sei (Lüderssen 1999, S. 892 f.), ist allerdings vor allem bei erheblichen Straftaten gegen die Person (etwa eingriffsintensiven körperlichen Attacken, Sexualdelikten) nicht plausibel (s. dazu Reemtsma 1998, S. 215 f.). Aus normativer Sicht kommt es auch nicht darauf an, was ein bestimmtes Individuum nach seinen persönlichen Präferenzen als angemessene Reaktion ansieht. Das rein faktische Haben von Bedürfnissen wäre zur Begründung von Kriminalstrafe nicht ausreichend, etwa wenn diese nur als Rachegefühle beschrieben, aber nicht gerechtfertigt werden könnten (Reemtsma 1999, S. 26; Hassemer/Reemtsma 2002, S. 122 ff.). Entscheidend ist, ob das strafrechtliche Unwerturteil für Opfer im Allgemeinen eine von Rechts wegen anzuerkennende Funktion zu erfüllen hat. Ein Begründungsansatz verweist darauf, dass das Projekt der Monopolisierung von Gewaltanwendung beim Staat (Rössner 2001, S. 982 f.) nur dauerhaft Bestand haben kann, wenn die Reaktion auf eine Verletzung vor allem elementarer Opferrechte nicht unterhalb einer gewissen (kulturell bedingten) Eingriffsschwelle bleibt. Ein anderer Begründungsstrang stellt nicht auf die makrosoziologische funktionale Perspektive ab, sondern auf legitimeInteressen von Opfern. Diese können darin liegen, dass destruktive Konsequenzen für das zukünftige Leben verhindert werden, die sich aus der Demütigung des Opfers durch die Straftat ergeben (Fixierung auf die Tat, anhaltende Selbstzweifel, Verlust von Selbstachtung etc.) und aus dem Verlust des Vertrauens in die Rechtsordnung (s. dazu Prittwitz 2000, S. 172 ff.; Reemtsma 1999, S. 26 f.; Hassemer/Reemtsma 2002, S. 129 ff.; Holz 2007, S. 125 ff.; Hamel 2009, S. 167 ff.). Inwieweit Kriminalstrafe tatsächlich feststellbaren psychologischen Folgen oder negativen Konsequenzen für die Lebensführung effektiv entgegenwirkt, muss nicht im Einzelnen dargetan werden. Aus normativer Sicht gibt den Ausschlag, dass ein legitimes, kommunikationsorientiertes Opferinteresse auch dann besteht, wenn das kon kret betroffene Individuum mit einer stabilen psychischen Verfassung gesegnet ist und weder zu Rachephantasien noch zu selbstzweiflerischem Grübeln neigt, und sich auch nicht zu überzogenen Sicherheitsvorkehrungen veranlasst sieht.
38
Die Bedeutung des Unwerturteils liegt darin, dass es die Trennlinie zwischen Recht und Unrecht in präziser und detaillierter Weise, bezogen auf den Einzelfall, nachzeichnet. Dem Opfer wird bestätigt, dass ihm Unrecht geschehen ist und nicht ein Zufall oder ein Unglück sein Schicksal bestimmt hatten (Günther 2002, S. 218; Rössner 2001, S. 987; Walther 1999, S. 136 f.; Reemtsma 1999, S. 25; Hassemer/Reemtsma 2002, S. 130 f.; Hörnle 2006, S. 955; Holz 2007, S. 131 f.). Die Bedeutung für das Opfer ist bei einem institutionalisierten Unwerturteil durch staatliche Strafe größer als bei einer alltagskommunikativen Missbilligung des Tatgeschehens (Hamel 2009, S. 178 ff.). Der Verzicht auf ein staatliches Unwerturteil würde eine implizite Aussage beinhalten, die entweder das Delikt betrifft (das Vorgefallene sei keine Rechtsverletzung gewesen, oder es sei nicht gravierend genug, um jenseits der Ermöglichung zivilrechtlicher Verfahren staatliche Ressourcen zu bemühen) oder das Opfer (es sei selbst schuld, oder es sei als Person nicht ernst zu nehmen, ihm komme kein voller Bürgerstatus zu). Dabei ist die sachlich zutreffende Begründung nicht zu beanstanden, dass es sich um eine leichte Rechtsverletzung handle, die den Staat nicht zwingend zu eigener Reaktion verpflichte. Wenn es sich aber um eine gravierendeRechtsverletzung gehandelt hat, steckt im Unterbleiben einer staatlichen Reaktion zwangsläufig eine das Opfer betreffende Aussage. Die dann vorliegende Botschaft („Du bist es nicht wert, dass sich der Staat um deine Belange kümmert“) kollidiert mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Opfers (Weigend 2010, S. 50 ff.).
d. Warum Unwerturteil plus Strafübel?
39
Alle Varianten einer expressiven Straftheorie müssen sich der Frage stellen, warum es nicht mit dem Unwerturteil sein Bewenden haben kann. Noch drastischer könnte eingewandt werden, dass expressive Straftheorien die tatsächliche Bedeutung eines Strafurteils verzeichnen. Aus der Perspektive der Verurteilten ist in erster Linie von Interesse, dass ihnen ein Strafübel aufgezwungen wird, vor allem dann, wenn eine Freiheitsstrafe zu verbüßen ist, aber auch bei nicht-trivialen Geldstrafen. Vorstellbar sind zwar Formen der Reaktion auf eine Straftat, bei denen die kommunikative Funktion konsequent in den Vordergrund gestellt und das Element der Übelszufügung herabgestuft oder eliminiert wird (Duff 1998, S. 188; Günther 2002, S. 219; Kunz 2004, S. 75, 81; Seelmann 2004, S. 159 f.). Ist es möglich, unsere von solchen Überlegungen abweichende Strafpraxis – eine Strafpraxis mit teilweise sehr eingriffsintensiven Sanktionen – mit einer expressiven Straftheorie zu rechtfertigen?
40
Es gibt mehrere Antworten auf diese Frage. Eine liegt im Verweis auf die begrenzten Möglichkeiten, notwendige Differenzierungen mit einer nur in Worte gefassten Missbilligung auszudrücken. Schon auf der sprachlichen Ebene würde es schwer fallen, das Unwerturteil nach quantitativen Kriterien zu präzisieren. Die Feststellung, dass der Täter Unrecht getan hat, bereitet keine Probleme, anders aber Feinabstufungen jenseits einiger grober Kategorien (sehr groß, groß, mittel…). Und vor allem ist das Gewicht einer nur verbalen Botschaft in unserem sozialen Kontext limitiert. Dies gilt sowohl für lobende Kommunikation als auch für Missbilligungen. Eine Verdeutlichung des Ernstes einer Aussage ist durch symbolische Unterstützung in Form der Übergabe oder des Entzugs von tangiblen Gütern zu erreichen (Kleinig 1991, S. 417; Hörnle 1999, S. 123 f., Feijoo Sánchez 2007, S. 92 f.; Hamel 2009, S. 158 ff.). Dies entspricht unseren Praktiken bei Auszeichnungen (der mit X Euro dotierte Y-Preis wird verliehen), und es ist symbolische Untermauerung in besonderem Maß notwendig, wenn mit Nachdruck getadelt werden soll. Noch mehr als bei lobender Hervorhebung einer Leistung bedarf es bei einem Unwerturteil einer großen Spannbreite der Ausdrucksform. Wie stark die Unterfütterung des Verbalen durch handfeste Übelszufügung ausfallen muss, ist eine Frage der historisch geprägten Sensibilität einer Gesellschaft. Ganz ohne eine symbolische Verstärkung ist jedoch (entgegen Günther 2002, S. 219) nicht auszukommen. Aus der Sicht der Opfer wäre eine Untermauerung des Unwerturteils nur durch Schadensersatz oder Schmerzensgeld (dazu Pawlik 2004a, S. 53) unzureichend. Schadensersatz bringt lediglich den finanziellen Status quo wieder auf den Zustand vor der Tat, eine genuine Übelszufügung ist dies nicht. Auch Schmerzensgeld ist zur Verdeutlichung des Unwerturteils bei gravierenden Rechtsverletzungen unzureichend, nämlich soweit erheblicher Tadel nicht mehr durch eine finanzielle Einbuße verdeutlicht werden kann.
V. Ist die Verhängung von Kriminalstrafe gegenüber den Bestraften legitim?
1. Notwendigkeit einer Rechtfertigung
41
Wie dringlich die Frage nach Legitimität gegenüber den Bestraften ist, hängt davon ab, inwieweit Strafurteile Zwecken dienen sollen, die jenseits des kommunikativen Aktes liegen, der durch die Verurteilung vollzogen wird. Vergleichsweise unkompliziert ist die Rechtfertigung bei Straftheorien, die die Rolle des Tadels in den Vordergrund stellen und damit eine intrinsische Verbindung zwischen Strafzweck und legitimer Inpflichtnahme des Täters herstellen. Wenn die Tatsachenfeststellungen zutreffen, wenn die Grenzen zwischen Recht und Unrecht im konkreten Täter-Opfer-Verhältnis korrekt definiert sind und schuldhaftes Verhalten vorlag, ist das Unwerturteil gegenüber dem Täter in legitimer Weise zu erheben. Betrachtet man die Übelszufügung als Verstärkung und Ausdifferenzierung des kommunikativen Aktes, so wird ihre Rechtfertigung von der Rechtfertigung des Unwerturteils getragen.
42
Schwieriger wird es, wenn der Täter zur Erfüllung eines Zweckes in Anspruch genommen wird, der außerhalb des auf seine Person bezogenen kommunikativen Prozesses liegt. Ein solcher Zweck liegt bereits dann vor, wenn es um die expressive Bestätigung von Normgeltung geht. Besonders deutlich wird die Legitimation in Frage gestellt, wenn in der Zukunft liegende Ziele verfolgt werden sollen, nämlich die Minderung zukünftiger Strafhäufigkeit mittels der Mechanismen, die als negative oder positive Generalprävention beschrieben werden (Köhler 1997, S. 45 ff.; Zaczyk 2005, S. 217; Duff 1998, S. 187 f.). Der Gedanke, insoweit zwischen negativer und positiver Generalprävention zu differenzieren und positive Generalprävention wegen ihres „besseren Zweckes“ als unproblematischer anzusehen (so Hassemer 1998, S. 37), überzeugt nicht. Es geht in beiden Fällen darum, dass der Nutzen nicht der Nutzen des Bestraften ist, sondern seine Bestrafung fremdnützig begründet wird. Bedenken liegen bei der Strafverhängung näher als bei der Androhungsgeneralprävention (s. oben Rn. 12), weil es nicht um die abstrakt-generelle Ankündigung von Sanktionen geht, sondern um die Belastung eines Individuums. Wird hierdurch nicht der Bestrafte „unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt“ (Kant, S. 453), wie ein Hund behandelt (s. bereits oben Rn. 12) oder die Menschenwürde der Bestraften verletzt (Calliess 2001, S. 110; Leyendecker 2002, S. 74)?
43
Gegenansichten verweisen darauf, dass „der Schutz der Friedensordnung zweifellos ein hoher moralischer Wert“ sei (Klug 1968, S. 279), dass eine Pflicht des Staates zu gerechter Vorsorge bestehe (Lampe 1999, S. 263) oder eher lakonisch darauf, dass es „wohl oder übel“ notwendig sei, die Rechtsordnung erforderlichenfalls zwangsweise durchzusetzen (Frister 2009, S. 23 f.). Oder man akzeptiert die Behauptung, dass in der Rechtfertigung gegenüber den Bestraften ein Problem liege, und verknüpft mit der Einordnung von Strafe als Opfer des Bestraften die Erwartung, dass das schlechte Gewissen von Strafrichtern diese besser vor Selbstgerechtigkeit bewahre als eine vermeintliche Gewissheit, in gerechter Weise zu agieren (so Schmidhäuser 1971, S. 96 ff.). Bevor man es jedoch mit dem Verweis auf Nutzen und Notwendigkeiten bewenden lässt, ist zu erörtern, ob es nicht Möglichkeiten gibt, den Bestraften auf seine besondere Zuständigkeit zu verweisen.
44
Verfehlt ist es, das Etikett „Instrumentalisierung“ zu nutzen, um damit jegliche weitere Diskussion zu stoppen. Damit würde die Reichweite des Instrumentalisierungsarguments überdehnt, das allenfalls für extreme Fälle staatlicher Eingriffe (etwa Folter) absolute Verbote begründen kann (Greco 2009, S. 163 ff.). Im Übrigen kann es nur darum gehen, gegenüber dem Bestraften in einen Begründungsdiskurs einzutreten: Er muss darauf verwiesen werden, dass er nicht in beliebiger Weise herangezogen und zur Aufopferung für das Gemeinwohl verdammt wird (Ellscheid 2004, S. 34; generell zur Vorstellung eines Verantwortungsdialogs Neumann 1985, S. 269 ff.). Für einen solchen Begründungsdiskurs sind Argumente entwickelt worden, die zwei unterschiedlichen Grundansätzen mit jeweils weiteren Verästelungen zuzuordnen sind. Die erste Gruppe von Argumenten geht abstrakt-generalisierend vor und verweist auf Überlegungen wie gesellschaftsvertragliche Übereinkünfte und Fairness (Rn. 45 f.). Die zweite Gruppe zieht die Legitimation aus Bedingungen des konkreten Einzelfalles (Rn. 47 ff.). Zu überlegen ist, ob der Täter möglicherweise mit der Tat in seine eigene Bestrafung eingewilligt hat, ob der Umstand, dass er schuldhaft gehandelt hat, als Legitimationsgrund ausreicht oder ob es weiterer Fairnessargumente bedarf.
2. Abstrakt-generalisierende Überlegungen zur Legitimitätsfrage
45
Eine in der Gesellschaftsvertragstheorie des 18. Jahrhunderts debattierte Frage war, ob der Einzelne in einem solchen Übereinkommen auch darin einwilligen würde, bei Übertretung eines Strafgesetzes die Strafe auf sich zu nehmen. Insbesondere erschien fraglich, ob eine solche Klausel in den hypothetischen Vertrag aufgenommen würde, wenn damit in eine erhebliche Einbuße (vor allem des Lebens im Fall der Todesstrafe) eingewilligt würde (Überblick bei Seelmann 1991, S. 446 ff.).
46
Auch heute wird der Vertragsgedanke herangezogen, um zu begründen, dass es zulässig sei, Kriminalstrafe mit generalpräventiven Erwägungen zu legitimieren. Bei einer konsequenten Fokussierung auf die Figur des vollkommen rational kalkulierenden Individuums erscheinen solche Argumente plausibel. Die Errichtung eines Strafjustizsystems werde vereinbart, wenn spieltheoretische Überlegungen erwarten ließen, dass Verträge nicht eingehalten würden („pacta sunt servanda“ interessiert Nutzenoptimierer nicht). Deshalb müsse ein „homo oeconomicus“ im hypothetischen Sozialvertrag auch der Möglichkeit seiner eigenen Bestrafung zustimmen (Schmidtchen 2003, S. 266 ff.). Diese Ableitung ist im theoretischen Zugriff gut begründet, das Problem liegt aber wie bei allen Verweisen auf hypothetische Vereinbarungen in der großen Kluft zwischen der Kunstfigur des homo oeconomicus und der realen Verfasstheit von Menschen. Wer einerseits rational kalkuliert, andererseits aber auch weiß, dass seine Mitbürger sich auch an moralischen Konventionen und nur beschränkt an ökonomischen Berechnungen orientieren, würde vermutlich seiner eigenen Bestrafung nicht vorab zustimmen (Pawlik 2004a, S. 25 Fn. 16). Sozialvertragliche Modelle sind deshalb auf die Einfügung weiterer realitätsfremder Bedingungen, etwa Nicht-Wissen um die Bedeutung außerrechtlicher Verhaltenseinflüsse, angewiesen. Die legitimierende Kraft einer nur hypothetischen Zustimmung unter der ebenfalls nur hypothetischen Bedingung, dass alle Individuen ihr Leben konsequent rational-berechnend gestalten, ist schwach.
3. Einzelfallbezogene Überlegungen zur Legitimitätsfrage
a) Einwilligung des Täters durch die Tat; Subsumtion unter das eigene Gesetz
47
Kann der Täter darauf verwiesen werden, dass er nicht illegitimerweise Allgemeininteressen geopfert werde, weil er durch seine Straftat in seine eigene Bestrafung eingewilligt habe? In älteren Abhandlungen zur Straftheorie ist das Konstrukt einer Einwilligung verschiedentlich zu finden (dazu Seelmann 1991, S. 452 f.). Dies vermag nicht zu überzeugen: In die Tat kann nicht der Aussagegehalt hineingelesen werden, dass der Täter mit seiner Bestrafung nunmehr tatsächlich einverstanden sei. Mehr als die Behauptung, dass er vernünftigerweise hätte zustimmen müssen, ist nicht möglich (Seelmann 1991, S. 453) – dies führt zu den gesellschaftsvertraglichen Legitimationsversuchen zurück (Rn. 45 f.).
48
Hegel postulierte, dass der Täter als Vernünftiger durch seine Tat ein allgemeines Gesetz aufstelle und anerkenne, unter welches er dann als sein Recht subsumiert werden dürfe (Hegel, § 100). Auch dieses Argument trägt nicht (Koriath 2004, S. 63). Zum einen ist zweifelhaft, ob Personen durch Handlungen stets normative Stellungnahmen abgeben. Und selbst wenn man dem Täter „als Vernünftigem“ mit jeder Handlung eine normative Aussage unterstellte, wäre allenfalls die Aussage zu rekonstruieren, dass er sich Ausnahmen von der Geltung der allgemeinen Verbotsnormen genehmigen dürfe. Zum anderen dürfte der Staat, selbst wenn der Täter ein allgemeines Gesetz etwa des Inhalts „man darf andere nach freiem Belieben verletzen“ aufgestellt hätte, sich dieses evidentermaßen falsche Gesetz auch dann nicht zu eigen zu machen, wenn es im Akt der Strafe gegen den Täter gerichtet werden soll (Seelmann 1995, S. 69 f.).
b) Schuld des Täters (Anders-Handeln-Können)
49
Ein in der deutschen Strafrechtswissenschaft verbreiteter Versuch, die Legitimitätsfrage zu beantworten, stellt darauf ab, dass eine präventionsorientierte Straftheorie dann, und nur dann, akzeptabel sei, wenn sie als zweites Standbein auf die Schuld des Täters abstelle (Roxin 2006, § 3 Rn. 51 ff.; Schünemann 1987, S. 213; ders. 1998, S. 114 f.; Kuhlen 1998, S. 59; Stratenwerth/Kuhlen 2004, § 1 Rn. 32). Manchmal wird auch auf Gerechtigkeit verwiesen (Mosbacher 2004, S. 219 ff.; Neumann 1998, S. 150 f.; Weigend 2007, Einl. Rn. 66), die der Prävention gegenübergestellt werden müsse. Nicht überzeugend ist es, an dieser Stelle in den Bereich der Strafzumessung zu wechseln und auf das schuldangemessene Strafmaß abzustellen (so Roxin 2006, § 3 Rn. 51 ff.). Bevor Aussagen zur Strafzumessung möglich sind, ist zu klären, ob der Täter überhaupt zur Beförderung präventiver Anliegen in Anspruch genommen werden darf. Es ist nicht auf das Schuldmaß zu verweisen, sondern auf das Anders-Handeln-Können zum Tatzeitpunkt. Zu argumentieren wäre folgendermaßen: Sei dem Täter bekannt, dass er mit seinem Verhalten einen Straftatbestand erfülle (oder habe er immerhin Unrechtseinsicht), und entschließe er sich nichtsdestotrotz, so zu handeln, dann könne er sich nicht darauf berufen, unfair behandelt zu werden, wenn seine nachfolgende Verurteilung Normen bestätigen und zukünftige Straftaten durch andere verhindern solle. Derjenige, der gewusst habe, was auf ihn zukommen könne, und dies hätte vermeiden können, müsse die Konsequenzen tragen.
50
Dieser Gedankengang stößt jedoch auf zwei Einwände. Erstens reicht der Verweis auf Wissen bzw. Wissenkönnen und Vermeidemacht des Betroffenen nicht aus. Ist die Behandlung einer Person illegitim, so bleibt sie es auch, wenn der Betroffene gewarnt war und die Situation durch freie Entscheidung hätte vermeiden können. Wer weiß, dass er zur Erzwingung eines Geständnisses vermutlich verprügelt werden wird, und sich trotzdem aus freier Entscheidung in die Hände der Polizei begibt, verwirkt damit nicht den Anspruch, die ihm widerfahrene Behandlung als illegitim zu beanstanden. Wissentlich und vermeidbar die eigene Behandlung mit X herbeigeführt zu haben, bedeutet nicht, dass schon deshalb X legitim sei. Eine autonome Entscheidung des Täters kann deshalb allenfalls eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Legitimation der Bestrafung sein. Zweitens wird an dieser Stelle klar, wie straftheoretische Überlegungen mit einer Grundsatzdiskussion zusammenhängen, nämlich der Diskussion darüber, ob Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich frei entscheiden können, eine bestimmte Handlung aufgrund der Unrechtseinsicht zu unterlassen (Stichwort: Willensfreiheit und Hirnforschung). Im hier vorliegenden Rahmen kann auf dieses komplexe Thema nicht einmal ansatzweise eingegangen werden. Es muss der Verweis darauf genügen, dass auch aus diesem Grund die Hinwendung zu Fairnessargumenten (s. die nachfolgenden Rn.) erforderlich ist.
c) Das Fairnessargument
51
Weil die Reichweite des „Schuld als Anders-Handeln-Können“-Arguments begrenzt ist, bedarf es ergänzender Überlegungen dazu, warum Strafverhängung zur Erzielung präventiver Effekte legitim ist. Es ist möglich, solche Begründungen zu entwickeln, wenn der Gedanke der Fairness eingeführt wird: Dem Täter ist entgegenzuhalten, dass er mit der Verhängung einer Strafe nicht unfair behandelt wird. Zu erwägen wäre ein solches Argument mit dem Verweis darauf, dass er eine legitim zustande gekommene Norm missachtet habe, die er als Staatsbürger mitgetragen habe (Günther 1998, S. 165, 171 f.), oder mit dem Verweis darauf, dass der Verurteilte ein mit Rechten ausgestatteter Bürger auch im Falle der Strafverfolgung bleibe (Hassemer/Reemtsma 2002, S. 119). Überzeugender erscheint es mir, nicht nur auf demokratische Partizipationsmöglichkeiten und die Rechtsstellung im Verfahren zu verweisen, sondern darauf, dass jedermann, auch der Täter selbst, tatsächlich dadurch begünstigt wurde, dass in der Vergangenheit viele andere Personen sich normgemäß verhalten haben. Personen müssen es deshalb aus Fairnessgründen akzeptieren, zur Sicherung dieser Verbotsnormen selbst in Anspruch genommen zu werden (s. auch Neumann 2007, S. 449 f.; ders. 1998, S. 151). Am überzeugendsten ist dieses Argument, wenn der Täter als in Deutschland Lebender von der Normkonformität seiner Mitbürger profitiert hat. Aber auch gegenüber einem frisch eingereisten Ausländer kann das Fairnessargument angewendet werden, wenn er sich für den Aufenthalt in einem Rechtssystem entschlossen hat, das auf weitgehend funktionierender Respektierung von rechtlichen Verhaltensnormen beruht.
52
Es gibt im straftheoretischen Schrifttum Ansätze, die derartige Überlegungen nutzen, um eine eigenständige Straftheorie zu begründen. So verweisen etwa Herbert Morris und Jeffrie Murphy darauf, dass Strafe unfaire Vorteile kompensiere, die der Täter infolge fehlender Selbstbeschränkung gewonnen habe (Morris 1976, S. 33; Murphy 1979, S. 77 f.). Michael Pawlik stellt auf den Zusammenhang von Freiheitsgenuss und Loyalitätspflichten ab (2004a, S. 91; s. zu weiteren Varianten von Fairnessargumenten Engi 2008). Zu kritisieren ist an diesen Ableitungen, dass man allein mit dem Verweis auf unfair erlangte Vorteile und verletzte Loyalitätspflichten keine vollständige Straftheorie entwickeln kann. Sie beantworten insbesondere nicht die Frage, warum beträchtliche Ressourcen in ein Kriminaljustizsystem investiert werden sollten. Wichtig sind aber Fairnessargumente als ein notwendiges Begründungselement innerhalb einer komplexeren Theorie.
VI. Zusammenfassung von Thesen
53
1. Der Begriff „absolute Straftheorie“ ist schillernd und letztlich verzichtbar. Der Gedanke, dass man strafgerichtliche Verurteilungen nicht begründen müsse oder dass es sich um zweckfreies Geschehen handle, ist ohne Weiteres zu verwerfen. Genauso wenig können in unserem zeitgenössischen verfassungsrechtlichen Kontext Zwecke ausreichen, die nur religiös zu rechtfertigen sind.
53
2. Es bleiben für eine ernsthafte Beschäftigung nur solche Begründungen, die an ein legitimes Interesse der Allgemeinheit oder der Straftatopfer anknüpfen, wobei diese Interessen aber nicht zwingend in der Prävention zukünftiger Straftaten liegen müssen. Es empfiehlt sich, die nicht-präventionsorientierten, aber ernsthaft zu erörternden Ansätze als expressive oder kommunikationsorientierte Straftheorien zu bezeichnen. Die Dichotomie „absolute/relative Straftheorien“ sollte durch die Unterscheidung von präventionsorientierten Konzepten einerseits, expressiven Konzepten andererseits ersetzt werden.
54
3. Die gesetzliche Ankündigung von Sanktionen ist zu rechtfertigen, wenn mittels einer von der Straftheorie zu unterscheidenden Kriminalisierungstheorie die zugrunde liegende Verhaltensnorm zu begründen ist. Die Zufügung einer Sanktionsdrohung als zusätzlichem Verhaltensanreiz bedeutet kein grundlegendes Legitimationsproblem.
55
4. Überlegungen, die mit dem Begriff „Spezialprävention“ verbunden sind, können für die hier nicht erörterte Frage eine Rolle spielen, wie Strafe bemessen und vollzogen werden soll. Für die Straftheorie im engeren Sinne ist daraus aber nichts abzuleiten, da Ressourcen für erzieherische Interventionen besser anderweitig einzusetzen sind als vermittelt durch die Institution Strafjustiz.
56
5. Eine grundsätzlich plausible Erklärung dafür, warum eine Praxis staatlichen Strafens sozial nützlich und sinnvoll ist, liefern Ansätze, die auf negative Generalprävention und positive Generalprävention setzen. Zwar sind generalpräventive Wirkungen von Strafverhängungen nicht für alle Deliktstypen zu erwarten. Aber dies ist kein Grund, zweckrationale Erklärungen aus der Straftheorie zu verabschieden. Zum einen ist der Legalitätsgrundsatz auf ein deontologisches Prinzip wie den Gleichbehandlungsgrundsatz zu stützen. Zum anderen ist in eine vollständige Straftheorie ein anderer Aspekt zu integrieren: das berechtigte Interesse von Straftatopfern an einem nicht trivialen, d.h. durch Übelszufügung verstärkten Unwerturteil. Opfer haben berechtigte Genugtuungsinteressen bei den Delikten, bei denen typischerweise präventionsorientierte Erklärungen auf Probleme stoßen. Die Notwendigkeit von Prävention durch staatliche Strafe wird umso schwieriger zu begründen, je näher Rechtsnormen bei zentralen moralischen Normen liegen, die die Normgeltung sichern, und je mehr bei den Tätern trieb- und affektgesteuertes Verhalten jenseits bewusster Reflektionen und Risikoabschätzungen zu erwarten ist. Verhaltensweisen, für die dies gilt (schwere Verletzungen der körperlichen Integrität, Sexualdelikte), sind typischerweise solche, bei denen sich ein rationaler Strafzweck im Hinblick auf die Opferinteressen aus einer expressiven Straftheorie ergibt.
57
6. Generalpräventive Begründungen werfen außerdem das Problem auf, dass die Legitimation gegenüber dem zu Bestrafenden nicht aus dem sozialen Nutzen abgeleitet werden kann. Erforderlich sind anders gelagerte Argumente. Ob diese im Schuldgrundsatz (Anders-Handeln-Können) gefunden werden können, musste hier dahinstehen, weil die Diskussion um Willensfreiheit einen breiten Rahmen erfordert. Wichtig ist der Verweis auf Fairnessargumente. Weil der Täter von der Normkonformität anderer profitiert, kann er es in einem Verantwortungsdialog nicht als unfair beanstanden, im Falle der eigenen Normmissachtung bestraft zu werden.
58
7. Legitimationsprobleme stellen sich nicht für expressive Begründungen, die davon ausgehen, dass ein Unwerturteil abgegeben werden muss, weil dahinter ein berechtigtes Interesse des Tatopfers steht. Gibt das Unwerturteil die Grenzen zwischen Recht und Unrecht korrekt wieder, so kann der Täter dagegen keine Einwände erheben.
59
8. Eine Straftheorie, die mit einem einzigen Grundgedanken auskommt, kann nicht in überzeugender Weise entwickelt werden (Stratenwerth 1995, S. 20 ff.). Schon bei der Frage nach dem Strafzweck ist eine eindimensionale Antwort unzureichend, und es ist in weiteren Schritten außerdem die Legitimation gegenüber den Betroffenen zu begründen. Auch wenn Bedürfnisse nach der Überschaubarkeit einer „axiologisch geschlossenen“ Theorie (Pawlik 2004a, S. 53) nachvollziehbar sein mögen, müssen Versuche, eine solche zu begründen, mit Einbußen bei der Überzeugungskraft erkauft werden. Kombinationen unterschiedlicher Begründungsansätze sind unvermeidbar, um der Heterogenität der Verhaltensweisen, die als Straftat markiert werden, den unterschiedlichen Zeitperspektiven (proaktiv bei den Strafnormen, retroaktiv bei der Strafverhängung) und der Heterogenität unterschiedlicher, aber legitimer gesellschaftlicher wie individueller Interessen bei der Reaktion auf Straftaten soweit wie möglich gerecht zu werden. Überlegungen zur Straftheorie liefern nur Mosaiksteine, die in Abhängigkeit vom jeweils zu beurteilenden strafbaren Verhalten zu unterschiedlichen Bildern zusammengesetzt werden müssen.
VII. Bibliographie
Aristoteles, Nikomachische Ethik, Stuttgart 1969.
Ashworth, Andrew, Was ist positive Generalprävention? Eine kurze Antwort, in: Bernd Schünemann / Andreas von Hirsch / Nils Jareborg (Hrsg.), Positive Generalprävention, Heidelberg 1998, S. 65 ff.
Bastelberger, Marcus, Die Legitimität des Strafrechts und der moralische Staat: utilitaristische und retributivistische Strafrechtsbegründung und die rechtliche Verfassung der Freiheit, Frankfurt a.M. 2006.
Baurmann, Michael, Vorüberlegungen zu einer empirischen Theorie der positiven Generalprävention, GA 1994, S. 368 ff.
Becchi, Paolo, Vergeltung und Prävention, ARSP 88 (2002), S. 549 ff.
Binding, Karl, Die Normen und ihre Übertretung, Band 1, 3. Aufl., Leipzig 1916.
Birr, Christiane, „Kriminalstrafe ist öffentliche Rache“. Beobachtungen zum Strafgedanken in der juristischen Literatur der Frühen Neuzeit, in: Eric Hilgendorf / Jürgen Weitzel (Hrsg.), Der Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung, Berlin 2007, S. 59 ff.
Bomann-Larsen, Lene, Revisionism and Desert, Criminal Law and Philosophy 2010, S. 1 ff.
Bottoms, Anthony/von Hirsch, Andrew, The Crime-Preventive Impact of Penal Sanctions, in: Peter Cane/Herbert Kritzer, The Oxford Handbook of Empirical Legal Studies, Oxford 2010.
Burgi, Martin, Vom Grundrecht auf Sicherheit zum Grundrecht auf Opferschutz, in: Otto Depenheuer u.a. (Hrsg.), Festschrift für Josef Isensee, Heidelberg, München u.a. 2007, S. 655 ff.
Byrd, Sharon B./Hruschka, Joachim, Kant zu Strafrecht und Strafe im Rechtsstaat, JZ 2007, S. 957 ff.
Calliess, Rolf-Peter, Die Strafzwecke und ihre Funktion, in: Guido Britz / Heike Jung / Heinz Koriath (Hrsg.), Grundfragen des staatlichen Strafens, Festschrift für Heinz Müller-Dietz, München 2001, S. 99 ff.
Dölling, Dieter, Zur spezialpräventiven Aufgabe des Strafrechts, in: ders. (Hrsg.), Festschrift für Ernst-Joachim Lampe, Berlin 2003, S. 597 ff.
Duff, Anthony, Punishment, Communication and Community, New York 2001.
─, Prävention oder Überredung?, in: Bernd Schünemann / Andreas von Hirsch / Nils Jareborg (Hrsg.), Positive Generalprävention, Heidelberg 1998, S. 181 ff.
─, Trials and Punishments, Cambridge 1986.
Ellscheid, Günter, Zur Straftheorie von Anthony Duff, in: Henning Radtke u.a. (Hrsg.), Muss Strafe sein? Kolloquium zum 60. Geburtstag von Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Heike Jung, Baden-Baden 2004, S. 25 ff.
Engi, Lorenz, Ist Strafe als Vergeltung zu rechtfertigen?, ZSchR 2008, S. 407 ff.
Feijoo Sánchez, Bernhardo, Positive Generalprävention. Gedanken zur Straftheorie Günther Jakobs’, in: Michael Pawlik / Rainer Zaczyk (Hrsg.), Festschrift für Günther Jakobs, Köln 2007, S. 75 ff.
von Feuerbach, Paul Johann Anselm / Mittermaier, Karl Joseph Anton, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts. 14. Aufl., Giessen 1847.
Freund, Georg, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg 2009.
Frisch, Wolfgang, Strafkonzept, Strafzumessungstatsachen und Maßstäbe der Strafzumessung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in: Claus Roxin/Gunter Widmaier (Hrsg.), 50 Jahre Bundesgerichthof. Festgabe aus der Wissenschaft, Bd. IV, München 2000, 269.
─, Schwächen und berechtigte Aspekte der Theorie der positiven Generalprävention, in: Bernd Schünemann / Andreas von Hirsch / Nils Jareborg (Hrsg.), Positive Generalprävention, Heidelberg 1998, S. 125 ff.
Frister, Helmut, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., München 2009.
Göppinger, Hans, Kriminologie, 6. Aufl., München 2008.
Gómez-Jara-Diez, Carlos, Die Strafe: Eine systemtheoretische Betrachtung, Rechtstheorie 36 (2005), S. 321 ff.
Greco, Luís, Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie: ein Beitrag zur gegenwärtigen strafrechtlichen Grundlagendiskussion, Berlin 2009.
Günther, Klaus, Die symbolisch-expressive Bedeutung der Strafe, in: Cornelius Prittwitz u.a. (Hrsg.), Festschrift für Klaus Lüderssen, Baden-Baden 2002, S. 205 ff.
─, Freiheit und Schuld in den Theorien der positiven Generalprävention. Ein Beitrag zur normativen Kritik, in: Bernd Schünemann / Andreas von Hirsch / Nils Jareborg (Hrsg.), Positive Generalprävention, Heidelberg 1998, S. 153 ff.
Haffke, Bernhard, Tiefenpsychologie und Generalprävention, Aarau u.a.1976.
Hamel, Roman, Strafen als Sprechakt. Die Bedeutung der Strafe für das Opfer, Berlin 2009.
Hampton, Jean, An Expressive Theory of Retribution, ARSP Beiheft 47 (1992), 1.
Hart, H.L.A., Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law, Oxford 1968.
Hassemer, Winfried, Strafen im Rechtsstaat, Baden-Baden 2000.
─, Variationen der positiven Generalprävention, in: Bernd Schünemann / Andreas von Hirsch / Nils Jareborg (Hrsg.), Positive Generalprävention, Heidelberg 1998, S. 29 ff.
Hassemer, Winfried/Neumann, Ulfrid, Vor § 1, in: Urs Kindhäuser / Ulfrid Neumann / Ulrich Paeffgen (Hrsg.), Nomos-Kommentar zum StGB, Bd. 1, 3. Aufl., Baden-Baden 2010.
Hassemer, Winfried/Reemtsma, Jan Philipp, Verbrechensopfer. Gesetz und Gesetzlichkeit, München 2002.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, in: Werke Bd. 7, Frankfurt 1986.
Hirsch, Andrew von, Fairness, Verbrechen und Strafe: Strafrechtstheoretische Abhandlungen, Berlin 2005.
─, Censure and Sanctions, Oxford 1993.
Hobbes, Thomas, Leviathan, London 1651, dt. Übersetzung von Jacob Peter Mayer, Stuttgart 1970.
Hoerster, Norbert, Aktuelles in Arthur Schopenhauers Philosophie der Strafe, ARSP 58 (1972), S. 555 ff.
─, Zur Generalprävention als dem Zweck staatlichen Strafens, GA 1970, S. 272 ff.
Hörnle, Tatjana, Die Rolle des Opfers in der Straftheorie und im materiellen Strafrecht, JZ 2006, S. 950 ff.
─, Grob anstößiges Verhalten. Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, Frankfurt 2005.
─, Tatproportionale Strafzumessung, Berlin 1999.
Hörnle, Tatjana/von Hirsch, Andrew, Positive Generalprävention und Tadel, GA 1995, S. 249 ff.
Holz, Winfried, Justizgewähranspruch des Verbrechensopfers, Berlin 2007.
Hoyer, Andreas, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Lebendiges und Totes in Armin Kaufmanns Normentheorie, Berlin 1996.
Huster, Stefan, Die ethische Neutralität des Staates. Eine liberale Interpretation der Verfassung, Tübingen 2002.
Jakobs, Günther, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie, 3. Aufl., Berlin 2008.
─, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Berlin u.a. 1991.
Kant, Immanuel, Die Metaphysik der Sitten, 1797, Werkausgabe in zwölf Bänden, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt/M. 1977.
Kaufmann, Arthur, Dogmatische und kriminalpolitische Aspekte des Schuldgedankens im Strafrecht, JZ 1967, S. 553 ff.
Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre, 1. Aufl., Leipzig 1934.
Kleinig, John, Punishment and Moral Seriousness, Israel Law Review 25 (1991), S. 401 ff.
Klug, Urich, Abschied von Kant und Hegel, in: Jürgen Baumann (Hrsg.) Programm für ein neues Strafgesetzbuch. Der Alternativ-Entwurf der Strafrechtslehrer, 1968, S. 36; abgedr. in: Thomas Vormbaum (Hrsg.), Texte zur Strafrechtstheorie der Neuzeit, Bd. II, Baden-Baden 1998, S. 275 ff.
Köhler, Michael, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin u.a. 1997.
Koriath, Heinz, Zum Streit um die positive Generalprävention – Eine Skizze, in: Henning Radtke u.a. (Hrsg.), Muss Strafe sein? Kolloquium zum 60. Geburtstag von Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Heike Jung, Baden-Baden 2004, S. 49 ff.
Küpper, Georg, Schopenhauers Straftheorie und die aktuelle Strafzweckdiskussion, Schopenhauer-Jahrbuch 76 (1990), S. 207 ff.
Kuhlen, Lothar, Anmerkungen zur positiven Generalprävention, in: Bernd Schünemann / Andreas von Hirsch / Nils Jareborg (Hrsg.), Positive Generalprävention, Heidelberg 1998, S. 55 ff.
Kunz, Karl-Ludwig, Muss Strafe wirklich sein? Einige Überlegungen zur Beanwortbarkeit der Frage und zu den Konsequenzen daraus, in: Henning Radtke u.a. (Hrsg.), Muss Strafe sein? Kolloquium zum 60. Geburtstag von Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Heike Jung, Baden-Baden 2004, S. 71 ff.
Lampe, Ernst-Joachim, Strafphilosophie. Studien zur Strafgerechtigkeit, Köln u.a. 1999.
Lehrer, Jonah, The Decisive Moment. How the Brain makes up its Mind, Edinburgh u.a. 2009.
Leyendecker, Natalie Andrea, (Re-)Sozialisierung und Verfassungsrecht, Berlin 2002.
Liszt, Franz von, Der Zweckgedanke im Strafrecht, ZStW 3 (1883), S. 1 ff.
Lüderssen, Klaus, Muss Strafe sein? Das Strafrecht auf dem Weg in die Zivilgesellschaft, in: Felix Herzog / Ulfrid Neumann (Hrsg.), Festschrift für Winfried Hassemer, Heidelberg 2010, S. 467 ff.
─, Opfer im Zwielicht, in: Thomas Weigend / Georg Küpper (Hrsg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch, Berlin u.a. 1999, S. 879 ff.
─, Abschaffen des Strafens?, Frankfurt 1995.
Luhmann, Niklas, Positivität des Rechts als Voraussetzung einer modernen Gesellschaft, in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie 1 (1970), S. 175 ff.
Maurach, Reinhart, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Karlsruhe 1971.
Momsen, Carsten / Rackow, Peter, Die Straftheorien, JA 2004, S. 336 ff.
Moore, Michael, Placing Blame. A General Theory of the Criminal law, Oxford 1997.
Morris, Herbert, On Guilt and Innocence. Essays in Legal Philosophy and Moral Psychology, Berkeley u.a. 1976.
Morselli, Elio, Vergeltung - eine tiefenpsychologische Kategorie der Strafe?, ARSP 87 (2001), S. 221ff.
Mosbacher, Andreas, Kants präventive Straftheorie, ARSP 90 (2004), S. 210 ff.
Murphy, Jeffrie G., Getting even: The Role of the Victim, Social Philosophy & Policy 7 (1990), S. 209 ff.
─, Retribution, Justice, and Therapy. Essays in the Philosophy of Law, Dordrecht u.a. 1979.
Naucke, Wolfgang, Die Kriminalpolitik des Marburger Programms 1882, ZStW 94 (1982), S. 525 ff.
Neumann, Ulfrid, Institutionen, Zweck und Funktion staatlicher Strafe, in: Michael Pawlik/Rainer Zaczyk (Hrsg.), Festschrift für Günther Jakobs, Köln 2007, S. 435 ff.
─, Normative Kritik der Theorie der positiven Generalprävention, in: Bernd Schünemann/Andreas von Hirsch/Nils Jareborg (Hrsg.), Positive Generalprävention, Heidelberg 1998, S. 147 ff.
─, Zurechnung und „Vorverschulden“. Vorstudien zu einem dialogischen Modell strafrechtlicher Zurechnung, Berlin 1985.
Neumann, Ulfrid/Schroth, Ulrich, Neuere Theorien von Kriminalität und Strafe, Darmstadt 1980.
Pawlik, Michael, Person, Subjekt, Bürger. Zur Legitimation von Strafe, Berlin 2004. (2004a)
─, Kritik der präventionstheoretischen Strafbegründungen, in: Klaus Rogall/Ingeborg Puppe/Ulrich Stein u.a. (Hrsg.), FS für Hans-Joachim Rudolphi, Neuwied 2004, 213. (2004b)
Pius XII, Die Schuldvergeltung als metaphysisches Strafziel, in: Norbert Hoerster (Hrsg.), Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, Stuttgart 1987, S. 218 ff.
Prittwitz, Cornelius, Positive Generalprävention und „Recht des Opfers auf Bestrafung des Täters“?, Sonderheft KritV für Winfried Hassemer zum sechzigsten Geburtstag, 2000, S. 162 ff.
Popitz, Heinrich, Über die Präventivwirkung des Nichtwissens, Tübingen 1968.
Reemtsma, Jan Philipp, Das Rechts des Opfers auf die Bestrafung des Täters – als Problem, München 1999.
─, Im Keller, Reinbek 1998.
Rengier, Rudolf, Strafrecht Allgemeiner Teil, München 2009.
Renzikowski, Joachim, Normentheorie als Brücke zwischen Strafrechtsdogmatik und Allgemeiner Rechtslehre, ARSP 87 (2001), S. 110 ff.
Rössner, Dieter, Evidenzbasierte Kriminalprävention als Grundlage zweckrationaler Legitimation der Strafe, in: René Bloy u.a. (Hrsg.), Festschrift für Manfred Maiwald, Berlin 2010, S. 701 ff.
─, Die besonderen Aufgaben des Strafrechts im System rechtsstaatlicher Verhaltenskontrolle, in: Bernd Schünemann u.a. (Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin, Berlin 2001, S. 977 ff.
Roxin, Claus, Strafe und Strafzwecke in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Winfried Hassemer / Eberhard Kempf / Sergio Moccia (Hrsg.), In dubio pro libertate. Festschrift für Klaus Volk, München 2009, S. 601 ff.
─, Strafrecht Allgemeiner Teil Band I, 4. Aufl., München 2006
─, Wandlungen der Strafzwecklehre, in: Guido Britz / Heike Jung / Heinz Koriath u.a. (Hrsg.), Grundfragen des staatlichen Strafens, Festschrift für Heinz Müller-Dietz, München 2001, S. 701 ff.
Schild, Wolfgang, Verbrechen und Strafe in der Rechtsphilosophie Hegels und seiner „Schule“ im 19. Jahrhundert, ZRph 2002, S. 30 ff.
Schmidhäuser, Eberhard, Vom Sinn der Strafe, Nachdruck der Aufl. von 1971, Berlin 2004.
Schmidtchen, Dieter, Prävention und Menschenwürde. Kants Instrumentalisierungsverbot im Lichte der ökonomischen Theorie der Strafe, in: Dieter Dölling (Hrsg.), Festschrift für Ernst-Joachim Lampe, Berlin 2003, S. 245 ff.
Schneider, Hendrik, Kann die Einübung in Normanerkennung die Strafrechtsdogmatik leiten? Eine Kritik des strafrechtlichen Funktionalismus, Berlin 2004.
Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. I und II, in: Werke in zehn Bänden, Zürcher Ausgabe, Zürich 1977.
Schünemann, Bernd, Aporien der Straftheorie in Philosophie und Literatur, in: Cornelius Prittwitz u.a. (Hrsg.), Festschrift für Klaus Lüderssen, Baden-Baden 2002, S. 327 ff.
─, Zum Stellenwert der positiven Generalprävention in einer dualistischen Straftheorie, in: Bernd Schünemann / Andreas von Hirsch / Nils Jareborg (Hrsg.), Positive Generalprävention, Heidelberg 1998, S. 65 ff.
─, Plädoyer für eine neue Theorie der Strafzumessung, in: Albin Eser / Karin Cornils (Hrsg.), Neuere Tendenzen der Kriminalpolitik, Freiburg 1987, S. 209 ff.
Seelmann, Kurt, Schwierigkeiten der Alternativendebatte im Strafrecht, in: Henning Radtke u.a. (Hrsg.), Muss Strafe sein? Kolloquium zum 60. Geburtstag von Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Heike Jung, Baden-Baden 2004, S. 151 ff.
─, Anerkennungsverlust und Selbstsubsumtion. Hegels Straftheorien, Freiburg/München 1995.
─, Vertragsmetaphern zur Legitimation des Strafens im 18. Jahrhundert, in: Michael Stolleis u.a. (Hrsg.), Festschrift für Sten Gagnér, München 1991, S. 441 ff.
Stratenwerth, Günter, Was leistet die Lehre von den Strafzwecken?, Berlin 1995.
Stratenwerth, Günter/Kuhlen, Lothar, Strafrecht Allgemeiner Teil I, 5. Aufl., Köln u.a. 2004.
Strawson, Peter, Freedom and Resentment, in: ders., Freedom and Resentment and Other Essays, London 1974, S. 1 f.
Streng, Franz, Schuld, Vergeltung, Generalprävention. Eine tiefenpsychologische Rekonstruktion strafrechtlicher Zentralbegriffe, ZStW 92 (1980), S. 637 ff.
Walther, Susanne, Was soll „Strafe“?, ZStW 111 (1999), S. 123 ff.
Weigend, Thomas, „Die Strafe für das Opfer?“ - Zur Renaissance des Genugtuungsgedankens im Straf- und Strafverfahrensrecht, RW 1 (2010), S. 40 ff.
─, Einleitung, in: Wilhelm Laufhütte / Ruth Rissing-van Saan / Klaus Tiedemann (Hrsg.), Leipziger Kommentar zum StGB, 1. Bd., 12. Aufl., Berlin 2007.
─, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Grenze staatlicher Strafgewalt, in: Thomas Weigend/Georg Küpper, Festschrift für Hans Joachim Hirsch, Berlin u.a. 1999, S. 917 ff.
Weitzel, Jürgen, Der Strafgedanke im frühen Mittelalter, in: Eric Hilgendorf / Jürgen Weitzel (Hrsg.), Der Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung, Berlin 2007, S. 21 ff.
Wilms, Heinrich, Das Vergeltungsprinzip bei Immanuel Kant, ZRph 2005, S. 72 ff.
Zaczyk, Rainer, Zur Begründung der Gerechtigkeit menschlichen Strafens, in: Jörg Arnold u.a. (Hrsg.), Festschrift für Albin Eser, München 2005, S. 207 ff.
VIII. Verwandte Themen
Feuerbach, Paul Johann Anselm Ritter von | Hegel, Georg Wilhelm Friedrich | Handlung | Kant, Immanuel | Schopenhauer, Arthur | Schuld | Strafe | Strafverfahren | Rechtsgefühl | Rückwirkung | Zurechnung