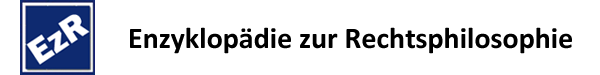Neue Beiträge
Grundlagen der Methodenlehre II:
Rechtspraxis, Auslegungsmethoden, Kontext des Rechts
Erstveröffentlichung: 04. Februar 2013
Methodenlehre und Rechtspraxis
- Die These vom Theorie-Praxis-Bruch
- Die Konstitution des Rechtsfalls
- Herstellung und Darstellung juristischer Entscheidungen
- Die juristische Methode als Qualitätsstandard
- Semantische Auslegung: Pluralität der Methoden und Methodenwahl
- Methoden zur Konkretisierung „weicher" Rechtsnormen
- Zur Relevanz von Kontextwissen
- Falltatsachen und Normtatsachen
- Alltagstheorien und Berufserfahrung
- Rezepte der postmodernen Rechtstheorie
Methodenlehre und Rechtspraxis
I. Die These vom Theorie-Praxis-Bruch
1
Josef Esser begann sein Buch über „Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung" (1970) mit der Feststellung, „daß unsere akademische Methodenlehre dem Richter weder Hilfe noch Kontrolle bedeutet". Seither gehört es zum guten Ton, in das Klagelied über den Abstand zwischen juristischer Methodenlehre und Rechtspraxis einzustimmen.[1] Vieles, was zur Begründung angeführt wird, wiederholt nur die allgemeine Methodenkritik.
2
Die These vom Theorie-Praxis-Bruch lässt sich so verstehen, dass die Praxis hinter der (an sich brauchbaren) Theorie zurückbleibt. Oder sie kann besagen, dass die juristische Methodenlehre an der Praxis vorbeiläuft. Als Indiz für die Irrelevanz der Methodenlehre für die Praxis dient die Tatsache, dass Gerichtsurteile nur selten explizit auf die Standards der Methodenlehre Bezug nehmen, sondern sich in der Regel mit der Anführung von Kommentarstellen und höchstrichterlicher Rechtsprechung zufrieden geben. Aber die Erwartung, dass die juristische Praxis ständig die Methodenlehre bemüht, geht von falschen Erwartungen aus. Die Rechtsgewinnung lege artis ist so aufwändig, dass sie als Praxismethode nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Die Praxis darf und muss sich auf die Vorarbeit des juristischen Schrifttums und auf Präjudizien verlassen und sich deren Argumentation zu Eigen machen. Das Geschäft der Rechtswissenschaft besteht zu einem erheblichen Teil darin, für die Rechtsprechung methodisch haltbare Begründungen vorzuschlagen, fehlende Begründungen nachzuliefern oder die Unbegründbarkeit von Entscheidungen zu konstatieren.
3
Die Methodenlehre, so wird kritisiert, vernachlässige die institutionelle Einbindung der Rechtsprechung (Strauch 2003: 5). Es ist ebenso zutreffend wie trivial, dass die richterliche Entscheidungstätigkeit von den Arbeitsbedingungen der Praxis geprägt wird. Das gilt sowohl für Arbeitslast und Informationsmöglichkeiten als auch für institutionelle Rahmenbedingungen wie Einzelrichter oder Kollegium, Stellung im Instanzenzug, mündliches oder schriftliches Verfahren, Beratungsgeheimnis, Begründungserfordernisse und die Möglichkeit, Abstimmungsergebnisse und abweichende Meinungen mitzuteilen. Daraus ergibt sich notwendig ein Abstand der Methode von der Praxis, aber kein Theorie-Praxis-Bruch. Strauch betont, richterliches Denken müsse in dem Sinne »netzwerkfähig« sein, dass es sich in die Organisation der Justiz einpasse; daraus gewinne es seine Kohärenz. „Die Kohärenz des juristischen Denkens ist keine subjektiv-individuelle Leistung des denkenden Ichs. Sie ist abhängig von der Kohärenz in den institutionellen Strukturen der Justiz, von ihrer Organisation." (Strauch 2003: 5) Das mag an sich zutreffen, gilt aber doch wieder nur aus der Sicht des externen Beobachters. „Wie Institutionen denken" (Douglas 1991), lässt sich wohl beschreiben, aber nicht zur Methode erheben.
4
Die juristische Methodenlehre stellt sich prinzipiell auf den Standpunkt eines Revisionsgerichts. Deshalb ist von vornherein nicht zu erwarten, dass die Instanzgerichte explizit die Methodenlehre bemühen. Anders liegt es bei den Revisionsgerichten. Inzwischen liegt eine Reihe empirischer Untersuchungen zur Begründungspraxis des BGH vor. Raisch (1988), Seiler (1992) und Muscheler (2001) haben Zivilurteile des BGH durchgesehen, Simon (2005) sowie Kudlich und Christensen (2009) Strafurteile. Die Untersuchungen zeigen übereinstimmend, dass Präjudizien das wichtigste Begründungselement in obergerichtlichen Urteilen bilden.[2] Aber bemerkenswert häufig wird explizit die juristische Methodenlehre bemüht und ebenso bemerkenswert ist es, dass häufig auf eine historische Gesetzesauslegung zurückgegriffen wird.
5
Solche Untersuchungen begegnen allerdings dem Einwand, dass die Bezugnahme auf die Methode nur der nachträglichen Darstellung der Entscheidung gedient habe. Die Methodenlehre sei insofern unehrlich, als sie nicht im Stande sei, außerjuristische Einflüsse bei der Entscheidungsbildung sichtbar und kontrollierbar zu machen. Dieser Gesichtspunkt wird gewöhnlich – so auch hier – unter der Überschrift „Herstellung und Darstellung juristischer Entscheidungen" abgehandelt.
II. Die Konstitution des Rechtsfalls[3]
6
Die juristische Methodenlehre wird als praxisfern kritisiert, weil sie dem „Fall" als lebensweltlicher Anbindung aller Rechtsfindung keinen angemessenen Platz einräume. Die Praxis sei in erster Linie mit der Sachverhaltsermittlung befasst, ein Handlungsbereich, der von der juristischen Methodenlehre völlig vernachlässigt werde (Strauch 2001: 199, 2003: 2). Tatsächlich überlässt die akademische Methodenlehre den Themenbereich der Sachverhaltsermittlung den Rechtspsychologen und der Praktikerliteratur.[4] Das ist aber kein Einwand gegen ihre Praxistauglichkeit. Die Sachverhaltsfeststellung fordert ganz andere Methoden als die Rechtsgewinnung. Ein möglicher Kritikpunkt ist allenfalls, dass die Methoden der Sachverhaltsermittlung im juristischen Studium vernachlässigt werden.
7
In der juristischen Ausbildung wird die Methode der Rechtsgewinnung an Fällen geübt, die kontextfrei auf bestimmte Normen zugeschnitten sind. In der Praxis gewinnt der Fall, der entschieden werden soll, seine Konturen jedoch oft erst aus der anzuwendenden Rechtsnorm, während umgekehrt die Rechtnorm im Blick auf einen bestimmten Sachverhalt gewählt wird – eine spezielle Erscheinungsform des hermeneutischen Zirkels. Nach einer sprichwörtlich gewordenen Formulierung von Engisch (1943: 15) geht es um das „Hin- und Herwandern des Blicks zwischen Obersatz und Lebenssachverhalt". Dieses Phänomen dient immer wieder als Argument gegen die Entscheidungserheblichkeit der üblichen juristischen Auslegungsmethoden. Dazu taugt es nicht. Es könnte jedoch Anlass sein, den Gegenstandsbereich der Methodenlehre über die Auslegungsmethoden im engeren Sinne hinaus auf die Anleitungen zur Fallbearbeitung im juristischen Studium und auf die für die Gerichtspraxis maßgebliche Relations- oder Gutachtentechnik auszudehnen. Rechtsdogmatisch wird die Konstitution des Rechtsfalls unter dem Gesichtspunkt der richterlichen Aufklärungspflicht verarbeitet.
8
Die Konstitution oder „Konstruktion des Rechtsfalls" ist auch Gegenstand empirischer Forschung gewesen (Schmid/Drosdeck/Koch 1997; zusammenfassend Lerch 2010; Stegmaier 2009; Hellmig 2010). Im Ergebnis laufen diese Untersuchungen auf eine Rechtfertigung der richterlichen Praxis hinaus. Für eine Kritik der juristischen Methodenlehre liefern sie kein Material.
III. Herstellung und Darstellung juristischer Entscheidungen
9
Hermann Isay (1873-1938), der noch zur Freirechtsschule gezählt wird, hatte 1929 die These begründet, dass juristische Entscheidungen zunächst „durch konstruktive Phantasie und nachfolgendes Wertfühlen oder durch Intuition" gefunden und erst nachträglich an einer Rechtsnorm kontrolliert und dadurch rationalisiert würden. Heute knüpft man meistens bei Niklas Luhmann an, der die Unterscheidung zwischen der Herstellung und der Darstellung einer Entscheidung eingeführt hat (1966: 51).[5] Sie wird vielfach benutzt, um die Leistungsfähigkeit der juristischen Methode in Zweifel zu ziehen: Die Argumente, mit denen eine Entscheidung begründet werde, seien regelmäßig gar nicht die wahren Gründe, sondern nachträgliche Rechtfertigung oder, schlimmer noch, Verdeckung der wahren Motive.[6] Doch das war weder die Aussage Isays noch diejenige Luhmanns.
10
Isay hatte allerdings den Vorgang der Entscheidungsfindung als irrational bezeichnet, wollte ihn damit aber keineswegs psychologisch erklären und schon gar nicht in den Bereich der Willkür oder Unredlichkeit abdrängen. „Die Aufgabe, die hier vorliegt, darf nicht ... der Psychologie zugewiesen werden, die es mit empirischen, der Beobachtung und dem Experiment zugänglichen Erlebnissen und Erlebniszuständlichkeiten des Bewußtseins zu tun hat, aber nicht ermitteln kann, was im Fühlen, im Wollen sich an Ideengehalten, an Wertgehalten usw. uns erschließt; der Bereich der Psychologie wird durch die Grenzen des vital gebundenen Seelenlebens bestimmt, außerhalb deren das Reich des geistig-noetischen Seins liegt. Neben dem Reich des Psychischen gibt es noch ein drittes Reich, das Reich der Bedeutungen, der Werte" (Isay 1929: 42f.). Dazu verwies Isay auf Rickert, Lask und Reinach und fuhr fort: „Für die Erschließung dieses Reiches ist die Methode der Erkenntnis des Psychischen nicht ausreichend. Hier kann nur die Forschungsmethode der Phänomenologie wirklich fruchtbare Ergebnisse liefern." Gemeint war die Phänomenologie Edmund Husserls.[7]
11
Unter dem Einfluss der Hermeneutik wurde aus dem Rechtsgefühl bei Esser das Vorverständnis. Esser sah in dem Vorverständnis ein Strukturelement des Verstehens (1970: 133ff.), nicht aber ein psychisches Phänomen im Sinne eines Vorurteils oder einer Attitüde. Er verteidigte daher gegen Isay die Rationalität richterlichen Entscheidens. Später beklagte er, sein Buch sei nicht immer richtig verstanden worden; er sei kein Freirechtler. Die herkömmliche Methodenlehre gehöre nicht abgeschafft, sondern müsse gerade umgekehrt ernst genommen werden, weil sie einen Teil jener argumentativen Figuren liefere, in denen die Plausibilität von Begründungszusammenhängen zumindest für Juristenkreise konsensfähig werde (Esser 1975).
12
Luhmann schließlich betont, es bestehe von vornherein gar nicht der Anspruch, dass die realpsychischen Vorgänge nach den Vorschriften der Methodenlehre abliefen. „Der Schluß vom Tatbestand auf eine Rechtsfolge ist für den Juristen die Endgestalt, in der einer sein Arbeitsergebnis präsentiert, nicht aber ein Abbild oder Modell seiner faktischen Entscheidungstätigkeit. Die logische Form hat eine Darstellungsfunktion. Die juristische Entscheidung wird mithin durch bestimmte Darstellungserfordernisse, nicht aber im Prozeß ihrer Herstellung gesteuert." (Luhmann 1966:51)
13
Das alles bedeutet nicht, dass die Methodenlehre für die Herstellung von Entscheidungen irrelevant wäre, denn die in der Methode vorgezeichneten Darstellungsnotwendigkeiten sind immer auch bei der Herstellung psychisch präsent. Isay verwies auf Rechtsgefühl und Intuition.[8] Luhmann meinte, der gute Einfall komme nur dem geschulten Kopf. Das Vorverständnis kann man auch als sedimentiertes Wissen betrachten. Heute würde man wohl von implizitem Wissen oder tacit knowledge (Michael Polanyi) sprechen.[9] Unergiebig sind Bemühungen, den von Peirce eingeführten Gedanken der Abduktion nutzbar zu machen.[10] Sie laufen auf die Aufwertung des aus der Psychologie bekannten Association-Bias zu einer Theorie hinaus.
14
Aus sich heraus ist die Methodenlehre zwar zur Selbstkritik in der Lage. Sie kann jedoch weder ihre determinierende Kraft belegen noch externe Einflüsse beweisen oder ausschließen. Dazu bedarf es deskriptiv-empirischer Untersuchungen.
15
Eine aufwändige Simulation von Zivilprozessen konnte keinen Bruch zwischen Herstellung und Darstellung der Entscheidung belegen (Schmid/Drosdeck/Koch 1997; zusammenfassend Lerch 2010). Es ging dabei um ein interessantes Experiment, das mit einem fiktiven Arzthaftungsfall die vermutlich unterschiedliche Reaktion von 52 Richtern überprüfen sollte. Dazu wurde eine Prozess-Situation hergestellt, in der die Probanden den Fall von Anfang bis Ende durchspielen konnten. Sie konnten einen Verhandlungstermin bestimmen, Parteien, Zeugen und Sachverständige laden, Fragen stellen und Beweis erheben und sollten am Ende ihr Urteil fällen. Das Vorgehen der Richter war durchaus nicht gleich und auch ihr Urteil fiel nicht einheitlich aus, die Differenzen waren aber nicht dramatisch. Doch irgendwelche Determinanten, die das Verfahren in eine bestimmte Richtung gelenkt hätten, konnten nicht ausgemacht werden. Auffallend war nur eine Bevorzugung der Anspruchsgrundlage, die arbeitsökonomisch den geringsten Aufwand verursachte. Da Verfahrens- und Urteilsvarianzen sich nicht auf systematische Einflüsse zurückführen ließen, konnte „nur noch der bloße Zufall als Erklärung herangezogen werden".
16
Entscheidungstheoretisch orientierte Verfahrensbeobachtungen zeigen vor allem Systemzwänge und Professionszwänge. Diese wirken sich jedoch in erster Linie auf die Steuerung des Verfahrens aus. Sie fördern insbesondere die Vermeidung von Entscheidungen. Am nächsten kommt der juristischen Methode die wissenssoziologische Perspektive Stegmaiers. Für pathologische Deformationen der juristischen Methode durch die Praxis, insbesondere im Gerichtsverfahren, gibt es jedoch bisher keinen Beleg. Empirische Untersuchungen[11] haben dafür nichts ergeben. Sie bescheinigen den Richtern vielmehr, was Wolff und Müller (1997) kompetente Skepsis genannt haben. Das Verstecken der wahren Motive hinter der Darstellung als bloßer Fassade ließe sich gar nicht durchhalten.
17
Die amerikanische Richtersoziologie hat immerhin gezeigt, dass politisch interpretierbare Attituden einen Einfluss auf die Entscheidung haben. Psychologische Untersuchungen waren dagegen bisher eher unergiebig.[12] Allerdings ist die von der Psychologie zusammengestellte lange Liste der Heuristiken und kognitiven Verzerrungen bislang im Hinblick auf die juristische Methode noch nicht abgearbeitet worden.[13] Sie könnte neues Licht auf die Sammlung, die Bewertung und die Auswahl von Entscheidungsalternativen und von Argumenten werden.
18
Schließlich gibt auch die rhetorische Analyse von Entscheidungsgründen keinen Anhaltspunkt für eine pathologische Differenz von Herstellung und Darstellung der Entscheidung. Zwar kann die idealisierende, um Akzeptanz werbende Darstellung in Urteilsgründen schwerlich darüber täuschen, dass sie nicht den sozialen und psychischen Prozess der Herstellung der Entscheidung beschreibt. Die Darstellung der Gründe folgt einer Rhetorik der Stringenz und verschweigt Zweifel oder Unsicherheit. Sie unterdrückt nicht selten auch Folgenüberlegungen, die nicht illegitim wären, die sich jedoch mit den für Beweiserhebung und juristische Argumentation üblichen Maßstäben nicht begründen lassen. Es besteht aber kein Grund zu der Annahme, dass das Geschäft der Entscheidungsbegründung organisierter Zynismus sei, dazu bestimmt, die wahren Entscheidungsgründe zu verbergen. Gräfin von Schlieffen (2011: 115) meint, dass der Zwang zur „idealisierenden Darstellung ... formierend auf die Muster der Herstellung" zurückwirke, und sie hatte schon früher[14] auf rhetorische Figuren in Gestalt von „Kryptoreferenzen" hingewiesen, die Regelhaftigkeiten und Anweisungen enthalten, welche bei der Herstellung von Entscheidungen wirksam werden und für deren relative Gleichförmigkeit bedeutsam sind, auch wenn sie meist nicht als solche benannt und bedacht werden. Man darf deshalb darauf vertrauen, dass die angegebenen Gründe im Großen und Ganzen auch die entscheidungsleitenden Gründe waren.
IV. Die juristische Methode als Qualitätsstandard
19
Weil die Herstellung juristischer Entscheidungen jenseits des rechtlich geordneten Verfahrens keiner externen Kontrolle unterworfen werden kann (und darf), ist die Darstellung der Entscheidungsgründe neben Organisation und Verfahren der einzige Ansatzpunkt zur Disziplinierung richterlicher Tätigkeit. Die Kommunikation über die Urteilsgründe verläuft in den Bahnen der juristischen Methodenlehre.[15] Oder, wie Luhmann es formuliert: Die Funktion der juristischen Begründung „ist, die intersubjektive Übertragbarkeit und Kontrollierbarkeit der Denkergebnisse sicherzustellen, auf welchen Wegen auch immer man faktisch zu ihnen gelangt ist" (Luhmann 1966: 51, Fn. 3). Damit bekommt der institutionelle Kontext, in den die entscheidende Instanz eingebunden ist, maßgebliche Bedeutung: Jedes Gericht, ob Amtsgericht oder der BGH, steht in der Beobachtung anderer Gerichte, der Wissenschaft und der Öffentlichkeit, und diese tragen ein Wesentliches zur Rückbindung der Gerichte bei. Die Methodenlehre liefert die Metasprache, mit der sich professionelle Juristen untereinander verständigen, wenn sie wechselseitig über ihre Arbeit reden.
20
Was die juristische Methode in Verruf bringt, sind nicht zuletzt Qualitätsmängel in der Arbeit der Juristen. Über die Qualität durchschnittlicher Anwaltsschriftsätze muss man aus Höflichkeit schweigen. Viele Amtsgerichtsurteile sind nach den Maßstäben für eine Examensklausur „mangelhaft". Auch die Entscheidungen höherer Gerichte leiden nicht selten unter handwerklichen Mängeln. Bevor die juristische Methode überhaupt greifen kann, ist handfeste empirische Such-, Sammel- und Ordnungsarbeit zu leisten. Fehlleistungen gehen viel eher auf das Konto von unzureichendem „legal research", als dass sie in Unzulänglichkeiten der Methode begründet sind.
Auslegungsmethoden
I. Semantische Auslegung: Pluralität der Methoden und Methodenwahl
1) Die Standardmethoden der Auslegung
21
Traditionell unterscheidet man vier Standardmethoden, die den Methodenkanon bilden, die grammatische oder Wortauslegung, die historische, die systematische und die teleologische Auslegung. In den letzten Jahrzehnten ist der Kanon angewachsen. Die völkerrechtskonforme, die europarechtskonforme und die verfassungskonforme Auslegung haben erheblich an Bedeutung gewonnen, werden meistens aber noch als Unterfall der systematischen Auslegung behandelt. Das ist kaum gerechtfertigt, weil diese drei Gesichtspunkte sich gegenüber anderen durchsetzen. Die Rechtsvergleichung dagegen, die früher bei der Auslegung von Gesetzen nur marginale Bedeutung hatte und ebenso der systematischen Auslegung zugeordnet wurde, ist im Zuge der Europäisierung und der Globalisierung so wichtig geworden, dass sie heute als „fünfte" Auslegungsmethode (Häberle 1989) gilt.[16] Die Folgenberücksichtigung, die bis dahin bei der teleologischen Auslegung eine unscheinbare Rolle spielte, könnte sich unter dem Einfluss insbesondere der ökonomischen Analyse des Rechts als sechste Auslegungsmethode verselbständigen.
22
Objektive und subjektive Auslegung sind neben den genannten keine eigenen Auslegungsmethoden, sondern Theorien über die Relevanz der Standardmethoden. Sie dienen nicht als „Auslegungsmittel", sondern zur Bestimmung des „Auslegungsziels" (Engisch 1997: 123, Fn. 48). Es ist daher besser, von subjektiver und objektiver Theorie (der Auslegung) zu sprechen. Die Sache ist allerdings noch etwas komplizierter, denn die Auslegungstheorien wirken auf die Standardmethoden zurück. Die objektive Theorie macht von der teleologischen Auslegung nicht bloß Gebrauch, um einen vom politischen System vorgegebenen oder einen allgemein konsentierten Normzweck zu ermitteln, sondern leitet im Bedarfsfall aus Prinzipien und Werten eigene Zwecksetzungen ab. Analog nutzt sie auch die systematische Auslegung, um über eine bloße Einpassung der Lösung in das System hinaus kreativ zu werden.
2) Das Problem der Methodenwahl
23
Seit Essers „Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung" gilt es als ausgemacht, dass die Praxis ein „erschütterndes Bild der Beliebigkeit von Methodenpräferenzen" (Esser 1970: 123, Fn. 24) biete, dass die Prioritätsfrage theoretisch unlösbar sei und die Methodenwahl daher von dem immer irgendwie politisch geprägten Vorverständnis des Richters abhänge. Dieser Standpunkt lässt sich aber nicht halten.[17] Schon Esser selbst meinte, was als Beliebigkeit der Methodenwahl erscheine, sei vor allem „ein schlichter Verzicht auf die von der Justiz geschuldete Auslegungsarbeit ... eine Flucht vor der Verantwortung, die möglicherweise mangels hinreichender Informationsmöglichkeiten und widersprüchlicher Fachmeinungen schwer zu ertragen" sei (Esser 1970: 126).
24
Die Standardmethoden der Auslegung stehen nicht von vornherein miteinander in Konkurrenz, sondern können und müssen alle nebeneinander eingesetzt werden. Die verschiedenen Methoden bringen noch keine Entscheidung, sondern liefern nur Argumente, die in die gleiche oder in eine entgegengesetzte Richtung weisen. Oft konvergieren sie so sehr, dass sie unmittelbar zur Entscheidung führen. Dann ist die semantische Auslegung erfolgreich. Ist das nicht der Fall, so hat die völkerrechtskonforme, europarechtskonforme oder verfassungskonforme Auslegung Vorrang. Bleibt das Ergebnis weiter offen, ist auf einer zweiten Stufe der Auslegung zu entscheiden, welcher Gesichtspunkt das größere Gewicht haben soll. Hier setzen die subjektive und die objektive Theorie unterschiedliche Schwerpunkte. Die subjektive Theorie legt das Gewicht auf Wortlaut und Entstehungsgeschichte der Norm. Sie stellt die Frage nach dem „Willen des Gesetzgebers". Sie erschöpft sich aber nicht in historischer Auslegung; sie will den Willen des historischen Gesetzgebers nicht bloß rekonstruieren. Entscheidend ist, dass sie diesen Willen auch für verbindlich hält. Mit der subjektiven Theorie macht sich der Richter – nach einer Formulierung Philipp Hecks – zum „denkenden Gehilfen" des Gesetzgebers, oder – moderner formuliert – er respektiert die funktionale Arbeitsteilung zwischen Gesetzgeber und Richter. Aus der Sicht ihrer Kritiker verkennt die subjektive Auslegungstheorie die Dynamik der Gesellschaft und verschleiert den schöpferischen Beitrag der Rechtsprechung zur Rechtsentwicklung.
25
Wenn die Standardmethoden unergiebig sind, muss die subjektive Theorie nicht selten mit einem non liquet antworten. Die subjektive Theorie kommt aber auch in Schwierigkeiten, wenn sie zu Ergebnissen gelangt, die sich als unerträglich erweisen, insbesondere weil sich die Verhältnisse geändert haben und die Untätigkeit des Gesetzgebers nicht den Umkehrschluss zulässt, dass er keine Änderung wünscht.
26
Auch die objektive Theorie nutzt zunächst die Standardmethoden, ist jedoch schneller bereit, sich von dem Ergebnis einer historisch-kritischen Auslegung zu verabschieden. Das geschieht durch einen anderen Umgang mit der teleologischen Auslegung. Nach der objektiven Theorie ist die heutige „vernünftige" Bedeutung und Funktion einer Norm maßgebend. Es soll nicht auf den Willen des Gesetzgebers ankommen, sondern auf den Willen des Gesetzes (BVerfGE 34, 288). Das Gesetz ist klüger als der Gesetzgeber.[18] Mit der objektiven Theorie machen sich die Gerichte aus der Sicht ihrer Kritiker von Dienern zu Herren des Gesetzes.
27
Die Zweistufigkeit der Gesetzesauslegung bleibt verborgen, wenn nicht zwischen Auslegungsmethoden und Auslegungstheorie unterschieden wird, insbesondere, wenn die subjektive Theorie mit der subjektiven (=historisch-kritischen) Auslegung und die objektive Theorie mit der teleologischen Auslegung vermengt werden. Auf der ersten Stufe bringen die Standardmethoden jedenfalls im Prinzip nachprüfbare und damit – wenn man so will – objektive Ergebnisse. Die Ergebnisse können sich streng genommen gar nicht widersprechen. Erst auf der zweiten Stufe der Rechtsgewinnung werden die mit Hilfe der Auslegungsmethoden gewonnenen Ergebnisse nach Maßgabe der Auslegungstheorien gegeneinander abgewogen. Dabei können dann weitere Argumente insbesondere rechtspolitischer Art einfließen. Hier ist auch der Ort, an dem die rhetorische Verarbeitung der Argumente ihren Platz hat.
28
Auch die objektive Auslegungstheorie verneint nicht das Postulat der Gesetzesbindung, sondern legt es nur anders aus. Das müsste nicht betont werden, wären nicht durch irritierende Äußerungen eines früheren Präsidenten des BGH, der einer Rechtsprechung „extra legem" das Wort redete und den Richtern bei der Interpretation des Gesetzes die gleiche Freiheit zubilligen wollte wie dem Interpreten eines Kunstwerks, erhebliche Irritationen entstanden.[19]
29
Wenn man Methodenfragen als Verfassungsfragen ansieht, so bedarf es zunächst einer Auslegung eben der Verfassung selbst. Eine historisch-kritische und die systematische Auslegung der Verfassung sprechen eher für eine enge Bindung an das parlamentarische Gesetz[20] und damit für die subjektive Auslegungsmethode. Art. 20 III GG, der wegen der Nebeneinanderstellung von Gesetz und Recht oft für die objektive Theorie angeführt wird, sollte wohl nur ein Notventil für den Fall „gesetzlichen Unrechts" bilden. Am stärksten stützt das Kompetenzargument der systematischen Auslegung eine Präferenz für die subjektive Theorie. Speziell von den Richtern darf man wegen Art. 97 I GG zunächst ein Bekenntnis zur Gesetzesbindung und damit zur subjektiven Auslegung erwarten. Damit wäre das Problem aber nicht gelöst, sondern nur in die subjektive Theorie verlagert, denn grundsätzlich besteht Übereinstimmung darin, dass eine Rechtsfortbildung durch die Gerichte unvermeidbar ist (zuletzt Rüthers 2011: 434). Man kann aus § 132 Abs. 4 GVG auch nicht herauslesen, dass die Rechtsfortbildung den Großen Senaten der oberen Bundesgerichte vorbehalten sei. Sie gehört vielmehr zum Alltagsgeschäft der Justiz.
30
Es spricht deshalb vieles dafür, die Trennlinie zwischen subjektiver und objektiver Theorie als Grenze zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung[21] anzusehen. Dann wäre die objektive Theorie nicht länger eine Auslegungstheorie, sondern eine Theorie zur Rechtsgewinnung nach dem Versagen der Auslegung. Aus dieser Sicht liegt der Grundfehler der objektiven Theorie darin, dass sie den Anschein der bloßen Auslegung aufrecht zu erhalten sucht, wo nichts mehr auszulegen ist (Hegenbarth 1982: 195ff). Zutreffend fordert deshalb Rüthers, dass die objektive Theorie im Interesse der Methodenklarheit nicht als objektiv-teleologische Auslegung antreten, sondern in geeigneten Fällen offen das Geschäft der Rechtsfortbildung betreiben sollte. Allerdings wird das Problem damit nur auf die Frage verlagert, ob der Weg für eine Rechtsfortbildung frei ist. Voraussetzung einer Rechtsfortbildung ist – im weitesten Sinne verstanden – eine Regelungslücke, und die lässt sich nur sich auf der Grundlage der subjektiven Auslegung ausloten.
31
Es bleibt noch die Frage, ob die Standardmethoden auch bei der Rechtsfortbildung helfen. Solche Hilfe ist in erster Linie von der systematischen Auslegung sowie von den „neuen" Methoden der Rechtsvergleichung und der Folgenberücksichtigung zu erwarten.
II. Methoden zur Konkretisierung „weicher" Rechtsnormen
Theorie der juristischen Argumentation
32
Bei „weichen" Rechtsnormen versagt die semantische Auslegung mit Hilfe der handfesteren Standardmethoden. Die Theorie der juristischen Argumentation ist der Versuch, auch für diesen Bereich die Rationalität juristischen Entscheidens zu retten. Eine konsolidierte Theorie juristischer Argumentation gibt es nicht. Das ist wohl der Grund dafür, dass die Argumentationstheorie meistens außerhalb der juristischen Methodenlehre abgehandelt wird.
33
Argumentation ist an sich nichts weiter als „eine geordnete Abfolge von Schritten, in denen zu einem strittigen Thema Gründe genannt werden, die für eine bestimmte Lösung sprechen" (Struck 1977: 9). Für die Rechtswissenschaft hat insbesondere die Diskurstheorie von Jürgen Habermas Bedeutung gewonnen. Ihre juristische Rezeption ist das Verdienst von Robert Alexy. In der „Theorie der juristischen Argumentation", die erstmals 1978 erschien, hat Alexy die allgemeine Diskurstheorie durch die Ausformulierung und Begründung von Regeln, deren Befolgung die Qualität des Konsenses gewährleisten soll, weiter ausgebaut. In einem zweiten Schritt hat er die These begründet, die juristische Diskussion bilde nur einen institutionalisierten Sonderfall des allgemeinen Diskurses.
2) Abwägung als subsidiäre Methode
34
Überall wird vor Entscheidungen „abgewogen", im Privatleben und in der Wirtschaft, in der Politik und bei der Gesetzgebung. Für die Methodenlehre ist nur die Abwägung von Belang, die unterhalb der Gesetzesebene zu konkreten Entscheidungen führen soll. Wenn eine semantische Auslegung nicht zum Ziel führt, wird die Entscheidung mit Hilfe einer Abwägung gewonnen.[22] Ob die Abwägung wirklich nur subsidiären Charakter hat, ist allerdings fraglich. Eine Abwägungsrhetorik ist so verbreitet, dass der Eindruck entstehen kann, „Abwägung" sei zur methodischen Grundoperation der Rechtsprechung geworden.
35
Es gibt zwar zu einzelnen Konstellationen, insbesondere zur prinzipiengeleiteten Abwägung im Verfassungsrecht[23] und zur Abwägung im Planungsrecht,[24] ausführliche Diskussionen. Aber bisher wird die Abwägung kaum als übergreifende eigenständige Methode behandelt.[25] Daher fehlt an einer handlichen Theorie der Abwägung, die mit den „anerkannten" Grundsätzen der (semantischen) Auslegung vergleichbar wäre. Man zweifelt, ob eine solche Theorie überhaupt möglich wäre oder ob „Abwägung" nicht bloß eine metaphorische Verkleidung für nicht legitimierte Entscheidungen sei.[26]
36
Das Grundmodell der Abwägung hat § 34 StGB für den rechtfertigenden Notstand vorgezeichnet. Eine Vorauswahl wird dadurch getroffen, dass die betroffenen Rechte und Interessen Rechtsgütern zugeordnet werden. Zwischen den beteiligten Rechtsgütern besteht regelmäßig schon ein allgemeines Rangverhältnis. Diese Rangfolge ergibt aus der Reihenfolge der Aufzählung in § 34 StGB („Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut") und deutlicher noch aus den unterschiedlichen Strafrahmen. Die normativ vorgegebene Rangordnung ist zwar längst nicht für alle Rechtsgüter so klar. Es können auch dritte Rechtsgüter mitspielen und die Reihenfolge verschieben. Insgesamt gibt das allgemeine Rangverhältnis der Rechtsgüter aber doch einen ersten Anhaltspunkt. Auf der zweiten Stufe wird die quantitativ unterschiedliche Beeinträchtigung der betroffenen Rechte und Interessen berücksichtigt. Das kann zur Folge haben, dass das ranghöhere Rechtsgut, das nur oberflächlich tangiert wird, im konkreten Fall hinter das massiv betroffene, an sich niedrigere Rechtsgut zurücktreten muss. Dem Leben als Rechtsgut kommt insofern eine Sonderrolle zu, als eine quantitative Abwägung zum Schutz der Menschenwürde für ausgeschlossen gehalten wird. Zur Sicherung der Zweckrationalität dient das Effektivitätsgebot und zum Schutz vor Instrumentalisierung der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das Verfahren erlangt besondere Bedeutung, weil es die Betroffenen an der kommunikativen Abarbeitung der Argumente beteiligt.
37
Es gibt viele Beispiele, in denen die Abwägung zu einem überzeugenden Ergebnis findet. Doch oft liegen die Dinge schwieriger als in den Notstandsfällen oder dort, wo die vergleichende Abgrenzung und Bewertung der Interessen durch den Gesetzgeber deutlich zu erkennen ist. Die betroffenen Rechtsgüter lassen sich nicht eindeutig reihen oder das Ausmaß ihrer Beeinträchtigung ist nicht zu vergleichen. In dieser Situation werden alle Argumente zugelassen, die für den juristischen Diskurs erprobt sind.
38
Das Grundproblem besteht darin, dass „Abwägung" im Wortsinne die Gegenüberstellung von quantifizierbaren Größen verlangt, während tatsächlich qualitativ unterschiedliche Positionen zu vergleichen sind. Das Problem der Quantifizierbarkeit beginnt schon damit, dass die empirischen Grundlagen der Entscheidung oft ungewiss bleiben. Insbesondere Prognoseentscheidungen sind regelmäßig Entscheidungen unter Unsicherheit. Schon die Bewertung eines feststehenden Sachverhalts ist regelmäßig schwierig, weil stets mehrere Werte konkurrieren. Bei der Bewertung ungewisser Sachverhalte potenzieren sich die Probleme.[27]
39
Die Darstellung der abzuwägenden Positionen in natürlicher Sprache nimmt der Abwägung viel an Transparenz. Desiderat ist daher eine Übersetzung der normalsprachlichen Beschreibung der Abwägungspositionen und der Maßstäbe in quantifizierende Begriffe, so dass die Abwägung am Ende zu einem Rechenvorgang werden kann.[28] Damit würden die unvermeidlichen Wertungen auf kleine Schritte bei der Operationalisierung mit Hilfe von Indikatoren und Indices verteilt. Man kann sich das etwa so vorstellen wie die im Berichtswesen verbreiteten Scoring-Verfahren. Bei regelmäßig wiederkehrenden Zulassungs- und Verteilungsverfahren ist solches Scoring inzwischen beinahe üblich. Für die individuelle Entscheidungspraxis ist es aber zu aufwändig. Und es trifft wohl auch deshalb auf Widerstände, weil es dem Entscheider die Gesamtbewertung aus der Hand nimmt, so dass er am Ende des Rechenverfahrens auch ein überraschendes Ergebnis hinnehmen muss.
3) Abwägung zur Einzelfallentscheidung und zur Rechtsgewinnung
40
Die Abwägung kann die Gewinnung einer Entscheidungsregel zum Ziel haben oder sie kann wie beim Notstand unmittelbar auf die abschließende Entscheidung eines Einzelfalles gerichtet sein.
41
Eine Einzelfallabwägung im Sinne eines unmittelbaren Nutzen- oder Schadensvergleichs ist rechtlich geboten, wenn in einem Eilverfahren nur eine vorläufige Regelung zu treffen ist, z.B. nach §§ 769 oder 935 ZPO oder § 32 BVerfGG. Hat der geltend gemachte Anspruch Erfolgsaussichten, so werden im Eilverfahren zunächst nur die Vor- und Nachteile eines Zustandes mit und ohne einstweilige Anordnung gegeneinander abgewogen. Einzelfallabwägung ist auch die gesetzlich angeordnete fallbezogene Interessenabwägung: Das Gesetz verlangt in verschiedenen Fällen eine Entscheidung unter „Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen", so z.B. in §§ 314 I 2 und § 626 I BGB für die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund. In diese Gruppe gehört weiter die fallbezogene Abwägung „aller Umstände des Einzelfalls", die das Bundesverfassungsgericht von den Fachgerichten verlangt, soweit Grundrechte betroffen sind. Zur Einzelfallabwägung gerät aber auch ganz allgemein die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, wenn auf die Ausformulierung einer Entscheidungsregel verzichtet wird.
42
Bei der Einzelfallabwägung kommen die Folgen für die Beteiligten eines konkreten Rechtsverhältnisses auf die Waage, also die Mikrofolgen. Die lassen sich im Gerichtsverfahren relativ gut übersehen. Die Einzelfallabwägung ist aber problematisch, weil sie das Prinzip der Rechtsanwendungsgleichheit und mit ihm das Generalisierungsprinzip außer Acht lässt. Wenn eine Entscheidung betont mit einer Einzelfallabwägung begründet wird, so ist an sich niemand gehindert, diese Entscheidung als Präjudiz zu behandeln und aus ihr eine verallgemeinerungsfähige ratio decidendi zu rekonstruieren. Aber die Einzelfallabwägung verzichtet doch auf eine wichtige Argumentationsebene, die sich mit der Frage nach der Verallgemeinerungsfähigkeit der Entscheidung eröffnet.
43
Bei der Abwägung zur Rechtsgewinnung ist eine generalisierte Folgenbetrachtung angezeigt, abgewogen werden also die Makrofolgen. Den prominentesten Bereich für die Abwägung zur Rechtsgewinnung bietet das Verfassungsrecht.[29] Unter dem Einfluss des Bundesverfassungsgerichts wurde die Abwägung zur maßgeblichen Methode bei der Kontrolle von Grundrechtseinschränkungen und im Umgang mit konkurrierenden Grundrechten und Verfassungsgütern. Wegbereitend war eine Formulierung Konrad Hesses, dass es darauf ankomme, die konkurrierenden Verfassungsgüter in „praktische Konkordanz" zu bringen (Hesse 1999: 28). Die Abwägung im Verfassungsrecht zeichnet sich dadurch aus, dass als Maßstab die Grundwerte der Verfassung herangezogen werden und dass neben den individuellen Interessen und Bedürfnissen der Bürger auch Gemeinschaftsgüter von Verfassungsrang berücksichtigt werden müssen.
44
Als Abwägung zur Rechtsgewinnung stellt sich die Folgenberücksichtigung dar: Die Auslegung vollzieht sich in drei Schritten. Im ersten Schritt werden mit den Standardmethoden die in Betracht kommenden Auslegungsvarianten ermittelt. Im zweiten Schritt sind die Realfolgen der in Betracht gezogenen Auslegungsmöglichkeiten festzustellen, und zwar nicht die Mikrofolgen für die Beteiligten eines konkreten Rechtsverhältnisses, sondern die Makrofolgen, wie sie für alle Betroffenen eintreten, wenn der Auslegungsvorschlag zur Norm wird. Es geht dann nicht mehr um Falltatsachen, sondern um Normtatsachen. Im dritten Schritt sind diese Folgen gegeneinander abzuwägen.
45
Auch die Interessenjurisprudenz, wie sie von Philipp Heck ausgearbeitet wurde ist, zielte nicht direkt auf die Lösung von Einzelfällen, sondern suchte mit Hilfe einer generalisierten Ermittlung und Abwägung der Interessen zunächst nach einer Entscheidungsnorm.[30] Die Interessenjurisprudenz ist in zwei Stufen durch die sog. Wertungsjurisprudenz abgelöst worden (näher Larenz1991: 199ff). Auf der ersten, formellen Stufe wurde nur klarer zwischen den subjektiven Interessen der Beteiligten und der Bewertung dieser Interessen durch den Gesetzgeber unterschieden. Es blieb bei der Grundannahme Hecks, dass es darauf ankomme, die Wertungen des Gesetzgebers als Maßstab für die konfligierenden Interessen heranzuziehen. Auf der zweiten Stufe wurden die gesetzlichen Wertungen durch allgemeinere Zielsetzungen oder gar objektive Werte ergänzt. Als theoretischer Rahmen dienten anfangs vor allem Essers „Grundsatz und Norm" (Esser 1990) und Wilburgs „Bewegliches System" (Wilburg 1950). Heute werden auch die Prinzipientheorien von Dworkin und Alexy herangezogen. Als Abwägungsmaßstab steht dann eine Menge beweglicher Elemente zur Verfügung, die jeweils im konkreten Fall in eine transitive Ordnung gebracht werden müssen.
46
Die alte Interessenjurisprudenz hatte Struktur, konnte aber damit kaum Probleme lösen, die nicht schon im Gesetz vorentschieden waren. Die Wertungsjurisprudenz dagegen nimmt für sich in Anspruch, alle Probleme zu lösen. Ihr fehlt aber die Struktur. Die Prinzipientheorien versuchen, beides zu verbinden, sind damit aber auch nicht so erfolgreich, dass sie eine handliche Anleitung zur Rechtsgewinnung geben könnten. Es klingt zwar verheißungsvoll, wenn Alexy ein erstes und ein zweites Abwägungsgesetz anbietet. Aber die „Formeln" sind keine Formeln, sondern nur elaborierte Formulierungen für den schwierigen Umgang mit Wertungen. Am Ende jeder Abwägung steht ein Werturteil.
4) Entscheidungsregeln und Relevanzregeln
47
Die juristische Methodenlehre baut auf den Grundsatz, dass jede konkrete Entscheidung sich als Ableitung aus einer Rechtsnorm darstellen lassen muss. Dieser Grundsatz gilt für Gerichtsurteile ebenso wie für Verwaltungsakte. Für Verwaltungsakte gibt es jedoch eine Ausnahme für unbestimmte Rechtsbegriffe, mit denen der Verwaltung ein Ermessens- oder Beurteilungsspielraum eingeräumt wird. Der Grund für diese Ausnahme liegt darin, dass bei sehr komplexen Sachverhalten so viele Umstände relevant sein können, dass sich keine Entscheidungsregel mehr angeben lässt. Die Bedeutung unbestimmter Rechtsbegriffe kann „wegen hoher Komplexität oder besonderer Dynamik der geregelten Materie so vage und ihre Konkretisierung im Nachvollzug der Verwaltungsentscheidung so schwierig sein, daß die gerichtliche Kontrolle an die Funktionsgrenzen der Rechtsprechung stößt. Der rechtsanwendenden Behörde mag in solchen Fällen ohne Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze ein Entscheidungsfreiraum zuzubilligen sein." (BVerfGE 84, 34) Diese Ausnahme von der Regelorientierung, die das Bundesverfassungsgericht den Verwaltungsbehörden zubilligt, nimmt es auch für die Justiz in Anspruch, wenn es die Fachgerichte immer wieder auffordert, bei einer Entscheidung, die die Grundrechte der Beteiligten tangiert, alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Dann hängt die Entscheidung von den abstrakt nicht vollständig angebbaren Umständen ab.
48
Zur Rechtfertigung des Verzichts auf die Ausformulierung einer Entscheidungsregel dient der Gedanke der Überkomplexität des Falles. Das theoretische Problem stellt sich mit der der Frage, woran man solche Fälle erkennt. Klare Maßstäbe fehlen hier, obwohl nicht selten Komplexität behauptet wird, um daraus Folgerungen auch für die Methodenlehre abzuleiten.[31] Daher haben die Gerichte es in der Hand, wie weit sie abstrahieren, ob sie also von einer Regel ausgehen wollen, oder sich auf eine Einzelfallabwägung zurückziehen.
5) Abwägungsregeln
49
Zur praktischen brauchbaren Methode wird die Abwägung dadurch, dass sie die fehlende Entscheidungsregel durch Relevanzregeln ersetzt, welche eine Entscheidung vorbereiten (Neumann 1988: 398ff).[32] Wie die Gerichte vorzugehen haben, wenn sie selbst für die Abwägung zuständig sind, lässt sich zum Teil indirekt aus der Ermessensfehlerlehre und aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Abwägungskontrolle im Bauplanungsrecht entnehmen. Die Bedeutung der Ermessensfehlerlehre liegt auf der Hand, weil sie gerade für den Fall entwickelt worden ist, dass der Verwaltung eine Letztentscheidungskompetenz eingeräumt wird. Das Planungsrecht ist von Interesse, weil die Verwaltung bei der Bau- und Infrastrukturplanung über eine weitgehende Gestaltungsfreiheit verfügt. Als Ausgleich dafür ist z.B. für das Bauplanungsrecht durch § 1 VII BauGB angeordnet, dass die Behörde ihre Entscheidung erst nach einer umfassenden Abwägung treffen darf. Danach lassen sich die Relevanzregeln ganz grob wie folgt zusammenfassen:
50
-
Prozeduralisierung i. e. S.: Die Vorkehrungen des einschlägigen Gerichtsverfahrens (Beteiligungen, Anhörungen, Beweisverfahren und Verhandlungsmodalitäten) sind zu beachten.
-
Prozeduralisierung i. w. S.: Je nach Materie ist ein Angebot von Argumenten abzuarbeiten.
-
Selbstverständlich ist eine sorgfältige Ermittlung des Sachverhalts.
-
Mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden sind die Ziele des Gesetzes und die danach in Betracht kommenden Entscheidungsalternativen zu bestimmen.
-
Die konkurrierenden Interessen sind zu ermitteln. Werden nicht alle Belange in die Abwägung eingestellt, die nach Lage der Dinge berücksichtigt werden müssen, so liegt ein Abwägungsdefizit vor.
-
Abwägungsverbote sind zu beachten. Das wichtigste ergibt sich unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde aus dem Verfassungsrecht. Sie finden sich aber auch im einfachen Recht, so z.B. bei der Notwehr.
-
Die Bedeutung der relevanten Belange muss gewürdigt werden.
-
Die unterschiedlichen Interessen müssen in einer Weise berücksichtigt werden, die zu ihrem Gewicht im Verhältnis steht. Hier vollzieht sich die eigentliche Abwägung.
-
Die danach in Betracht gezogene Alternative ist nach Effektivität und Verhältnismäßigkeit zu beurteilen.
-
Die Entscheidung ist zu begründen.
51
Auf diese Weise kann die Entscheidung, die am Ende der Abwägung steht, zwar nicht zwingend abgeleitet, aber durch Verfahren und Gründe verbessert werden. Letztlich wird das Urteil aus Kompetenz getroffen. So kann man jedenfalls die verantwortlichen Personen benennen und kritisieren.
6) Die typologische Methode
52
Die Grundform der meisten Rechtsnormen entspricht der logischen Figur der Implikation: wenn T(atbestand), dann R(echtsfolge). T und R werden dabei als Klassenbegriffe gedacht. Nicht ganz selten enthalten Rechtsnormen aber entweder auf der Tatbestandsseite oder auf der Rechtsfolgenseite oder gar auf beiden Seiten komparative Begriffe. Ein Beispiel gibt § 254 Abs. 1 BGB. Das wird deutlicher, wenn man den Gesetzeswortlaut umformuliert: Je größer das Mitverschulden, umso niedriger ist der Anspruch auf Schadensersatz. Für die Anwendung muss eine solche Norm auf eine Individualnorm reduziert werden, die nur noch klassifizierende oder, falls die Rechtsfolge abstufbar ist, auch quantifizierbare Begriffe enthält. Der Übergang von komparativen zu klassifizierenden oder quantitativen Begriffen lässt sich, wenn keine Präjudizien zur Verfügung stehen, nur durch Abwägung und damit durch freie Argumentation erreichen.[33]
53
Auch Tatbestandsmerkmale, die auf den ersten Blick als semantisch interpretierbare Klassenbegriffe erscheinen, werden oft im Wege der Auslegung in komparative Begriffe verwandelt. Sie werden nicht mehr scharf definiert. Man akzeptiert vielmehr ihre relative Unbestimmtheit mit der Folge, dass das Merkmal nicht im Sinne eines Entweder-Oder vorliegt oder fehlt, sondern nur im Sinne eines Mehr-oder-Weniger mit dem Sachverhalt korrespondiert.
54
Als Beispiel mag der Begriff des Arbeitnehmers dienen, von dessen richtiger Handhabung im Einzelfall die Anwendbarkeit des ganzen Arbeitsrechts, des Sozialversicherungsrechts und von Teilen des Steuerrechts abhängt. Was heute „Normalarbeitsverhältnis" genannt wird, weil es nicht mehr normal ist, war vor dreißig Jahren noch selbstverständlich. Damals gab es selten Probleme, eine Person als Arbeitnehmer oder Selbständigen zu qualifizieren. Unter dem Druck von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen und den Zwängen des Arbeitsrechts haben jedoch die Unternehmer Aufgaben, die bis dahin von „Arbeitnehmern" wahrgenommen wurden, mehr und mehr auf Selbständige oder – das ist die Frage – auf Scheinselbständige verlagert. Daher kann man heute in vielen Fällen nicht mehr schlicht unter den Begriff des Arbeitnehmers subsumieren, wie er z.B. in § 622 BGB, §§ 24 ff SGB III, § 150 SGB VII oder § 38 EStG verwendet wird. Man kann nur noch eine Reihe typischer Merkmale aufzählen, bei jedem Merkmal prüfen, bis zu welchem Grade es erfüllt ist, und am Ende im Wege einer Gesamtbetrachtung (Abwägung) zu einem Schluss kommen. Als normative Anknüpfung dient § 84 I 2 HGB. Die Vorschrift grenzt den selbständigen vom angestellten Handelsvertreter ab. Danach ist selbständig, „wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann". Positivmerkmale des Arbeitnehmers wären etwa Eingliederung in einen Betrieb, Zeitbestimmtheit und Weisungsgebundenheit der Tätigkeit, finanzielle Abhängigkeit von einem einzigen Auftraggeber, Negativmerkmale eigener Kapitaleinsatz und eine eigene Betriebsstätte. Keines dieser Merkmale ist allein ausschlaggebend, keines ist unverzichtbar. Man spricht deshalb von „Indizien" und einer „typologischen Methode". Eine stärkere Ausprägung eines Merkmals kann bis zu einem gewissen Grade die Schwäche oder gar das Fehlen eines anderen kompensieren. Wichtig ist, dass alle relevanten Merkmale geprüft werden. Für die am Ende notwendige Gesamtbewertung „der Eigenart der Tätigkeit" gibt es keinen eigenen Maßstab mehr.[34]
55
Larenz (1991: 443ff) und sein Schüler Leenen (1971) haben diese Art des Umgangs mit gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen als Arbeit mit Typenbegriffen gerechtfertigt. Das Bundesverfassungsgericht hat die „typologische Methode" gebilligt.[35] Streitig ist noch, ob die typologische Methode einen Tatbestand derart in Bewegung bringen kann, dass die Übererfüllung eines Tatbestandsmerkmals ein anderes ganz entfallen lässt (sog. Sandhaufen-Theorem; vgl. BGHZ 80, 153/159 gegen OLG Stuttgart NJW 1979, 2409).
56
Kritiker der Typenlehre (Kuhlen 1977; Kindhäuser 1981) bestreiten den scharfen Gegensatz zwischen Begriff und Typus. Sie verweisen auf komparative und quantitative Begriffe, die einen Vergleich im Sinne eines „Mehr oder Weniger" zulassen. Doch ihre Begriffsarbeit kann das Ausgangsproblem nicht lösen, weil komparative Begriffe früher oder später eine Quantifizierung verlangen.
Recht im Kontext
I. Zur Relevanz von Kontextwissen
57
„Wie halten Sie es mit den Sozialwissenschaften" war nach 1968 die „Gretchenfrage" der Jurisprudenz (Hopt 1975). Heute besteht in der Rechtstheorie weitgehend Übereinstimmung, dass die Jurisprudenz sich anderen Disziplinen gegenüber öffnen muss. Mit „Law in Context" gibt es eine neue Formel für Interdisziplinarität, für die politischen, sozialen, wirtschaftlichen, technischen oder internationalen Bezüge des Rechts. Aber in der Sache sind die Fortschritte gering.
58
Auf der forensischen Ebene, also wenn es um den Beweis der Tatsachen geht, die den Tatbestand der in Betracht gezogenen Normen ausfüllen sollen, haben Juristen und Gerichte jedenfalls grundsätzlich keine Probleme, sich die Ergebnisse anderer Wissenschaften nutzbar zu machen. Soweit die Ergebnisse nicht bereits den Charakter allgemein anerkannter und bekannter Erfahrungssätze haben, können Sachverständige bestellt werden, die das Gericht informieren.
59
Auch durch so genannte Verweisungsbegriffe wird die Frage nach tatsächlichen Umständen im Umkreis des Falles zur Beweisfrage. Früher nannte man als Beispiele Verkehrssitte und Handelsbrauch. Neuere Beispiele bilden die Unterscheidungskraft einer Marke oder die diskriminierende Wirkung bestimmter Sachverhalte oder Regelungen. Solche Verweisungsbegriffe machen den relevanten Wirklichkeitsausschnitt zur Falltatsache, über die Beweis erhoben werden kann und muss. Hierher gehören auch die fallbezogenen Prognosen, wie sie etwa die §§ 46 Abs. 1 S. 2, § 56 StGB den Gerichten aufgeben. Das alles bleibt im Bereich der Rechtsanwendung.
60
Auslegung ist immer kontextabhängig. Unvermeidlich arbeitet die Jurisprudenz mit Vorstellungen über die soziale Wirklichkeit. Der Gesetzgeber hatte Vorstellungen über die gesellschaftlichen Zustände, die er mit seinen Gesetzen beeinflussen wollte. Jede einzelne Norm trifft auf einen Ausschnitt aus der Realität. Auslegung verlangt deshalb nach Kenntnissen über den Regelungsbereich des Rechts, über die Arbeitswelt, über familiale Beziehungen, Wohnverhältnisse, Lebensverhältnisse von Immigranten und Asylanten, über moderne Medien und Umweltprobleme und nicht zuletzt über Kriminalität und Wirtschaft. Die Liste lässt sich leicht verlängern. Bei jeder Begriffsbestimmung wirkt im Hintergrund eine Idee vom Wesen des Gegenstandes. Das tritt besonders bei der typologischen Methode zu Tage. Das Wissen über die Wirklichkeit ist für die Rechtsgewinnung mehr oder weniger überall relevant. Aber diese pauschale Aussage hilft der Methodenlehre nicht weiter. Immerhin sind einige Spezifizierungen möglich.
61
Die semantische Auslegung verlangt in Zweifelsfällen nach einer historisch-kritischen Analyse der Entstehung einschlägiger Normtexte. Wiewohl dabei Historiker prinzipiell hilfreich sein könnten, sehen Juristen den Umgang mit der Rechtsgeschichte noch immer als ihre eigene Domäne an. Erst recht die systematische Auslegung ist das ureigene Geschäft der Jurisprudenz. Anknüpfungsstellen für Kontextwissen bietet daher in erster Linie die teleologische Auslegung.
62
Die teleologische Auslegung vollzieht sich in zwei Schritten. Im ersten Schritt ist der Normzweck zu bestimmen. Normzweck kann immer nur die Erhaltung oder Veränderung eines bestimmten Zustands der Gesellschaft sein. Führt die semantische Auslegung bei der Bestimmung des Normzwecks zu keinem Ergebnis, so muss der Interpret sich selbst ein Bild vom Zustand der Gesellschaft machen, um dann Vorstellungen zu entwickeln, ob dieser Zustand bewahrt oder verändert werden soll. Im zweiten Schritt der teleologischen Auslegung geht es darum, bei gegebenem Gesetzeszweck geeignete Mittel zu seiner Realisierung zu finden. Ein Beispiel gibt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Rauchverbot (Urteil vom 30. 7. 2008, www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080730_1bvr326207.html). Hier liegt der Wissensbedarf auf der Hand.[36] Damit könnte die teleologische Auslegung zum Einfallstor für die Aufnahme von Kontextwissen werden. Es fehlen jedoch methodische Anweisungen, wie dabei zu verfahren ist. In der Praxis können die Gerichte ihre Annahmen über die soziale Wirklichkeit nicht ausblenden. Aber sie machen diese Annahmen kaum explizit und unternehmen schon gar nicht den Versuch, sie in einer wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Weise zu belegen.
II. Falltatsachen und Normtatsachen
63
Im Schrifttum wird besonders die Folgenorientierung als Methode zur Berücksichtigung fremddisziplinären Wissens empfohlen.[37] Unter diesem Titel werden Abwägungen auf der Grundlage generalisierter Folgenbetrachtungen gefordert. Die Generalisierung geht in beide Richtungen, die der Regelutilitarismus mit dem Abstraktionsprinzip und dem Grundsatz der Verallgemeinerung vorgibt: Welches sind im Allgemeinen die Folgen des mit der Normhypothese in Betracht gezogenen Verhaltens? Welche Folgen würden eintreten, wenn sich alle Adressaten im Sinne der Normhypothese verhielten?
64
Am Beispiel der Folgenorientierung zeigt sich das Grundproblem der Aufnahme von Kontextwissen besonders deutlich. Eine vertiefte Folgendiskussion ist eigentlich Sache des Gesetzgebers. Hier geht es jedoch um Rechtsgewinnung de lege lata. Die Sachverhalte, die dabei in den Blick kommen, kann man Normtatsachen nennen, im Gegensatz zu den Falltatsachen, die gewöhnlich Gegenstand der Beweisaufnahme sind. Es geht, in den Begriffen des Revisionsrechts gesprochen, nicht mehr um die Tatfrage, sondern um die Rechtsfrage. Damit entfällt die Anwendbarkeit des Beweisrechts.[38] Das hat Luhmann (1969) vollkommen richtig gesehen: Sozialforschung ist nicht die Aufgabe der Gerichte. Dafür sind die technisch und organisatorisch nicht gerüstet.[39] Außerdem, so meinte er, könnten die Gerichte die Verantwortung für die Aufklärung der Normtatsachen nicht übernehmen, ohne ihre Legitimation zu verlieren.
65
Praktisch ließen sich die Möglichkeiten empirischer Wissenschaft durch die Beiziehung von Sachverständigen nutzen. Aber wo sollen die Fragen an den Experten anfangen, wo aufhören? Geschieht der Einsatz von Experten nach dem Opportunitätsprinzip oder ist er obligatorisch? Wer trägt die Kosten? Das Bundesverfassungsgericht hat mit solchen Fragen keine Probleme, da jedes einzelne Verfahren große präjudizielle Bedeutung hat und die technische Frage der Kosten dadurch geregelt ist, dass nach § 36 BVerfGG keine Kosten erhoben werden. Es macht daher, wenn auch nicht systematisch, zur Aufhellung der Rechtswirklichkeit von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen Gebrauch.[40] Für die Fachgerichte ist das Bundesverfassungsgericht insoweit kein Vorbild. Der Aufwand an Zeit und Kosten, den der Beweis von Normtatsachen mit sich bringt, ist erheblich. Er würde die Prozesse unerträglich verlängern, verteuern und verkomplizieren. Mit einer kritischen Diskussion der Normtatsachen wären die Gerichte überfordert. Daher sperrt sich die Methodenlehre, den sozialen Kontext eines Falles explizit aufzunehmen, denn das setzte voraus, dass die Wissensquellen nachprüfbar angegeben und zum Thema juristischer Verfahren gemacht werden könnten.
66
Dieser Engpass könnte bis zu einem gewissen Grade mit Hilfe der modernen Informationsmedien umgangen werden. Katsh hat schon 1989 in seinem Buch über „The Electronic Media and the Transformation of Law" vorhergesagt, die Flexibilisierung der Wissensbestände durch die elektronischen Medien werde die Disziplingrenzen, die lange durch die gedruckte Rechtsliteratur stabilisiert worden seien, unterminieren. Elektronischen Medien, die unterschiedslos Informationen aus allen Wissens- und Lebensgebieten vereinigten, seien auf Interdisziplinarität angelegt und würden das Recht stärker für Einflüsse aus dem sozialen Kontext öffnen. Knauer (2009) hat darauf hingewiesen, dass die Digitalisierung der Information Einfluss auch auf die juristische Methodenlehre haben werde. So werde die leichte Verfügbarkeit der Gesetzesmaterialien im Internet die historische Auslegung stärken.[41] Sie werde zu einem schärferen Blick auf den Gesetzeszweck verhelfen und damit auch die teleologische Auslegung befördern. Dabei könnten neben den Gesetzesmaterialien „auch andere im Internet publizierte Informationen für die teleologische Auslegung herangezogen werden. In Betracht [kämen] beispielsweise behördliche oder andere statistische Daten". Zu denken ist dabei insbesondere an die vielen „Berichte", die von öffentlichen und privaten Institutionen erstellt und publiziert werden.[42]
67
Aber das ist eher Zukunftsmusik. Aktuell gilt immer noch, dass empirische oder Kontextargumente bei der Rechtsgewinnung nur verdeckt (als „Schmuggelware"[43]) einfließen. Sie verstecken sich in dem langen Katalog der Rechtsgüter, die zur Bezeichnung des Gesetzeszwecks dienen können (Sicherheit, Ordnung, Rechtssicherheit, Verkehrssicherheit, Produktsicherheit, Effizienz der Aufgabenerfüllung, Prozessökonomie, Gemeinwohl, Wohl der Familie, Wohl der Kinder, Prävention aller Art, Verbraucherschutz, Datenschutz usw. usw.). Diese sind im juristischen Diskurs so geläufig, dass es keiner besonderen Begründung bedarf, um sich im konkreten Fall auf eines oder mehrere davon zu berufen. So wird im Normalfall das Kontextwissen nicht ausgewiesen, sondern bei der Berufung auf ein Rechtsgut implizit als selbstverständlich vorausgesetzt.
III. Alltagstheorien und Berufserfahrung
68
Hier setzte vor bald 50 Jahren die sozialwissenschaftliche Kritik ein, die geltend machte, das für selbstverständlich gehaltene Wissen sei oft nicht nur fehlerhaft, sondern vor allem auch vorurteilsbehaftet. Diese Kritik machte sich an den so genannten Alltagstheorien fest. Alltagstheorien sind heute bis zu einem gewissen Grade rehabilitiert (Ogorek 2008). Die allgemeine soziologische Aufklärung hat im Publikum und auch unter Juristen kritische Aufmerksamkeit für Stereotype und Vorurteile geschärft. In der juristischen Rhetorik wird die Argumentation mit dem, was »offenkundig, evident, plausibel, einleuchtend oder selbstverständlich« ist, grundsätzlich geschätzt (Sobota 1990: 128ff). Die Orientierung gerade auch der Methodenkritik am Holismus hat schließlich ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass alles soziale Handeln auf einer Basis des Selbstverständlichen aufruhen muss.
69
Neben die Alltagstheorien tritt das im Zuge der Professionalisierung erworbene Wissen der Juristen. Die Rechtswirklichkeit drängt sich der juristischen Praxis in dem in Rechtsprechung in Schrifttum ausgebreiteten Fallmaterial auf. Es geht um die Fälle, mit denen Anwälte und Richter tagtäglich konfrontiert sind. Jeder Jurist begegnet ihnen zu Hunderten und zu Tausenden. Sieht man auf Gericht und Anwaltschaft als Institution, sind es Millionen. Das sind keine bloßen Zahlen in der Statistik, sondern die Mehrzahl dieser Fälle wird sorgfältig aufbereitet. Die empirische Sozialforschung hat es schwer, der Fülle des Materials, das von Gerichten und Juristen mit großem Aufwand recherchiert, publiziert und regelmäßig auch diskutiert wird, etwas entgegenzusetzen. So ist und bleibt die Berufspraxis eine wichtige Schnittstelle zum sozialen Kontext. Sozialwissenschaftler distanzieren sich von der Vorstellung einer Selbstaufklärung der Jurisprudenz durch Erfahrung, indem sie das in der Berufspraxis erworbene Wissen als deformiert zurückweisen. Aber sie können zur Korrektur nur punktuell wissenschaftlich aufbereitetes Material anbieten, und selbst, wo solches vorhanden ist, gibt es kaum eindeutige Ergebnisse, sondern meistens konkurrierende Theorieangebote. Eine laufende Kontrolle von Alltagstheorien und Berufserfahrung ist nicht möglich. Sensibilisierung für den historischen und sozialen Kontext des Rechts in der juristischen Ausbildung, fortlaufende Reflexion während der Berufspraxis und punktuelle Vergewisserung müssen als Ersatz ausreichen.
IV. Rezepte der postmodernen Rechtstheorie
70
Die Tendenz der postmodernen Rechtstheorie geht dahin, den Gerichten hinsichtlich der Normtatsachen eine größere Freiheit bei der Informationssammlung zuzubilligen. In diesem Sinne meint Ladeur (2000:80): „Das Recht hat immer nur einen selektiven Zugriff auf die ›Wirklichkeit‹ genommen, daran kann und muss sich auch in Zukunft nichts ändern. Entscheidend ist nur, ob die gewählten Selektionskriterien ihrerseits noch angemessen sind." Er verneint seine Frage, da der gesellschaftliche Wandel durch Tempo und Komplexität zu einer »Abschwächung der Erfahrung als Wissensbasis für die Praxis der Akteure wie für das institutionalisierte Rechtssystem selbst geführt« habe.[44] Ladeur schärft den eigenen Blick mit Hilfe von Hayeks und der Institutionenökonomie und sieht so eine dynamisch sich selbst verändernde und organisierende Gesellschaft. Erfahrungen und Wissensbestände seien an Netzwerke gebunden. Es komme deshalb darauf an, das in den Netzwerken gespeicherte Wissen zu nutzen. „Die Koordinationseffekte, die über ein verteiltes Netz von Beziehungen, Eigentumsrechten, Verträgen, dauerhaften Geschäftsbeziehungen, Handelsbräuchen, inter- und intraorganisationalen Konventionen etc. generiert werden, bilden ein ›Sozialkapital‹ von Anknüpfungsmöglichkeiten und der Erwartungsbildung, das in hohem Maße positive Externalitäten für andere erzeugt." (Ladeur 2000: 79) Damit wiederholt er, ähnlich wie Teubner, unter den Bedingungen der Globalisierung und mit zeitgemäßem theoretischem Vokabular in gewisser Weise die Beobachtungen Eugen Ehrlichs. Und er folgt auch in seinen Empfehlungen für die Rechtsgewinnung durch das Richtersubjekt Eugen Ehrlich, indem er dazu ermutigt, bei der Rechtsgewinnung die durch gesellschaftliche Selbstregulierung geschaffen „positiven Externalitäten" zu nutzen. Auch von Vesting (2007: Rn 241) werden die Gerichte aufgefordert „sich auf die dynamische Stabilität der gemeinsamen Wissensbestände der modernen bzw. postmodernen Gesellschaft" einzustellen. Wo diese in gerichtsverwertbarer Form zu finden sind, bleibt allerdings offen, es sei denn man akzeptiert Vestings Hinweise „auf die gestiegene Bedeutung der laufenden Produktion privater Regelbildung in Form Allgemeiner Geschäftsbedingungen, Standardisierungen und ähnlicher Normierungen z. B. in Wirtschaftsunternehmen, privaten Verbänden, Krankenhäusern, Schulen, oder Universitäten für das Recht".
71
Sieht man einmal davon ab, dass Ladeur und Vesting die Lernfähigkeit der juristischen Praxis unterschätzen dürften, fällt die von ihnen angebotene Alternative aus der Methodenlehre heraus. Sie besteht in der Empfehlung, in stärkerem Maße auf das Selbstorganisationsvermögen der (Privat-)Rechtssubjekte zu vertrauen. Das wäre ein Rückfall auf das „selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft" und Verbände.[45] Darüber mag man diskutieren. Insoweit geht es nicht mehr um die juristische Methode, sondern materielle Bewertungsmaßstäbe, wie sie unter dem Gesichtspunkt der Privatautonomie erörtert werden. Den Gerichten ist es zwar nicht untersagt, selbst neue Wertmaßstäbe zu entwickeln. In der Regel werden sie jedoch durch die Dogmatik vorbereitet.
72
Methodenfreiheit wird angesagt, indem Ladeur die Rechtsanwendung zum Versuchslabor erklärt: „Der Rechtsanwender wird zum experimentierenden Beobachter, Fakten, Subjekt und Norm verweisen im generativen Projekt der Autokatalyse aufeinander." (1988: 236) Er empfiehlt der Rechtsprechung, „tentativ durch Ausprobieren von neuen Zurechnungen zu operieren, ohne daß die Wirkungen angesichts des strategischen Handlungspotentials der Akteure und der dadurch erzeugten Folgen genau abgeschätzt werden können". Ex post mag es dem Beobachter so erscheinen, als ob die Rechtsprechung sich über Versuch und Irrtum einer brauchbaren Lösung nähert. Im konkreten Fall kann man sich jedoch schwer vorstellen, dass Richter sich überlegen, sie könnten mit der Partei XY einmal ausprobieren, ob eine bestimmte Lösung sich bewährt. Es hilft der Rechtsprechung auch überhaupt nicht, wenn die Rechtstheorie ihr erklärt, jedes Urteil sei ein kleiner Schritt auf dem Wege der Evolution des Rechts. So wenig wie Eltern, die ein Wunschkind zeugen, dabei an der Evolution des Menschengeschlechts mitwirken wollen, können Gerichte die Absicht verfolgen, mit konkreten Urteilen die Evolution des Rechts zu befördern.
73
Die Interdisziplinaritätsfrage ist allein über die Methodenlehre nicht zu lösen. Aber es gibt Interdisziplinarität jenseits der juristischen Methode. Der Wissensimport funktioniert auf Umwegen. Es zeigt sich, dass Themen, die von der Rechtssoziologie behandelt werden, mit einigem zeitlichen Abstand in der Gesetzgebung und auch in der Rechtsdogmatik auftauchen. Das gilt etwa für die Problemkreise Zugang zum Recht, strukturelle Ungleichheit und Diskriminierungen beim Vertragsschluss, für alternative Konfliktregelung oder für neue Familienformen und veränderte Konzepte geschlechtlicher Identität. Als Wissenschaft ist die Jurisprudenz durch keine Gehörsanforderungen und Beweisregeln gehindert, fremddisziplinäres Wissen aufzunehmen.
Bibliographie
Axel Adrian, Grundprobleme einer juristischen (gemeinschaftsrechtlichen) Methodenlehre, Die begrifflichen und ("fuzzy"-)logischen Grenzen der Befugnisnormen zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und die Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, Berlin 2009
Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation (1978), Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung ; Nachwort (1991): Antwort auf einige Kritiker, 6. Aufl., Frankfurt am Main 2008
Joachim Arntz/Hans-Peter Haferkamp/Margit Szöllösi-Janze, Justiz im Nationalsozialismus, Positionen und Perspektiven, Hamburg 2006
Anthony Arnull, The European Union and its Court of Justice, 2. ed., Oxford 2006
Ino Augsberg, Das Gespinst des Rechts. Zur Relevanz von Netzwerkmodellen im juristischen Diskurs, Rechtstheorie 38 , 2007, 479-493.
Carsten Bäcker, Begründen und Entscheiden, Kritik und Rekonstruktion der Alexyschen Diskurstheorie des Rechts, Baden-Baden 2008
Rolf Bender, Das „Sandhaufentheorem", Ein Beitrag zur Regelungstechnik in der Gesetzgebungslehre, in: U. Klug (Hg.), Gesetzgebungstheorie, juristische Logik, Zivil- und Prozessrecht, Gedachtnisschrift für Jürgen Rödig, Berlin 1978, S. 34-xxx.
Stefan Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, Funktion - Position - Methodik, Frankfurt am Main 1999
Wolfgang Buerstedde, Juristische Methodik des Europäischen Gemeinschaftsrechts, Ein Leitfaden, Baden-Baden 2006
Dietrich Busse, Zum Regelcharakter von Normtextbedeutungen und Rechtsnormen, Was leistet Wittgensteins Regelbegriff in einer anwendungsbezogenen Semantik für das Interpretationsproblem der juristischen Methodenlehre?, Rechtstheorie 19 , 1988, 305-322.
Dietrich Busse, Recht als Text, Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution, Tübingen 1992
Dietrich Busse, Ist die Anwendung von Rechtstexten ein Fall von Kommunikation?, Rechtslinguistische Überlegungen zur Institutionalität der Arbeit mit Texten im Recht., in: Kent D. Lerch (Hg.), Recht vermitteln, Strukturen, Formen und Medien der Kommunikation im Recht, Bd. 3, Berlin 2005, S. 23-53.
Richard M. Buxbaum, Is „Network" a Legal Concept, Jounal for Institutional and Theoretical Economics (JITE) 149 , 1993, 698-705.
Franz Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl., Wien , New York 1991
Claus-Wilhelm Canaris/Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtwissenschaft, 4. Aufl., Berlin 2006
Ralph Christensen, Was heißt Gesetzesbindung?, Eine rechtslinguistische Untersuchung, Berlin 1989
Ralph Christensen/Andreas Fischer-Lescano, Das Ganze des Rechts, Vom hierarchischen zum reflexiven Verständnis deutscher und europäischer Grundrechte, Berlin 2007
Ralph Christensen/Hans Kudlich, Theorie richterlichen Begründens, Berlin 2001
Ralph Christensen/Hans Kudlich, Gesetzesbindung, Vom vertikalen zum horizontalen Verständnis, Berlin 2008
Helmut Coing, Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik, Köln 1959
Martina R. Deckert, Die folgenorientierte Auslegung, JuS , 1995, 480-484.
Mary Douglas, Wie Institutionen denken, Frankfurt am Main 1991
Gunnar Duttge, Zum typologischen Denken im Strafrecht, Ein Beitrag zur „Wiederbelebung" der juristischen Methodenlehre, Jahrbuch für Recht und Ethik 11 , 2003, 103-126.
Ronald Dworkin, Bürgerrechte ernst genommem, Frankfurt am Main 1984 (Taking Rights Seriously, 1977)
Eugen Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, München 1913
Karl Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, Heidelberg 1943
Karl Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, 1953, 2. Aufl., Heidelberg 1968
Josef Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Rationalitätsgrundlagen richterlicher Entscheidungspraxis, 2. Aufl., Kronsberg/Ts. 1972
Josef Esser, Bemerkungen zur Unentbehrlichkeit des juristischen Handwerkszeugs, Juristenzeitung 1975, 555-558.
Josef Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts (1956), Rechtsvergleichende Beiträge zur Rechtsquellen- und Interpretationslehre, 4., unveränderte Aufl., Tübingen 1990
Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, 5 Bde., Tübingen 1975-1977
Christian Fischer, Topoi verdeckter Rechtsfortbildungen im Zivilrecht, Tübingen 2007
Andreas Fischer-Lescano/Ralph Christensen, Auctoritatis Interpositio. Die Dekonstruktion des Dezisionismus durch die Systemtheorie, Der Staat 44 , 2005, 213-242.
Stanley Eugene Fish, Is There a Text in This Class?, The Authority of Interpretive Communities, Cambridge Mass. 1980
Stanley Eugene Fish, Doing What Comes Naturally, Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies, Oxford 1989
Axel Flessner, Juristische Methode und europäisches Recht, Juristenzeitung , 2002, 14-23.
Stephan M. Grundmann, Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts durch den Europäischen Gerichtshof, Zugleich eine rechtsvergleichende Studie zur Auslegung im Völkerrecht und im Gemeinschaftsrecht, Konstanz 1997
Susan Haack, Manifesto of a Passionate Moderate, Unfashionable Essays, Chicago 1998
Peter Häberle, Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, Juristenzeitung , 1975, 297-305.
Peter Häberle, Grundrechtsgestaltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat – zugleich zur Rechtsvergleichung als „fünfter" Auslegungsmethode, Juristenzeitung , 1989, 913-919.
Hans-Peter Haferkamp, Georg Friedrich Puchta und die "Begriffsjurisprudenz", Frankfurt am Main 2004
Günter Hager, Rechtsmethoden in Europa, Tübingen 2009
H. L. A. Hart, Der Begriff des Rechts, [The Concept of Law, 1961], Frankfurt am Main 1973
Winfried Hassemer, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, in: Winfried Hassemer (Hg.), Erscheinungsformen des modernen Rechts, Bd. 26, Frankfurt am Main 2007, S. 119-151.
Winfried Hassemer, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, Rechtstheorie 39 , 2008, 1-22.
Görg Haverkate, Gewißheitsverluste im juristischen Denken, Zur politischen Funktion der juristischen Methode, Berlin 1977
Philipp Heck, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tübingen 1932
Philipp Heck, Das Problem der Rechtsgewinnung (1912), 2. Aufl., Tübingen 1932
Rainer Hegenbarth, Juristische Hermeneutik und linguistische Pragmatik, Königstein/Ts. 1982
Birte Hellmig, Recht als Verantwortungsinstanz – Ein empirischer Beitrag zu den Funktionen von Recht, in: Michelle Cottier u. a. (Hg.), Wie wirkt Recht?, Ausgewählte Beiträge zum Ersten Gemeinsamen Kongress der Deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereinigungen, Luzern, 4. - 6. September 2008, Bd. 1, Baden-Baden 2010, S. 391-407.
Thomas Henninger, Europäisches Privatrecht und Methode, Entwurf einer rechtsvergleichend gewonnenen juristischen Methodenlehre, Tübingen 2009
Manfred Herbert, Rechtstheorie als Sprachkritik, Zum Einfluß Wittgensteins auf die Rechtstheorie, Baden-Baden 1995
Burkhard Heß, Methoden der Rechtsfindung im Europäischen Zivilprozessrecht, IPRax , 2006, 348.
Wolfgang Hoffmann-Riem, Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Eberhard Schmidt-Aßmann u. a. (Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, Baden-Baden 2004, S. 9-72.
Klaus J. Hopt, Was ist von den Sozialwissenschaften für die Rechtsanwendung zu erwarten?, Juristenzeitung 1975, 341-349.
Ulrich Huber, Savignys Lehre von der Auslegung der Gesetze in heutiger Sicht, Juristenzeitung 2003, 1-17.
Hermann Isay, Rechtsnorm und Entscheidung, Berlin 1929
Dorothea Jansen, Theoriekonzepte in der Analyse sozialer Netzwerke, Entstehung und Wirkungen, Funktionen und Gestaltung sozialer Einbettung, Speyer 2007
Matthias Jestaedt, Wie das Recht, so die Auslegung, Zeitschrift für öffentliches Recht 55 , 2000, 133-162.
M. Ethan Katsh, The Electronic Media and the Transformation of Law, New York, NY 1989
Arthur Kaufmann, Analogie und "Natur der Sache". Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus, Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 22. April 1964, Karlsruhe 1965
Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien 1960
Andreas Kemmerling, Regel und Geltung im Lichte der Analyse Wittgensteins, Rechtstheorie 6, 1975, 104-131.
Urs Kindhäuser, Zur Definition qualitativer und komparativer Begriffe -- Eine Entgegnung auf Herschels Typologie im Arbeitsrecht, Rechtstheorie 12 , 1981, 226-248.
Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze, Semantische Normativität in der juristischen Argumentation, Baden-Baden 2004
Ulrich Klug, Juristische Logik, Berlin 1951
Florian Knauer, Juristische Methodenlehre 2.0?, Der Wandel der juristischen Publikationsformate und sein Einfluss auf die juristische Methodenlehre, Rechtstheorie 40, 2009, 379-403.
Hans Joachim Koch/Helmut Rüßmann, Juristische Begründungslehre, München 1982
Hans Joachim Koch/Helmut Rüßmann, Juristische Methodenlehre und analytische Philosophie, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie Beiheft 44, 1991, 186-200.
Horst Konzen, Normtatsachen und Erfahrungssätze bei der Rechtsanwendung im Zivilprozeß, in: Festschrift für Hans Friedhelm Gaul zum 70. Geburtstag, Bielefeld 1997, S. 335-356.
Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3. Aufl., Bern 2010
Martin Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, Entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation, 2. Aufl., Berlin 1976
Saul A. Kripke, Wittgenstein über Regeln und Privatsprache, (Wittgenstein on Rules and Private Language, 1982), Frankfurt am Main 1987
Hans Kudlich/Ralph Christensen, Wortlautgrenze: Spekulativ oder pragmatisch?, Zugleich Besprechung von Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der juristischen Argumentationstheorie (2004), Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 93 , 2007, 128-142
Lothar Kuhlen, Typuskonzeptionen in der Rechtstheorie, Berlin 1977
Karl-Heinz Ladeur, Computerkultur und Evolution der Methodendiskussion in der Rechtswissenschaft, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 74 , 1988, 218-238
Karl-Heinz Ladeur, Postmoderne Rechtstheorie, Selbstreferenz - Selbstorganisation - Prozeduralisierung, 2. Aufl., Berlin 1995
Karl-Heinz Ladeur, Die rechtswissenschaftliche Methodendiskussion und die Bewältigung des gesellschaftlichen Wandels, Zugleich ein Beitag zur Bedeutung der ökonomischen Analyse des Rechts, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 64 , 2000, 60-103
Katja Langenbucher, Die Entwicklung und Auslegung von Richterrecht, Eine methodologische Untersuchung zur richterlichen Rechtsfortbildung im deutschen Zivilrecht, München 1996
Katja Langenbucher, Vorüberlegungen zu einr Europarechtlichen Methodenlehre, in: Thomas Ackermann (Hg.), Tradition und Fortschritt im Recht, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1999, Stuttgart 2000, S. 65-83
Katja Langenbucher, Das Dezisionismusargument in der deutschen und in der US-amerikanischen Rechtstheorie, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 88 , 2002, 399-406
Katja Langenbucher, Europarechtliche Methodenlehre, in: Katja Langenbucher/Andreas Engert (Hg.), Europarechtliche Bezüge des Privatrechts, 2. Aufl., Baden-Baden 2008, S. 1-40.
Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., Berlin 1991
Agnes Launhardt, Methodenlehre aus rechtsrhetorischer Perspektive: Abschied von der Normativität?, Rechtstheorie 32, 2001, 141-157.
Agnes Launhardt, Topik und Rhetorische Rechtstheorie, Eine Untersuchung zu Rezeption und Relevanz der Rechtstheorie Theodor Viehwegs, Frankfurt am Main 2010
Rüdiger Lautmann, Justiz - die stille Gewalt, Teilnehmende Beobachtung und entscheidungssoziologische Analyse, Frankfurt am Main 1972
Detlef Leenen, Typus und Rechtsfindung, Die Bedeutung der typologischen Methode für die Rechtsfindung dargestellt am Vertragsrecht des BGB, Berlin 1971
Kent D. Lerch (Hg.), Recht vermitteln, Strukturen, Formen und Medien der Kommunikation im Recht Bd. 3, Berlin 2005
Kent D. Lerch, Wissen oder Willkür? Zur Konstruktion des Rechtsfalls durch den Richter, in: Ulrich Dausendschön-Gay (Hg.), Wissen in (Inter-)Aktion, Verfahren der Wissensgenerierung in unterschiedlichen Praxisfeldern, Berlin 2010, S. 225-247.
Karl N. Llewellyn, Some Realism About Realism: Responding to Dean Pound, Harvard Law Review 44, 1931, 1222-1264.
Dirk Looschelders/Wolfgang Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, Zugleich ein Beitrag zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen von Gesetzesauslegung und Rechtsfortbildung, Berlin 1996
Niklas Luhmann, Funktionale Methode und juristische Entscheidung, Archiv des öffentlichen Rechts 94, 1969, 1-31
Niklas Luhmann, Die Paradoxie des Entscheidens, Verwaltungsarchiv 84 , 1993, 287-310
Niklas Luhmann, Organisation und Entscheidung, Opladen [u.a.] 2000
Klaus Luig, Macht und Ohnmacht der Methode, NJW, 1992, 2536-2539.
Axel Mennicken, Das Ziel der Gesetzesauslegung, Eine Untersuchung zur subjektiven und objektiven Auslegungstheorie, Bad Homburg 1970
Christoph Möllers, Braucht das öffentliche Recht einen neuen Methoden- und Richtungsstreit?, Verwaltungsarchiv 99, 1999, 187-207.
Thomas M. J. Möllers, Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, Klausur, Hausarbeit, Seminararbeit, Staatsexamen, Dissertation, München 5. Aufl., 2010
Friedrich Müller, Normstruktur und Normativität, Zum Verhältnis von Recht und Wirklichkeit in der juristischen Hermeneutik, entwickelt an Fragen der Verfassungsinterpretation, Berlin 1966
Friedrich Müller, Virtualität im Rahmen der strukturierenden Rechtslehre, Rechtstheorie 32, 2001, 359-371.
Friedrich Müller/Ralph Christensen, Juristische Methodik: Grundlegung für die Arbeitsmethoden der Rechtspraxis, 10. Aufl., Berlin 2009
Karlheinz Muscheler, Entstehungsgeschichte und Auslegung von Gesetzen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in: Joachim Bohnert (Hg.), Verfassung - Philosophie - Kirche, Festschrift für Alexander Hollerbach zum 70. Geburtstag, Berlin 2001, S. 99.
Olaf Muthorst, Gottfried Wilhelm Leibniz' »Neue Methode, Jurisprudenz zu lernen und zu lehren« – ein Vordenker rechtswissenschaftlicher Fachdidaktik?, in: Judith Brockmann u. a. (Hg.), Exzellente Lehre im juristischen Studium, Auf dem Weg zu einer rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik, Bd. 1, Baden-Baden 2011, S. 97-105.
Ulfrid Neumann, Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Tatfrage und das Problem des revisionsgerichtlichen Augenscheinsbeweises, Goldtammers Archiv , 1988, 387-402, [Seiten von–bis fehlt!].
Ulfrid Neumann, Juristische Methodenlehre und Theorie der juristischen Argumentation, Rechtstheorie 32 , 2001, 239-255.
Ulfrid Neumann, Theorie der juristischen Argumentation, in: Arthur Kaufmann u. a. (Hg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 8. Aufl., Heidelberg 2011, S. 333-347.
Regina Ogorek, Richterkönig oder Subsumtionsautomat?, Zur Justiztheorie im 19. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1986
Regina Ogorek, Alltagstheorien/Sonntagstheorien. Zum Einsatz „ungewissen Wissens" bei der Rechtsanwendung, in: Regina Ogorek (Hg.), Aufklärung über die Justiz. Abhandlungen und Rezensionen I, Frankfurt am Main 2008, S. 413-438.
Regina Ogorek, Gefährliche Nähe? Richterliche Rechtsfortbildung und Nationalsozialismus, in: Felix Herzog/Ulfrid Neumann (Hg.), Festschrift für Winfried Hassemer, Heidelberg 2010, S. 159-171.
Dirk Olzen/Rolf Wank, Zivilrechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium, 6. Aufl., München 2010
Hans-Martin Pawlowski, Methodenlehre für Juristen, 3. Aufl., Heidelberg 1999
Niels Petersen, Braucht die Rechtswissenschaft eine empirische Wende?, Rechtstheorie 41 , 2010, 435-455.
Claes Peterson, Zur Anwendung der Logik in der Naturrechtslehre von Christian Wolff, in: Jan Schröder (Hg.), Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und Philosophie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Beiträge zu einem interdisziplinären Symposion in Tübingen, 18. - 20. April 1996, Bd. 46, Stuttgart 1998, S. 177-189.
Karen Petroski, Does It Matter What We Say About Legal Interpretation?, http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1769680_code1099811.pdf?abstractid=1746102&mirid=1 (Stand: 2. 6. 2011).
Klaus Juergen Philippi, Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts, Köln, Berlin, Bonn, München 1971
Adalbert Podlech, Wertungen und Werte im Recht, Archiv des öffentlichen Rechts 95, 1970, 185-223.
Stephan Pötters/Ralph Christensen, Richtlinienkonforme Rechtsfortbildung und Wortlautgrenze, Juristenzeitung , 2011, 387-394.
Holm Putzke, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, Klausuren, Hausarbeiten, Seminare, Bachelor- und Masterarbeiten, 3. Aufl., München 2010
Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 12. Aufl. 1969
Peter Raisch, Vom Nutzen der überkommenen Auslegungskanones für die praktische Rechtsanwendung, Heidelberg 1988
Karl Riesenhuber (Hg.), Europäische Methodenlehre, Handbuch für Ausbildung und Praxis, 2. Aufl., Berlin 2010
Klaus F. Röhl, Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung, Tübingen 1974
Klaus F. Röhl/Hans Christian Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl., Köln 2008
Helmut Rüßmann, Normtatsachen – Ein vorläufiger Überblick, Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1991, 402-415.
Bernd Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus, 5. Aufl., Heidelberg 1997 [1968]
Bernd Rüthers, Die neuen Herren - Rechtsdogmatik und Rechtspolitik unter dem Einfluss des Richterrechts, Zeitschrift für Rechtsphilosophie 2005, 1-13.
Bernd Rüthers, Methodenrealismus in Jurisprudenz und Justiz, Juristenzeitung 2006, 53-60.
Bernd Rüthers, Methodenfragen als Verfassungsfragen, Rechtstheorie 40, 2009, 253-283.
Jürgen H. A. Sander, Normtatsachen im Zivilprozess, Berlin 1998
Heiko Sauer, Juristische Methodenlehre, in: Julian Krüper (Hg.), Grundlagen des Rechts, Baden-Baden 2011, S. 168-186.
Katharina Gräfin von Schlieffen, Wie Juristen begründen, Entwurf eines rhetorischen Argumentationsmodells für die Rechtswissenschaft, Juristenzeitung 2011, 109-116.
Dieter Schmalz, Methodenlehre für das juristische Studium, 4. Aufl., Baden-Baden 1998
Jeannette Schmid/Thomas Drosdeck/Detlef Koch, Der Rechtsfall - ein richterliches Konstrukt, Baden-Baden 1997
Eike Schmidt, Der Umgang mit Normtatsachen im Zivilprozeß, in: Christian Broda (Hg.), Festschrift für Rudolf Wassermann zum sechzigsten Geburtstag, Neuwied 1985, S. 807-818.
Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann-Hoffmann-Riem (Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, Baden-Baden 2004
Carl Schmitt, Gesetz und Urteil, Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis, Berlin 1912
Jan Schröder (Hg.), Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und Philosophie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Beiträge zu einem interdisziplinären Symposion in Tübingen, 18. - 20. April 1996 Bd. 46, Stuttgart 1998
Jan Schröder, Rechtsbegriff und Auslegungsgrundsätze im frühen 20. Jahrhundert, Anmerkungen zum Streit zwischen „objektiver" und „subjektiver" Interpretationstheorie, in: Friedrich-Christian Schroeder (Hg.), Rechtswissenschaft in der Neuzeit, Geschichte, Theorie, Methode; ausgewählte Aufsätze 1976 - 2009, Tübingen 2010, S. 585-598.
Friedrich-Christian Schroeder, Die normative Auslegung, Juristenzeitung 2011, 187-194.
Ingo Schulz-Schaeffer, Rechtsdogmatik als Gegenstand der Rechtssoziologie, Für eine Rechtssoziologie „mit noch mehr Recht", Zeitschrift für Rechtssoziologie, Zeitschrift für Rechtssoziologie 25, 2004, 141-174.
Winfried Schuschke/Hermann Daubenspeck/Paul Sattelmacher, Bericht, Gutachten und Urteil, 34. Aufl., München 2008
Wolfgang Seiler, Höchstrichterliche Entscheidungsbegründungen und Methode im Zivilrecht, Baden-Baden 1992
Eric Simon, Gesetzesauslegung im Strafrecht, Eine Analyse der höchstrichterlichen Rechtsprechung, Berlin 2005
Katharina Sobota (Gräfin von Schlieffen), Sachlichkeit, rhetorische Kunst der Juristen, Frankfurt am Main, New York 1990
Peter Stegmaier, Wissen, was Recht ist, Richterliche Rechtspraxis aus wissenssoziologisch-ethnografischer Sicht, Wiesbaden 2009
Hans-Joachim Strauch, Grundgedanken einer Rechtsprechungstheorie, Thüringer Verwaltungsblätter 2003, 1-7.
Gerhard Struck, Zur Theorie juristischer Argumentation, Berlin 1977
Cass R. Sunstein, One case at a time, Judicial minimalism on the Supreme Court, Cambridge, Mass., London 1999
Brian Z. Tamanaha, Beyond the Formalist-Realist Divide, The Role of Politics in Judging, Princeton N.J. 2010
Gunther Teubner, Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe, Folgenorientiertes Argumentieren in rechtsvergleichender Sicht, Baden-Baden 1995
Gunther Teubner, Globale Bukowina: Zur Emergenz eines transnationalen Rechtspluralismus, Rechtshistorisches Journal 15, 1996, 255-290.
Gunther Teubner/Peter Korth, Zwei Arten des Rechtspluralismus: Normkollisionen in der doppelten Fragmentierung der Weltgesellschaft, in: Matthias Kötter/Gunnar Folke Schuppert (Hg.), Normative Pluralität ordnen, Baden-Baden 2009, S. 137-168.
Bart van Klink/Sanne Taekema (Hg.), Law and Method, Interdisciplinary Research into Law Bd. 4, Tübingen 2011
Thomas Vesting, Rechtstheorie, München 2007
Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz, Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 5. Aufl., München 1974
Friedemann Vogel, Blinde Flecken in der juristischen Hermeneutik, (Besprechung von Ino Augsberg, Die Lesbarkeit des Rechts, 2009), Rechtstheorie 41 , 2010, 25-33.
Stefan Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent, 2 Bde, Tübingen 2001
Stefan Vogenauer, Eine gemeineuropäische Methodenlehre des Rechts – Plädoyer und Programm, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 13 , 2005, 235-263.
Andreas von Arnauld, Möglichkeiten und Grenzen dynamischer Interpretation von Rechtsnormen, Ein Beitrag zur Rekonstruktion autor-subjektiver Normauslegung, Rechtstheorie 32, 2001, 465-495.
Rainer Wahl, Der Vorrang der Verfassung, Der Staat 20 , 1981, 485-516.
Rolf Wank, Die Auslegung von Gesetzen, 4. Aufl., Köln 2008
Walter Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, Rede, gehalten bei der Inauguration als Rector magnificus der Karl-Franzens-Universität in Graz am 22. November 1950, Graz 1950
Reinhold Zippelius, Juristische Methodenlehre, 10. Aufl., München 2006
Ernst Zitelmann, Lücken im Recht, Rede, gehalten bei Antritt des Rektorats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn am 18. Oktober 1902, Leipzig 1903
[1] Ein Stimmregister bei Christian Fischer, Topoi verdeckter Rechtsfortbildungen im Zivilrecht, 2007, 130. Zahlreiche Beiträge zum Theorie-Praxis-Bruch bietet das Sonderheft "Juristische Methodenlehre" = Heft 2-3 der Zeitschrift für Rechtstheorie Bd. 32, 2001, hg. von Werner Krawietz und Martin Morlok. Es handelt sich um Beiträge zu einer im Oktober 2000 veranstalteten Tagung in Hagen. Sie sollte den Start für ein Forschungsprojekt bilden, das die in der juristischen Praxis verwendeten Argumentationsweisen empirisch erheben sollte. Das Projekt unter der Leitung von Martin Morlok hat jedoch nicht zu einer abschließenden und zusammenfassenden Veröffentlichung geführt. Immerhin sind aus dem Projekt zwei wichtige Dissertationen entstanden, nämlich Agnes Launhardt, Topik und Rhetorische Rechtstheorie, Eine Untersuchung zu Rezeption und Relevanz der Rechtstheorie Theodor Viehwegs, 2010, sowie Peter Stegmaier, Wissen, was Recht ist, Richterliche Rechtspraxis aus wissenssoziologisch-ethnografischer Sicht, 2009.
[2] Die Prognose Ladeurs (Computerkultur und Evolution der Methodendiskussion in der Rechtswissenschaft, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 74, 1988, 218-238, S. 237, Fn. 114), wegen des Zerfalls der Kontinuität und Ordnung stiftenden Erfahrung "werde die Orientierungsfunktion der Präzendenzfälle für die Rechtsprechung an Bedeutung verlieren, ist bisher nicht eingetroffen.
[3] Nach dem Titel des Buches von Joachim Hruschka, Die Konstitution des Rechtsfalles, Studien zum Verhältnis von Tatsachenfeststellung und Rechtsanwendung, 1965.
[4] Aus wissenschaftstheoretischer Sicht wird die Sachverhaltsfeststellung von Arne Upmeier, Fakten im Recht, 2010, analysiert. Die Untersuchung bestätigt, was im Grund bekannt ist, dass wir nämlich auch bei der Faktenermittlung auf eine Referenzbeziehung zwischen Sprache und realer Welt verzichten müssen mit der Folge, "dass beim Gang von einem zeitlich-räumlichen Geschehen zu dessen Formulierung im Tatbestand des Urteils auf jeder Übetragungsstufe kreativ-konstruktionale Elemente eine wesentliche und nicht eliminierbare Rolle spielen" (S. 136). Methodische Anleitungen ergeben sich daraus aber nicht.
[5] Auch das in der Wissenschaftstheorie geläufige Begriffspaar Entdeckungszusammenhang (context of discovery) und Begründungszusammenhang (context of justification) wird von einigen herangezogen. Es stammt von Hans Reichenbach (Experience and Prediction, 1938). Reichenbach sah im Entdeckungszusammenhang einen psychischen Prozess, der nicht Gegenstand der Erkentnistheorie sein kann. Das war auch die Ansicht Poppers. Der englische Titel seiner "Logik der Forschung" - The Logic of Scientific Discovery - ist insofern irreführend, denn gibt es die Gegenvorstellung einer logic of discovery, die Vorstellung nämlich, dass auch die Entdeckung neuer Erkenntnisse methodisch angeleitet sein kann. Interessanter ist die Kritik von Thomas S. Kuhn (Thomas S. Kuhn, Logic of Discovery or Psychology of Research, in: Imre Lakatos/Alan Musgrave (Hg.), Criticism and the Growth of Knowledge, Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science, London, 1965, Cambridge, UK 1970, 1-23, S. 21ff), der Popper zwar darin zustimmt, dass individualpsychologische Antriebe methodisch irrelevant seien, der aber geltend macht, dass die sich in einer Wissenschaftlergruppe entwickelnden gemeinsamen Einstellungen und die moralischen Imperative der scientific community durchaus in Betracht gezogen werden müssten. Das Begriffspaar wird ausführlich rezipiert von Christian Fischer, Topoi verdeckter Rechtsfortbildungen im Zivilrecht, 2007, 457 ff.
Das Begriffspaar findet als Genesis und Geltung auch in der Rechtsphilosophie Verwendung, um deutlich zu machen, dass das Faktum der Entstehung einer Rechtsnorm deren Wert und Geltung nicht direkt begründen kann. Dabei geht es um eine Erscheinungsform der Differenz von Sein und Sollen.
Für die Annahme, dass auch die Entdeckung juristischer Entscheidungen methodisch angeleitet werden könne, beruft man sich in der Rechtstheorie gelegentlich auf den von Peirce eingeführten Gedanken der Abduktion; vgl dazu Fn. 10.
Der Entdeckungszusammenhang wissenschaftlicher Ergebnisse und die Herstellung juristischer Entscheidungen sind schwer vergleichbar. Wissenschaftler suchen prinzipiell nach neuen Ideen, während Juristen nach vorhandenen Entscheidungsmaßstäben Ausschau halten. Wissenschaftler können von ihrer Erfindungsgabe recht ungebunden Gebrauch machen, während juristische Entscheidungen in einem geregelten Verfahren hergestellt werden. Zwar erfolgt technisch die Ausformulierung des Gerichtsurteils in der Regel erst nach Abschluss des Verfahrens. Aber es wäre falsch, die beiden Aspekte als zeitlich aufeinander folgende Phasen zu verstehen.
[6] Einen Problemabriss mit Literaturnachweisen gibt Katharina Sobota (Gräfin von Schlieffen), Sachlichkeit, rhetorische Kunst der Juristen, 1990, S. 13-22.
[7] Psychologisch gemeint war dagegen die gleichfalls 1929 von Hutcheson geäußerte Ansicht, wonach die im Einzelfall getroffene Entscheidung des Richters aus der Intuition (hunch) zu erklären sei. Die Bezugnahme auf Normen oder Präjudizien sei nur eine nachträgliche Rationalisierung, die für die Entstehung der Entscheidung ohne Bedeutung sei (Joseph C. Hutcheson, The Judgment Intuitive: The Function of the 'Hunch' in Judicial Decision, Cornell Law Quarterly 14, 1929, 274-288). Dickinson hat ihm alsbald widersprochen mit der These, dass Richter während ihrer Ausbildung und Berufstätigkeit die im Recht angelegten Konzepte verinnerlichten, so dass sie sich selbst an diese Normen gebunden fühlten. Er zweifelte nicht, dass Gesetze und Präjudizen für die Herstellung der richterlichen Entscheidung beträchtliche Wirkung entfalteten. Allerdings ließ er die Frage offen, in welchem Verhältnis dieses rule-element zu dem Beitrag steht, der aus der Richterpersönlichkeit in die Entscheidung einfließt (John Dickinson, Legal Rules: Their Function in the Process of Decision, University of Pennsylvania Law Review 79, 1931, 833-868, S. 839f.). Auch der als Regelskeptiker bekannte Llewellyn war der Überzeugung, dass die Gemeinsamkeiten im Handeln und Denken der Juristen weit wichtiger seien als die jeweilige Richterpersönlichkeit. Und H. L. A. Hart meinte, man dürfe die Frage nach der Wirksamkeit einer Regel nicht mit dem psychologischen Prozess verwechseln, den die Person, bevor sie handelte, durchlief. "Der wichtigste Faktor aber, der uns anzeigt, daß wir beim Handeln eine Regel angewandt haben, ist der, daß, wenn unser Verhalten angezweifelt wird, wir es durch Rückbeziehung auf die Regel rechtfertigen können." (1973, 195)
[8] Walter R. Schluep, Recht und Intuition, in: Martina Caroni u. a. (Hg.), Festschrift für Paul Richli, Zürich, St. Gallen: Dike, 2011, 221-255, zeigt die Rationalitätsdefizite der gängigen Auslegungslehren auf, kommt über ein "Bekenntnis zur Bedeutung intuitiver Wahrnehmung des Richtigen" nicht hinaus. Hinweise auf die aktuelle amerikanische Diskussion bei Timothy P. O'Neill, Law and "The Argumentative Theory", Oregon Law Review , 2012, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1988445.
[9] Man könnte hier das von Glöckner herausgearbeitete Parallel-Constraint-Satisfaction-Modell der Entscheidung heranziehen. Allerdings befasst es sich nur mit der Sachverhaltsfeststellung. (Andreas Glöckner, Zur Rolle intuitiver und bewusster Prozesse bei rechtlichen Entscheidungen, 2008, http://www.mpg.de/317987/forschungsSchwerpunkt.) Auch ein Ausflug in die Wissenssoziologie von Pierre Bourdieu bietet sich an (Entwurf einer Theorie der Praxis, 1979; Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 1984). Von Bourdieu kann man erfahren, dass eine gleichförmige Praxis nicht unbedingt aus der gehorsamen Erfüllung von Regeln hervorgeht. Bourdieu findet eine Ursache für Regelmäßigkeiten und abgestimmtes Verhalten vielmehr in einem gruppen- oder klassenspezifischen "Habitus". In diese Richtung gehen Martin Morlok/Ralf Kölbel, Rechtspraxis und Habitus, Rechtstheorie 32, 2001, 289-304.
[10] Positiver Klaus Lüderssen, Erfahrung als Rechtsquelle. Abduktion und Falsifikation von Hypothesen im juristischen Entscheidungsprozess. 1972; Arthur Kaufmann, Die Rolle der Abduktion als Rechtsgewinnungsverfahren, in: Guido Britz/Heinz Müller-Dietz (Hg.), Grundfragen staatlichen Strafens, Festschrift für Heinz Müller-Dietz zum 70. Geburtstag, 2001, 349-360; Ralf Kölbel/Thorsten Berndt/Peter Stegmaier, Abduktion in der justiziellen Entscheidungspraxis, Rechtstheorie 37, 2006, 85-108. Zurückhaltend Robert Alexy, Arthur Kaufmanns Theorie der Rechtsgewinnung, ARSP Beiheft 100, 2005, 47-66.
[11] Rüdiger Lautmann, Justiz - die stille Gewalt, Teilnehmende Beobachtung und entscheidungssoziologische Analyse, 1972; Stephan Wolff/Hermann Müller, Kompetente Skepsis, Eine konservationsanalytische Untersuchung zur Glaubwürdigkeit in Strafverfahren, 1997; Peter Stegmaier, Wissen, was Recht ist, Richterliche Rechtspraxis aus wissenssoziologisch-ethnografischer Sicht, Wiesbaden 2009. Die genannten Untersuchungen behandeln ganz überwiegend die Sachverhaltsfeststellung. Mit der Strafzumessung befasst sich Raimund Hassemer, Einige empirische Ergebnisse zum Unterschied zwischen der Herstellung und der Darstellung richterlicher Sanktionsentscheidungen, Monatsschrift für Kriminologie 66 , 1983, 26-39.
[12] Gabi Löschper (Bausteine für eine psychologische Theorie richterlichen Urteilens, 1999) befasst sich nicht eigentlich mit psychologischen, sondern mit diskursanalytischen Theorien richterlichen Urteilens und reproduziert umständlich Naheliegendes oder gar Selbstverständliches.
[13] Einen Anfang machen Mark Schweizer, Kognitive Täuschungen vor Gericht, Züricher Dissertation (online verfügbar); Gerhard Wagner, Heuristiken und Urteilsverzerrungen in Konfliktsituationen, Zeitschrift für Zivilprozess 121, 2008, 5-39; Hugo Mercier/Dan Sperber, Why Do Humans Reason? Arguments for an Argumentative Theory, Behavioral and Brain Sciences 34, 2011, 57-74.
[14] Katharina Sobota (Gräfin von Schlieffen), Sachlichkeit, rhetorische Kunst der Juristen, 1990, 119 f., 147 f.
[15] Zur Methodenlehre als Qualitätsstandard Wolfgang Hoffmann-Riem, Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Eberhard Schmidt-Aßmann u. a. (Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004, 9-72, S. 15 f.
[16] Friedrich-Christian Schroeder hat mit guten Gründen die Annahme zurückgewiesen, die so genannte normative Auslegung sei als fünfte neben die vier Standardmethoden getreten (Die normative Auslegung, JZ 2011, 187-194).
[17] Anders Hassemer. Er betont aber zu kurzschlüssig, aus der "Ergebnisdifferenz" bei der Anwendung der verschiedenen Methoden und dem Fehlen einer Hierarchie zwischen den Auslegungsregeln folge die Freiheit der Methodenwahl. Der Kurzschluss beruht in erster Linie darauf, dass Hassemer die "objektiv-teleologische Auslegung" mit den anderen Methoden auf eine Stufe stellt, dass er den Kanon der Auslegungsmethoden für beliebig vermehrbar hält und schließlich, dass er differierende Ergebnisse der verschiedenen Methoden nicht als Argumente, sondern als Widerspruch behandelt. (Winfried Hassemer, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, Rechtstheorie 39, 2008, 1-22, S. 10ff.)
[18] Eine klassische Formulierung dieses Gedankens bei Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 12. Aufl. 1969, 254f. Dazu ausführlich Erhard Kausch, Kann das Gesetz klüger sein als der Gesetzgeber? - Überlegungen zu Gustav Radbruchs Auslegungstheorie, in: Wolfgang Baumann u. a. (Hg.), Gesetz, Recht, Rechtsgeschichte, Festschrift für Gerhard Otte, 2005, S. 165-183.
[19] Günter Hirsch, Zwischenruf: Der Richter wird's schon richten, ZRP 2006, 161; ders., Rechtsstaat - Richterstaat, FAZ vom 30.7.2007, S. 8; ders., Auf dem Weg zum Richterstaat?, JZ 2007, 853; kritisch dazu Christoph Möllers, FAZ vom 26.10.2006, und Bernd Rüthers, JZ 2007, 556; vermittelnd Hassemer, Gesetzesbindung und Methodenlehre, ZRP 2007, 213.
[20] Joachim Rückert, Abwägung - die juristische Karriere eines unjuristischen Begriffs, Juristenzeitung 2011, 913-923, 921.
[21] Christian Fischer, Topoi verdeckter Rechtsfortbildungen im Zivilrecht, 2007, verwendet ein langes Kapitel (S. 34-95) auf die Durchsicht der Abgrenzungsversuche mit dem Ergebnis, dass eine Grenzziehung bisher nicht gelungen sei.
[22] Die Entwicklung des Abwägungsgedankens seit Beginn des 20. Jahrhunderts schildert Joachim Rückert, Abwägung, Juristenzeitung, 2011, 913-923.
[23] Grundlegend Bernhard Schlink, Abwägung im Verfassungsrecht, 1976, Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986. Sehr kritisch zur Abwägung im Verfassungsrecht Juan Antonio García Amado, Abwägung versus normative Auslegung?, Kritik der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips als Mittel juristischer Methodik, Rechtstheorie, 1-42. Amado macht geltend, wenn Verfassunggerichte von Abwägung sprächen, wendeten sie tatsächlich unter der Hand die geläufigen Auslegungsmethoden an. Das Ergebnis einer Awägung werde in erster Linie durch eine teleologische Auslegung in Frage stehender Gesetze bestimmt.
[24] Neuestens Wilfried Erbguth/Winfried Kluth (Hg.), Planungsrecht in der gerichtlichen Kontrolle, Berlin 2012.
[25] Ansätze bei: Lothar Michael, Methodenfragen der Abwägungslehre, JöR 48, 2000, 169-203; Matthias Klatt/Johannes Schmidt, Spielräume im öffentlichen Recht, Zur Abwägungslehre der Prinzipientheorie, 2010.
[26] Z. B. Ralph Christensen/Andreas Fischer-Lescano, Das Ganze des Rechts, 2007, S. 148 ff.
[27] Klatt/Schmidt (Spielräume im öffentlichen Recht, 2010) versuchen, die Probleme durch Formalisierung auf der Grundlage der Prinzipientheorie Alexys in den Griff zu bekommen.
[28] Ekkehard Hofmann, Abwägung im Recht, 2007; ders., Formale Sprachen im Recht, in: Kent D. Lerch (Hg.), Recht vermitteln, 2005, 289-320. Speziell im Hinblick auf Entscheidungen unter empirischer Ungewissheit versuchen Klatt und Schmidt die Abwägung zu formalisieren (Matthias Klatt/Johannes Schmidt, Spielräume im öffentlichen Recht, 2010).
[29] Zahlen zur Häufigkeit der Abwägung in Entscheidungen des Bundesverfassunsgerichts bei Joachim Rückert, Abwägung - die juristische Karriere eines unjuristischen Begriffs, Juristenzeitung 2011, 913-923, 915.
[30] Der zeitgenössische Gegenspieler Hecks war dessen Greifswalder Fakultätskollege Ernst Stampe, der eine abwägende "Sozialjurisprudenz" zur Methode machen wolle; dazu Joachim Rückert, Abwägung - die juristische Karriere eines unjuristischen Begriffs, Juristenzeitung 2011, 913-923, 914 ff.
[31] "Unter Bedingungen höherer Komplexität der Rechtskonflikte … können die Canones der traditionellen Auslegungslehre … allein nicht mehr als überzeugend angesehen werden." (Karl-Heinz Ladeur/Ino Augsberg, Auslegungsparadoxien, Rechtstheorie 36, 2005, 143-184, 176).
[32] Die Differenzierung zwischen Entscheidungsregeln und Relevanzregeln übernehme ich von Ulfried Neumann. Sie findet sich erstmals in dem Aufsatz "Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Tatfrage und das Problem des revisionsgerichtlichen Augenscheinsbeweises" (GA 1988, 387-402, S. 398ff). Aufgenommen ist sie bei Ellscheid im ARSP-Beiheft 45, 1992, S. 23, 33ff. Neumann ist auf die Abgrenzung in seinen Beiträgen zur den Festschriften für Lutz Meyer-Goßner (2001, dort S. 683, 701ff.) und Winfried Hassemer (2010, dort S. 143, 156) zurückgekommen.
[33] Näher zu diesem Problemkreis Gerhard Otte, Komparative Sätze im Recht. Zur Logik eines beweglichen Systems, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie Bd. 2, 1972, 301-320.
[34] BAGE 30, 163/169, E 84, 106; BSGE 45, 199, E 83, 246; BFHE 144, 225; E 188, 101; näher Rolf Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, 1988; Wolfgang Hromadka, Arbeitnehmerbegriff und Arbeitsrecht, NZA 1997, 569-580; Kerstin Reiserer/Anke Freckmann, Scheinselbständigkeit - heute noch ein schillernder Rechtsbegriff, NJW 2003, 180-185; Thomas Blanke, Die Auflösung des Arbeitnehmerbegriffs, KritJ 2003, 7-16 [www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/2003/20031Blanke_S_7.pdf].
[35] BVerfG (K), NJW 1996, 2643.
[36] Wie voraussetzungsvoll sich der Import empirischen Wissens auch in solchen Fällen gestaltet, beschreibt Niels Petersen (Braucht die Rechtswissenchaft eine empirische Wende?, Rechtstheorie 41, 2010, 435-455, S. 449 ff.).
[37] Rolf Bender, Die entscheidungsleitende Funktion "genereller" Rechtstatsachen, in: Norbert Achterberg (Hrsg.), Rechtsprechungslehre, 1986, 603; Hans Joachim Böhlk/Lutz Unterseher, Die Folgen der Folgenorientierung, JuS 1980, 323; Martina R. Deckert, Folgenorientierung in der Rechtsanwendung, 1994; dies., Die folgenorientierte Auslegung, JuS 1995, 480-484; Martin Hensche, Teleologische Begründungen in der juristischen Dogmatik, 1998; Gertrude Lübbe-Wolf, Rechtsfolgen und Realfolgen, 1981; Klaus Lüderssen, Erfahrung als Rechtsquelle, 1972; Klaus Mathis, Effizienz statt Gerechtigkeit? Auf der Suche nach den philosophischen Grundlagen der Ökonomischen Analyse des Rechts, 3. Aufl., 2009; Gunther Teubner (Hg.), Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe - folgenorientiertes Argumentieren in rechtsvergleichender Sicht, 1995; Thomas Wälde, Juristische Folgenorientierung, 1979.
[38] Einen guten Überblick über die Rechtslage, auch in England und den USA, über die Versuche der Obergerichte, informell Kontextwissen aufzunehmen sowie ausführliche Literaturhinweise gibt Felix Maultzsch, Streitentscheidung und Normbildung durch den Zivilprozess, 2010, 392-430. Maultzsch sieht bei den Obergerichten eine gewisse Tendenz, "normbildende Judikate" auf eine breitere Informationsgrundlage zu stellen.
[39] Niklas Luhmann, Funktionale Methode und juristische Entscheidung, AöR 94, 1969, 1 = ders., Ausdifferenzierung des Rechts, 1981, S. 273; ders., Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 1974.
[40] Prominentes Beispiel war das Verfahren im Lebach-Fall, in dem sozialwissenschaftliche Sachverständige bemüht wurden, um die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten eines Mittäters durch eine Fernsehsendung über den Tathergang zu untersuchen (BVerfGE 35, 202 ff). Allgemeiner zum Thema Klaus Jürgen Philippi, Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts, 1971; Karl Korinek, Die Tatsachenermittlung im verfassungsgerichtlichen Verfahren, in: Klaus Stern, Hrsg., 40 Jahre Grundgesetz, 1990, 107-118; Brun- Otto Bryde, Tatsachenfeststellungen und soziale Wirklichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht. In: Peter Badura und Horst Dreier (Hg.): Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, 533-561. Für die USA vgl. Oliver Lepsius, Sozialwissenschaften im Verfassungsrecht - Amerika als Vorbild?, Juristenzeitung 2005, 1-13. Müller/Christensen meinen, das Bundesverfassungsgericht habe die von ihnen so genannte Normbereichsanalyse in seinen Methodenkanon aufgenommen. Dazu haben sie eine lange Reihe von Beispielen zusammengestellt (Juristische Methodik, 10. Aufl. 2009, Rn. 67e).
[41] Florian Knauer, Juristische Methodenlehre 2.0? Der Wandel der juristischen Publikationsformate und sein Einfluss auf die juristische Methodenlehre, in: Rechtstheorie 40, 2009, 379-403, S. 397-400.
[42] Klaus F. Röhl, Ressort- und Berichtsforschung als Datenquelle, in: Matthias Mahlmann (Hg.), Gesellschaft und Gerechtigkeit, Festschrift für Hubert Rottleuthner, 2011, 357-393.
[43] Ralph Christensen/Andreas Fischer-Lescano, Das Ganze des Rechts, 2007, 174.
[44] A. a. O. S. 68.
[45] Diesen Eindruck erweckt Ladeur, wenn er schreibt, der "Bereich der horizontalen Verkettung von Möglichkeiten und Zwängen generiert über einen distribuierten a-zentrischen Prozeß ein nicht-hierarchisches Wissen, das über eine historische Dynamik der Selektivität einen ‚Prozeß des Zusammenpassens' von Entscheidugen enthält, der seine eigenen Richtigkeitsstandards erzeugt" (Das Umweltrecht der Wissensgesellschaft, 1995, S. 35 f.). Mit dem Konzept der "regulierten Selbstregulierung" möchte man in Verwaltungen und privaten Organisations- und Verfahrensregularien eine Art gemeinwohlorientierte Selbstkontrolle einbauen. Dazu etwa das Beiheft 4 (2001) der Zeitschrift "Die Verwaltung" mit dem Titel "Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates", dort u. a. Karl-Heinz Ladeur, Die Regulierung der Selbstregulierung und die Herausbildung einer "Logik der Netzwerke" (S. 59-77).