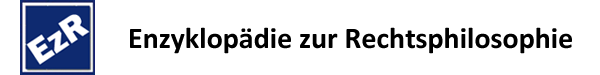Niklas Luhmann
Erstpublikation: 18.03.2013
1
Niklas Luhmann zählt zu den bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts. Mit Grund – nämlich ausweislich eigener Einschätzung – darf er als einer der letzten „Großtheoretiker“ dieses Jahrhunderts bezeichnet werden: „Bei meiner Aufnahme in die 1969 gegründete Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld fand ich mich konfrontiert mit der Aufforderung, Forschungsprojekte zu benennen, an denen ich arbeite. Mein Projekt lautete damals und seitdem: Theorie der Gesellschaft; Laufzeit: 30 Jahre; Kosten: keine.“ (Luhmann, GdG, S. 11). Seine Systemtheorie der Gesellschaft hat die Soziologie des vergangenen Jahrhunderts maßgeblich geprägt, ist aber auch für die Rechtswissenschaft (insb. durch Luhmann, RdG, passim) wirkungsmächtig geworden (siehe insoweit vor allem Schulte, 2011, passim).
I. Biographie
2
„Eine Biographie ist eine Sammlung von Zufällen, das Kontinuierliche besteht in der Sensibilität für Zufälle“ (Luhmann, Short Cuts, S. 16): Niklas Luhmann wird am 8. Dezember 1927 in Lüneburg geboren. Den 2. Weltkrieg erlebt er 1944 als Luftwaffenhelfer und 1945 in kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Zwischen 1946 und 1949 studiert Luhmann Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg i.Br. und absolviert seine Referendarausbildung. 1954 tritt er in den öffentlichen Dienst des Landes Niedersachsen ein, und zwar zunächst als Verwaltungsbeamter am Oberverwaltungsgericht Lüneburg, sodann zwischen 1955 und 1962 als Landtagsreferent im Niedersächsischen Kultusministerium.
3
Während dieser Zeit (1960/1961) lässt Luhmann sich zum Studium an der Harvard University beurlauben und kommt dabei mit Talcott Parsons in Kontakt (zum Einfluss Parsons auf Luhmann siehe Luhmann, Short Cuts, S. 15 f.). Von 1962 bis 1965 ist Luhmann als Referent am Forschungsinstitut der Hochschule für Verwaltungswissenschaft in Speyer beschäftigt. In diese Zeit fällt die Veröffentlichung seines ersten Buches mit dem Titel „Funktion und Folgen formaler Organisation“ (1964). Dieses Werk und eine weitere Monographie zum Thema „Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung“ werden 1966 unter der Betreuung von Helmuth Schelsky, der Luhmann schon 1965 als Abteilungsleiter an die Sozialforschungsstelle Dortmund geholt hatte, als Dissertation und Habilitation an der Universität Münster angenommen. Luhmanns für seine weiteren Forschungen grundlegende und richtungweisende Antrittsvorlesung an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster am 25. Januar 1967 widmet sich der „Soziologische(n) Aufklärung“ (Luhmann, SozA 1, S. 83 ff.). Auf seinen späteren Bielefelder Fakultätskollegen Franz-Xaver Kaufmann hinterließ sie einen besonders nachhaltigen Eindruck: „Ich saß damals neben Ernst-Wolfgang Böckenförde und wir spürten beide, dass hier ein Wissenschaftsprogramm angekündigt wurde, das nach der von Max Weber diagnostizierten Entzauberung der Welt durch das wissenschaftliche Denken sich nunmehr die Entzauberung des menschlichen Denkens vornahm.“ (Kaufmann, 1999, S. 9, 12, Hervorhebung i.O.).
4
1969 wird Luhmann dann Professor für Soziologie an der neugegründeten Reformuniversität Bielefeld. Seine Hoffnungen in die maßgeblich von Helmuth Schelsky inspirierte Idee und Gestalt der deutschen Universität als forschungsintensive Wissenschaftsorganisation (siehe dazu Schelsky, Einsamkeit und Freiheit, passim) erfüllen sich an der Universität Bielefeld jedoch nicht (Luhmann, Short Cuts, S. 24), so dass sich Luhmann – ohne Vernachlässigung seiner Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung, z.B. als Leiter des akademischen Prüfungsamtes der Fakultät für Soziologie – schon bald vorrangig auf die wissenschaftliche Arbeit konzentriert. Ein erster, bis heute nachwirkender Höhepunkt ist dabei zweifellos der 1971 aus einem Seminar mit Jürgen Habermas entstandene „Kontroversen-Band“ (Reese-Schäfer, S. 179) mit dem Titel „Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung?“. 1984 folgt – auch nach seiner eigenen Einschätzung – Luhmanns erste „richtige Publikation“: „Ich habe bei Büchern und Aufsätzen keine Perfektionsvorstellung, so wie manche, die meinen, bereits bei dem ersten Buch ein endgültiges Werk schreiben zu müssen. Was ich bisher geschrieben habe, ist alles noch Nullserie der Theorieproduktion – mit Ausnahme vielleicht des zuletzt erschienenen Buches Soziale Systeme.“ (Luhmann, Short Cuts, S. 25, Hervorhebung i.O.). Bis 1998 gelingt es Luhmann dann etwa 150 Aufsätze und 30 Bücher zu schreiben, eine für einen Zeitraum von knapp 15 Jahren schier unvorstellbare wissenschaftliche Produktivität. 1988 erhält er in Würdigung seiner wissenschaftlichen Arbeit den Hegel-Preis der Stadt Stuttgart. Zum Ende des Wintersemesters 1992/93 wird Luhmann an der Universität Bielefeld emeritiert. Seine Abschiedsvorlesung widmet sich dem Thema „Was ist der Fall und was steckt dahinter?“ Luhmann stirbt am 6. November 1998 in Oerlinghausen bei Bielefeld.
II. Werke
5
Das Schrifttum Niklas Luhmanns ist so umfangreich und breit gestreut, dass im vorliegenden Zusammenhang eine Konzentration auf eine Auswahl seiner Hauptwerke erfolgen muss.
6
Auf der Grundlage seines systemtheoretischen Ansatzes und der damit verbundenen funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft hat Luhmann in rascher Folge Monographien zu den wichtigsten Funktionssystemen der Gesellschaft vorgelegt. 1988 beginnt diese Reihe mit der „Wirtschaft der Gesellschaft“, an die sich schon 1990 die „Wissenschaft der Gesellschaft“ anschließt. Für den vorliegenden rechtsphilosophischen und rechtstheoretischen Zusammenhang ist dann vor allem seine Untersuchung zum „Recht der Gesellschaft“ (1993) von grundlegender Bedeutung. 1997 folgt die „Kunst der Gesellschaft“ und schon posthum erscheinen im Jahre 2000 die „Politik der Gesellschaft, die „Religion der Gesellschaft“ und das „Erziehungssystem der Gesellschaft“. Auf der Nahtstelle von Politik und Wissenschaft bewegt sich schließlich seine 2010 veröffentlichte „Politische Soziologie“.
7
Von besonderer Bedeutung sind aber sicherlich seine beiden funktionssystemübergreifenden Hauptwerke. Hierzu zählt zunächst seine erste „richtige Publikation“ mit dem Titel „Soziale Systeme“ aus dem Jahre 1984. Nicht ohne Grund trägt diese Monographie den Untertitel „Grundriss einer allgemeinen Theorie“. Luhmann sieht die Soziologie in einer Theoriekrise; Abhilfe könne nur der Entwurf einer fachuniversalen Theorie leisten. Als Ausgangspunkt dienen ihm dabei Ansätze einer Theorie selbstreferentieller, „autopoietischer“ Systeme, die allerdings ein beachtliches Abstraktionsniveau mit sich führten: „Diese Theorieanlage erzwingt eine Darstellung in ungewöhnlicher Abstraktionslage. Der Flug muss über den Wolken stattfinden, und es ist mit einer ziemlich geschlossenen Wolkendecke zu rechnen. Man muss sich dabei auf die eigenen Instrumente verlassen. Gelegentlich sind Durchblicke nach unten möglich – ein Blick auf Gelände mit Wegen, Siedlungen, Flüssen oder Küstenstreifen, die an Vertrautes erinnern; oder auch ein Blick auf ein größeres Stück Landschaft mit den erloschenen Vulkanen des Marxismus. Aber niemand sollte der Illusion zum Opfer fallen, dass diese wenigen Anhaltspunkte genügen, um den Flug zu steuern.“ (Luhmann, SozS, S. 11, 12 f.). Am Ende steht „in einer azentrisch konzipierten Welt und einer azentrisch konzipierten Gesellschaft eine polyzentrische (und infolgedessen auch polykontexturale) Theorie.“ (Luhmann, SozS, S. 14). Sie überträgt das Konzept der selbstreferentiellen Operationsweise auf die Theorie sozialer Systeme.
8
Neben dieser den Bogen weit aufspannenden Theorie ist schließlich – gleichsam als Höhepunkt seines theoretischen Schaffens – Luhmanns „Gesellschaft der Gesellschaft“ (1997) zu nennen. Ausdrücklich nimmt er dabei auf seine Theorie sozialer Systeme Bezug, sollte sie doch eigentlich das systemtheoretische „Einleitungskapitel“ bilden, um daran eine Darstellung des Gesellschaftssystems und der wichtigsten Funktionssysteme der Gesellschaft anzuschließen (Luhmann, GdG, S. 11). Ungeachtet dessen formuliert Luhmann als Leitfrage seiner „Gesellschaft der Gesellschaft“, welche Operation das Gesellschaftssystem produziert und reproduziert, wann immer sie vorkommt. Seine Antwort lautet: Kommunikation. Gesellschaft sei nicht ohne Kommunikation und Kommunikation nicht ohne Gesellschaft zu denken. Theorietechnisch werden die Fragen ihrer Entstehung und Morphogenese der Evolutionstheorie überantwortet. Besondere Bedeutung kommt dabei methodisch der Selbstbeschreibung der Gesellschaft zu, weil diese keine Adresse besitze und deshalb kommunikativ unerreichbar sei. Oder anders ausgedrückt: es geht um Konstruktionen, „die es ermöglichen, in der Gesellschaft zwar nicht mit der Gesellschaft, aber über die Gesellschaft zu kommunizieren.“ (Luhmann, GdG, S. 866 f., Hervorhebung i.O.). Mit der Bewältigung dieser anspruchsvollen Aufgabe hat Niklas Luhmann nicht nur den Gipfel seines wissenschaftlichen Wirkens erreicht, zugleich hat sich damit auch sein Lebenskreis geschlossen. Fast könnte man meinen, er habe 1969 bei seiner Aufnahme in die Bielefelder Fakultät für Soziologie bereits geahnt, welche Lebensspanne ihm für die Verwirklichung seines Projekts einer Theorie der Gesellschaft zugemessen sei.
III. Hauptthesen
9
Für den hier maßgeblichen rechtsphilosophischen und rechtstheoretischen Zusammenhang muss zweifellos Niklas Luhmanns „Recht der Gesellschaft“ (1993) als Ausgangspunkt aller Überlegungen dienen. Daneben dürfen aber einige grundlegende „Vorstudien“ zum Recht der Gesellschaft nicht unberücksichtigt bleiben. Insoweit ist vor allem zu denken an: „Rechtssystem und Rechtsdogmatik“ (1974), „Ausdifferenzierung des Rechts“ (1981), „Die soziologische Beobachtung des Rechts“ (1986) und „Rechtssoziologie“ (3. Aufl., 1987). Auf weitere einschlägige Beiträge Luhmanns in Fachzeitschriften und Sammelbänden wird nachfolgend an jeweils geeigneter Stelle eingegangen.
1. Recht als soziales System
a. Begriff und Funktion
10
Was-Fragen nach dem Wesen der Dinge führen in der Wissenschaft nicht wirklich weiter. So wichtig es deshalb für die Identitätsbildung des Rechtssystems zweifellos ist, dass Rechtsphilosophie und Rechtstheorie stets aufs Neue nach dem Begriff und Wesen des Rechts fragen, so notwendig erscheint es Niklas Luhmann, intensiver über die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft nachzudenken.
11
Funktional betrachtet eröffnet Recht eine zeitliche Dimension, indem Kommunikation „in zeitlicher Extension ihres Sinnes“ an Erwartungen orientiert wird und diese zum Ausdruck bringt. Der Begriff der „Erwartung“ wird zum gleichsam archimedischen Punkt einer funktionalen Betrachtung des Rechts. Erwartung darf dabei nicht als aktueller Bewusstseinszustand irgendeines Individuums verstanden werden, sondern ist auf das Grundelement sozialer Systeme, nämlich Kommunikation, zu beziehen. Geht man davon aus, so thematisiert Erwartung den „Zeitaspekt des Sinnes von Kommunikationen.“ (Luhmann, RdG, S. 125; zum Thema „Recht und Zeit“ siehe insb. Kirste, 1998, passim, vgl. auch Hiller, 1993, passim). Es geht mithin nicht um die Dauer der Normgeltung, nicht um die „immanente Geschichtlichkeit des Rechts“ und auch nicht um das menschliche Verhalten in Raum und Zeit, sondern einzig und allein darum, dass die Funktion des Rechts darin besteht, sich „auf der Ebene der Erwartungen auf eine noch unbekannte, genuin unsichere Zukunft einzustellen.“ (Luhmann, RdG, S. 130). Recht hat es folglich primär mit dem „Aufbau von Erwartungserwartungen“ zu tun. (Gephart, S. 98 f.; Kirste, S. 317).
12
Für Niklas Luhmann bedeutet dies: „Abstrakt gesehen hat das Recht mit den sozialen Kosten der zeitlichen Bindung von Erwartungen zu tun. Konkret geht es um die Funktion der Stabilisierung normativer Erwartungen durch Regulierung ihrer zeitlichen, sachlichen und sozialen Generalisierung.“ Man weiß, was man von anderen erwarten darf und was nicht; man weiß, mit welchen Erwartungen man sich nicht blamiert, aber Überraschungen und Enttäuschungen sind deswegen nicht ausgeschlossen. (Luhmann, RdG, S. 131 f., 151 f.).
13
Eine solchermaßen funktionale Betrachtung des Rechts, die Kommunikation „in zeitlicher Extension ihres Sinnes“ an Erwartungen orientiert und diese zum Ausdruck bringt, hat Konsequenzen für den Normbegriff. Normen erscheinen als Fakten, so dass die eigentliche Theorieleistung darin besteht, wie Normen als Fakten behandelt werden, d.h. wie die theoretische Anschlussfähigkeit der Norm als Faktum realisiert wird. Dies geschieht, indem Normen als kontrafaktische Verhaltenserwartungen begriffen werden. Es geht folglich um Erwartungen, die auch im Falle ihrer Enttäuschung aufrechterhalten werden, so dass auch von normativen Erwartungen gesprochen wird. (Luhmann, Soz. Beobachtung des Rechts, S. 21 f.).
b. Recht und Unrecht
14
Die Unterscheidung von Recht und Unrecht ist für das Rechtssystem von zentraler Bedeutung. Der Positivwert Recht ist nämlich mit größerer Anschlussfähigkeit ausgestattet als der Negativwert Unrecht, d.h. an Recht lassen sich im Vergleich zum Unrecht mehr Kommunikationen anschließen (Luhmann, Codierung, 177 f.). Dies findet seine Ursache aber nicht etwa in einer ideal existierenden Werthaftigkeit bzw. Wertwidrigkeit der Werte, sondern einzig und allein in der Differenz ihrer Anschlussfähigkeit. Damit ist nicht nur ein utilitaristisch größerer Nutzen des Codewerts Recht gemeint. Vielmehr knüpfen sich moralische Achtung, politischer Einfluss und sozialer Kontakt, also Partizipation an Gesellschaft schlechthin, in spezifischer Weise an das „Recht“. Der Code Recht/Unrecht ist demzufolge durch eine Asymmetrie kommunikativer Anschlussfähigkeit gekennzeichnet.
15
Codierung ist ohne Programmierung nicht denkbar (Zum Folgenden s. Luhmann, RdG, S. 165 ff.; ders., Codierung, 194 ff.). Letztere füllt erstere mit Inhalt; nur gemeinsam ermöglichen sie die Einheit eines autopoietischen Systems. Dies gilt auch für die Codierung und Programmierung des Rechtssystems. Die Strukturform des Recht/Unrecht-Codes steht dabei für zeitliche Invarianz und Anpassungsfähigkeit des Rechtssystems; seine Programme hingegen lassen die notwendige Differenz von Änderbarkeit und Nichtänderbarkeit zu. Im Kontingenzraum, den der Code des Rechtssystems eröffnet, sind die Programme darauf spezialisiert, die Zuteilung der Codewerte zu regeln. Sie entscheiden über die „richtige“ Bestimmung von Recht und Unrecht, bieten aber unter Verzicht auf jeden Apriorismus ihrer Vernunft (z.B. die Geltung einer Grundnorm oder eines höherrangigen Sittengesetzes) lediglich Gesichtspunkte des „Richtigen“ an und stehen nicht für das absolut „Richtige“. Gerade deshalb müssen Programme - im Gegensatz zum Code – von Zeit zu Zeit modifiziert werden.
16
Die Programme des Rechtssystems sind Konditionalprogramme (Luhmann, RdG, S. 195 ff.). Dies hängt mit der Funktion des Rechts zusammen, nämlich der Stabilisierung normativer Erwartungen durch Regulierung ihrer zeitlichen, sachlichen und sozialen Generalisierung. Danach werden Erwartungen für den Fall ihrer Enttäuschung in die Form von Normen gebracht. Wenn man in der Gegenwart wissen und entscheiden will, ob Erwartungen berechtigt sind, so lässt sich dies nur durch Konditionalprogramme gewährleisten. Für das Recht sind hier vor allem Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung und Verwaltungsvorschrift zu nennen (Siehe dazu insb. Ossenbühl, Hdb. StaatsR III, §§ 61, 63, 64, 65). Darüber hinaus erfüllen aber ganz selbstverständlich jeder Verwaltungsakt, jede Gerichtsentscheidung und jeder Vertrag den Charakter eines Konditionalprogramms im Rechtssystem. Kurzum: es geht um das positive Recht (Luhmann, Codierung, 197). Dadurch, dass nur dieses über die Zuordnung zum Recht/Unrecht-Code des Rechtssystems entscheidet, wird ausgeschlossen, dass künftige, im Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht feststehende Tatsachen entscheidungsrelevant werden. Recht macht sich demnach nicht von der Zukunft abhängig.
17
Ganz überwiegend bestimmen Konditionalprogramme, d.h. solche Programme, die Bedingungen festlegen, nach denen sich die Zuschreibung des Codewertes Recht oder Unrecht richtet, das Rechtssystem. Dennoch gibt es aber Einbruchstellen für Zweckprogramme im Rechtssystem, d.h. für final ausgerichtete Programme, bei denen sich die Zuschreibung des Codewertes am erwünschten Ziel orientiert. Ein Beispiel dafür ist die sog. vorausschauende Rechtsberatung, bei der man sich vorstellt, wie ein in Gang gesetzter Rechtsstreit möglicherweise entschieden wird und mit Bezug darauf die Konditionen seiner Entscheidung festzulegen versucht (Luhmann, RdG, S. 197). So wird etwa ein kluger Strafverteidiger in Erwartung einer Verurteilung seines Mandanten versuchen, mit dem Gericht für den Fall eines vollumfänglichen Geständnisses ein Strafhöchstmaß zu vereinbaren. Des Weiteren sind hier Ermessensnormen zu nennen, die sich als final programmiert darstellen, weil die Behörde entsprechend dem Zweck der erteilten Ermächtigung von ihrem Ermessen Gebrauch zu machen hat. Hiervon zu unterscheiden sind aber wiederum, obwohl bisweilen in ein und derselben Norm zu finden, „unbestimmte Rechtbegriffe“ mit Beurteilungsspielraum (z.B. „Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“, „Stand von Wissenschaft und Technik“), die sich als Bestandteil von Konditionalprogrammen erweisen. So kann z.B. die Polizei im Freistaat Sachsen gemäß § 3 Abs. 1 PolG innerhalb der durch das Recht gesetzten Schranken die „erforderlichen Maßnahmen“ (Finalprogrammierung) treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende „Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung“ (Konditionalprogrammierung) abzuwehren.
18
Mögen die Einbruchstellen für Zweckprogramme im Rechtssystem gerade im (untergegangenen) Wohlfahrtsstaat und im (real existierenden) Risiko- und Präventionsstaat besonders ausgeprägt sein, so bleibt die Relevanz der Recht/Unrecht-Codierung davon dennoch unberührt. In gleicher Weise gilt dies für die sie flankierende Konditionalprogrammierung des Rechtssystems.
c. Recht und Gerechtigkeit
19
Gerechtigkeit tritt den Kontingenzformeln anderer Sozialsysteme zur Seite und zieht die Konsequenz daraus, dass die Voraussetzungen eines naturrechtlichen Gerechtigkeitsbegriffs ein für allemal entfallen sind. Ob wir es nun begrüßen oder nicht, an der Erkenntnis, dass in der modernen Gesellschaft Gerechtigkeit nicht mehr als „Perfektionsbegriff“ (Luhmann, Gerechtigkeit, 131, 134) - sei es als Tugend, Prinzip, Idee oder Wert - verstanden werden kann, führt kein Weg vorbei.
20
Gerechtigkeit erscheint vielmehr lediglich als „Schema der Suche nach Gründen oder Werten, die nur in der Form von Programmen Rechtsgeltung gewinnen können.“ (Luhmann, RdG, S. 223). Die besondere Schwierigkeit der Kontingenzformel Gerechtigkeit liegt im Verhältnis von Generalisierung und Respezifikation begründet. Von jeder Operation im Rechtssystem muss einerseits erwartet werden, dass sie gerecht ist, anderenfalls ginge nämlich der Bezug der Gerechtigkeit als Norm zur Einheit des Rechtssystems verloren. Andererseits muss Gerechtigkeit als Norm eine Einzelfallorientierung vermitteln, wobei aber nicht allein aus der Zugehörigkeit der Operation zum Rechtssystem resultieren darf, dass sie als gerecht zu betrachten ist (Luhmann, RdG, S. 222). Insgesamt erscheint Gerechtigkeit damit als ein eben nicht in Einheit kurzzuschließender wertneutraler Differenzbegriff, dessen andere Seite die durch Ausschluss eingeschlossene Ungerechtigkeit ist.
21
Operationalisiert wird dieses Verständnis von Gerechtigkeit dadurch, dass es in erster Linie um die Konsistenz rechtlichen Entscheidens geht (Luhmann, RdG, S. 223, 225, 227 ff.). Konsistenz meint dabei formale Gleichheit in dem Sinne, wie es das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung in die Formel fasst, dass „weder wesentlich Gleiches willkürlich ungleich, noch wesentlich Ungleiches willkürlich gleich“ behandelt werden dürfe. Willkürlich ist danach ein Handeln, das sich nicht am Gerechtigkeitsgedanken orientiert. Lange Zeit war dies der Fall, wenn sich für das Handeln keine vernünftigen Erwägungen finden ließen, die sich aus der Natur der Sache ergaben oder sonst einleuchtend waren. Schließlich war Willkür „im objektiven Sinn zu verstehen als eine Maßnahme, welche im Verhältnis zu der Situation, der sie Herr werden wollte, tatsächlich und eindeutig unangemessen“ war. Seit Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist das Bundesverfassungsgericht dann im Sinne der sog. „neuen“ Formel dazu übergegangen, einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot anzunehmen, „wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten.“ (Siehe dazu mit Nachweisen auf die Rechtsprechung Heun, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, 2. Aufl., 2004, Art. 3 Rn. 19 ff.).
22
Sicherlich geht damit eine „strikte Formalisierung von Gerechtigkeit“ (Osterkamp, Juristische Gerechtigkeit, S. 126) einher und zweifellos verlagert sich auf diese Weise das Problem der Gerechtigkeit von der Einzelfallgerechtigkeit zur konsistenten Zuordnung verschiedener Fälle (Luhmann, RdG, S. 357). Wer das aber zum Anlass für Kritik an einem solchen Ansatz nimmt, sollte sich dann auch klar und deutlich zu einem rechtsphilosophischen/rechtstheoretischen Verständnis von Gerechtigkeit als „materiale Richtigkeit des Rechts“ bekennen (Osterkamp, Juristische Gerechtigkeit, S. 126 ff.). Will man dem jedoch mit guten Gründen nicht Folge leisten, so erscheint ein formales Verständnis von Gerechtigkeit nicht zuletzt deshalb als vorzugswürdig, weil es Philosophie und Politik in der Domäne des Rechts gleichermaßen auf Distanz hält. Nur das Recht vermag die „geordnete Speicherung kollektiv verbindlicher Entscheidungen, die stete Systematisierung kollektiv verbindlicher Entscheidungen, die Bewahrung institutioneller Formtypik, den formell kontrollierten Einzelfallbezug und die Anwendungsgleichheit“ zu garantieren (Di Fabio, Das Recht offener Staaten, S. 155). Gleichheit im Sinne konsistenten Entscheidens steht dann durch seine Argumentationshorizonte und Operationsmethoden für voraussehbare Regelhaftigkeit und gegen unberechenbare Beliebigkeit (Ders., ebd., S. 149).
23
Maßgebliche Grundlage dieser Operationalisierung formaler Gerechtigkeit im Sinne der Konsistenz rechtlichen Entscheidens sind die Konditionalprogramme des Rechts. Sie ermöglichen es, Rechtsfragen vom Vorliegen bestimmter Tatbestandsmerkmale abhängig zu machen und Selektionen in die entscheidungstechnisch günstige Form eines binären Schemas zu bringen (Luhmann, Gerechtigkeit, 149). Dieses Wenn-Dann-Schema erweist sich bei der Arbeit mit dem Gleichheitssatz (gleich/ungleich-Differenz) nicht nur als hilfreich, sondern konditionale Programmierung ist Voraussetzung dafür, dass die „Idee der Gerechtigkeit überhaupt in die Form der Gleichheit (=Regelhaftigkeit) gebracht werden kann.“ (Luhmann, RdG, S. 231).
24
Bei der Arbeit mit den Konditionalprogrammen des Rechts kommt der Rechtsdogmatik im Hinblick auf den Gerechtigkeitsgedanken eine besondere Aufgabe zu. Diese besteht rechtssystemintern in dem „Bemühen um begriffliche Konsistenz, um ein Testen der Verallgemeinerbarkeit von Prinzipien, Begriffen oder Entscheidungsregeln, also um "Amplifikation", und dann um Korrektur zu weit gehender Generalisierungen, vor allem durch das Regel/Ausnahme-Schema.“ (Luhmann, RdG, S. 11). Der Sinn dieser Operationen ist darin zu sehen, dass die Rechtsdogmatik nicht etwa den ohnehin feststehenden Rechtsstoff bloß fixiert, sondern diesen begrifflich-klassifikatorisch durcharbeitet und damit verwendungsfähig aufbereitet (Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, S. 16 m.w.N.). Auf diese Weise wird die Rechtspraxis nicht nur der konkreten Entscheidungssituation gerecht, sondern weiß sich dem gesamten Rechtssystem verpflichtet. Dies verhindert, dass sie sich gleichsam aus der Rechtsordnung „hinausspiralt“ (Ders., ebd., S. 18).
25
Die derart konkretisierte „Konsistenz des Entscheidens“ muss sich schließlich zusätzlich durch ihre „adäquate Komplexität“ auszeichnen (Luhmann, RdG, S. 225; ders., Gerechtigkeit, 144 ff.). Sie meint in der Sprache der Systemtheorie schlicht „Irritabilität“ (Luhmann, RdG, S. 225). Selbstverständlich kann dies nicht bedeuten, dass sich das Rechtssystem gegenüber dem Gesellschaftssystem als in jeder Hinsicht offen und allen Anforderungen gegenüber empfänglich erweist. Denn wie jedes andere soziale System auch, muss das Rechtssystem seine Komplexität reduzieren und seinen eigenen Komplexitätsaufbau schützen. Dem Erfordernis der Gerechtigkeit entspricht diese „interne Komplexität“ allerdings nur, soweit sie sich mit der Eigenschaft der „Entscheidungskonsistenz“ als noch kompatibel erweist (Luhmann, RdG, S. 225 f.). Und vor diesem Hintergrund ist es dann auch tatsächlich richtig, wenn zwischen dem Merkmal der „Konsistenz des Entscheidens“ und demjenigen der „adäquaten Komplexität“ ein Zusammenhang gesehen wird. Letzteres meint eben nicht einfach bloß „Umweltanpassung“ des Rechtssystems, sondern eine solche, die die internen Systemanforderungen – Konsistenz des Entscheidens – mitberücksichtigt. Im Sinne einer „notwendigen“ Bedingung ist die Ermöglichung konsistenten Entscheidens Voraussetzung für „adäquate Komplexität“ (zutreffend insoweit Osterkamp, Juristische Gerechtigkeit, S. 132 f.).
26
Irritabilität des Rechtssystems erfordert kognitive Offenheit, d.h., dass sich das Rechtssystem seiner Umwelt gegenüber öffnen muss, um Informationen aus dieser zu verarbeiten. Gleichzeitig aber tritt eine operative Geschlossenheit des Rechtssystems hinzu, d.h., dass es zur Herstellung eigener Operationen auf das Netzwerk eigener Operationen angewiesen ist und sich in diesem Sinne selber reproduziert. Dies bedeutet weder, dass das Rechtssystem beliebig offen ist, noch dass es hermetisch geschlossen ist. Es ist vielmehr offen und geschlossen zugleich (Di Fabio, Das Recht offener Staaten, S. 150). Nur auf diese Weise bewahrt es in der offenen Auseinandersetzung mit seiner Umwelt seine „Identität“; nur so behält es die „Herrschaft“ darüber, „in welcher Dosis und welcher Form gesellschaftliche Ereignisse und Zumutungen Berücksichtigung finden.“ (Ders., ebd.). Voraussetzung dieses durch kognitive Offenheit und operative Geschlossenheit gekennzeichneten Verhältnisses des Rechtssystems zu seiner Umwelt ist ein „eigener grundsätzlich invarianter, aber nicht unveränderlicher Kommunikationskontext, in den jede Entscheidung eingepasst werden kann und aus dem sie ihre Begründung erfährt.“ Dabei kann es sich um „Gesetze, höchstrichterliche Entscheidungen, Rechtsgrundsätze oder Lehrgebäude der Rechtswissenschaft“ handeln (Ders., ebd., S. 150 f.). Auf diese Weise bewahrt das Rechtssystem auch zukünftig die Kontrolle über den eigenen Argumentationskontext.
2. Ausdifferenzierung des Rechtssystems
a. Evolution des Rechts
27
Zu den (Bewegungs)Mechanismen der Evolution im Allgemeinen und des Rechtssystems im Besonderen zählen Variation, Selektion und Stabilisierung (Luhmann, GdG, S. 456 ff.; 498 ff.; ders., RdG, S. 257 ff.; ders., Evolution, S. 16 ff.). Sämtlich beziehen sie sich auf das System: Variation auf die Elemente (Ders., GdG, S. 456-472), Selektion auf die Struktur (Ders., ebd., S. 473-484) und Stabilisierung auf die Einheit des Systems (Ders., ebd., S. 485-497). Mit Hilfe dieses evolutionstheoretischen Instrumentariums beobachtet man, „welches die Bedingungen der Möglichkeit waren, dass Recht so wurde, wie wir es in jeweiligen historischen und gegenwärtigen Situationen vorfinden.“ (Fögen, Römische Rechtsgeschichten, S. 17).
28
„Variation eines autopoietischen Elements im Vergleich zum bisherigen Muster der Reproduktion“ (Luhmann, RdG, S. 242) vollzieht sich durch unerwartete, gleichsam überraschende Kommunikation im Rechtssystem, d.h., zum Beispiel dann, wenn Umweltereignisse (technische Erfindungen, politische Umstürze etc.) das Rechtssystem irritieren und zur Variation im Recht provozieren (z.B. die mit der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands verbundenen Änderungen im Verfassungs- und Gesetzesrecht der Bundesrepublik Deutschland). Solche Variation im Recht ist die Grundvoraussetzung aller Evolution, nicht zu prognostizieren, aber zumindest zu rekonstruieren (Fögen, Rechtsgeschichte, 15).
29
„Selektion“ der mit der Variation verbundenen Möglichkeiten der Veränderung im Recht bedeutet, dass aus der Vielzahl der Möglichkeiten eine und eben nicht eine andere ausgewählt und auf der Grundlage der Recht/Unrecht-Unterscheidung markiert wird (Zu den Schwierigkeiten der Abgrenzung von Variation und Selektion Luhmann, RdG, S. 257; ders., ebd., Evolution, S. 16). So wie im 19. Jahrhundert der Dampfkessel zum „Rechtsproblem“ wurde, gilt dies etwa im 20. Jahrhundert für den Computer und das Internet. Selektion ist kontingent, aber nicht beliebig, weil sie nämlich an vorangegangene Selektion und damit verbundenen Strukturaufbau gebunden bleibt.
30
„Stabilisierung“ des Systems erfolgt über die Einfügung des selegierten neuen Elements in die vorhandene Struktur. Für das Rechtssystem wird diese Funktion ganz maßgeblich von der Rechtsdogmatik wahrgenommen (Luhmann, RdG, S. 265 ff.). Dadurch gelingt es, den Überraschungswert künftiger und ähnlicher Umweltirritationen zu mindern, gleichzeitig aber neue Komplexität aufzubauen. Der evolutorische Prozess ist damit zunächst am Ende, aber nur um sofort als Anfang neuer Variation und Selektion zu dienen. Im Sinne dynamischer Stabilität geht es also um das Weiterführen der autopoietischen, strukturdeterminierten Reproduktion in geänderter Form (Fögen, Rechtsgeschichte, 16).
31
Vor diesem Hintergrund werden im Rechtssystem Normativität (Variation), Verfahren (Selektion) und Rechtsdogmatik (Stabilisierung) als Evolutionsmechanismen wirksam (Luhmann, Evolution, S. 17 ff.; ders, RdG, S. 261 ff.). Normen als enttäuschungsfeste, kontrafaktisch stabilisierte Verhaltenserwartungen sind dabei für die Evolution des Rechtssystems nachgerade unverzichtbar. Die damit fast zwangsläufig einhergehende Vermehrung wechselseitiger Enttäuschungen und Rechtsstreitigkeiten lässt eine Vielzahl widerstreitender individueller Normprojektionen sichtbar werden. Das Recht mutiert.
32
Aus dem Übermaß an miteinander nicht zu vereinbarenden und nicht zugleich durchsetzbaren normativen Erwartungen muss sodann durch Selektion bestimmt werden, welche Auffassung dem geltenden Recht entspricht. Dabei sind die Selektionsmechanismen des Rechts grundsätzlich nicht unabhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern variieren gleichsam mit ihr. Besaßen diese in der archaischen Gesellschaft, aber auch noch in der bürgerlichen Gesellschaft (Dazu Frevert, Ehrenmänner, passim) vornehmlich Kampfcharakter, so sind in der funktional ausdifferenzierten, hochkomplexen Gesellschaft der Moderne leistungsfähigere Selektionsmechanismen (Strafrecht und Strafverfahren statt des Duells, siehe dazu Amelung, Ehre, passim) an ihre Stelle getreten. Gemeint sind Interaktionssysteme (Siehe dazu Kieserling, passim), insbesondere Verfahren (Luhmann, Legitimation durch Verfahren, S. 55 ff.; 137 ff.; 201 ff.), in denen die Bewältigung normativer Konflikte verhandelt werden kann (Luhmann, RdG, S. 260; ders., Evolution, S. 18 f.). Als kurzfristig eingerichtete, auf ein Ende hin konstruierte Sozialsysteme kommt ihnen die besondere Funktion zu, Entscheidungen zunächst aufzuschieben (Latenzfunktion) und eine Zeitlang im Ungewissen zu operieren, dabei Partizipationsbeiträge der Verfahrensteilnehmer zu provozieren, bevor dann verbindlich entschieden wird; mit der Konsequenz, dass die Verfahrensteilnehmer schließlich angesichts ihrer Mitwirkung am Verfahren nur geringe Chancen besitzen, die Legitimität desselben in Frage zu stellen (Luhmann, RdG, S. 208 f.).
33
Evolution des Rechts ist Ko-Evolution. Sie geht davon aus, dass die Stabilität von Gesellschaft auf einer mehr oder minder austarierten Balance ihrer unterschiedlichen Funktionsbereiche beruht. Wechselseitige strukturelle Angewiesenheiten kennzeichnen deshalb das Verhältnis von Recht und Politik, Politik und Wissenschaft, Recht und Wirtschaft oder Wirtschaft und Erziehung. In der modernen, funktional ausdifferenzierten Gesellschaft wird diese Aufgabe vornehmlich von strukturellen Kopplungen der unterschiedlichen Sozialsysteme wahrgenommen. Sie ermöglichen und erleichtern die Ko-Evolution sozialer Systeme.
34
Emergenz und Zufall werden dabei zu maßgeblichen Faktoren evolutionären Denkens. Emergenz meint das „Benutzen oder Ausnutzen der Vergangenheit (in Form vorhandener Elemente), markiert jedoch zugleich den Bruch mit der Vergangenheit durch das Entstehen einer neuen Eigenschaft, die nicht in den ursprünglichen Elementen enthalten und nicht auf sie zurückzuführen ist.“ (Fögen, Zufälle, Fälle und Formeln, S. 85 f. m.w.N.). Es geht um eine „Momentaufnahme, um die Rekonstruktion einer Situation in der systemeigenen Evolution“, in der irgendwo, irgendwann und irgendwie z.B. der Vertragsgedanke, der Schutz privaten Eigentums oder eben der Wissenschaft und Wissenschaftsrecht bis heute prägende Gedanke der Wissenschaftsfreiheit entstand. Zufall – verstanden als „differenztheoretischer Grenzbegriff“ – ist „eine Form des Zusammenhangs von System und Umwelt, die sich der Synchronisation (also auch der Kontrolle, der "Systematisierung") durch das System entzieht.“ Es stellt die Fähigkeit desselben dar, „Ereignisse zu benutzen, die nicht durch das System selbst (also nicht im Netzwerk der eigenen Autopoiesis) produziert und koordiniert werden können.“ (Luhmann, GdG, S. 449 f.). Aus der Sicht des Rechts sind deshalb etwa politische Umstürze, wirtschaftliche Zusammenbrüche oder technische Neuheiten schlicht „Gefahren, Chancen, Gelegenheiten“, auf die das Rechtssystem in seiner Kommunikation reagieren kann, aber nicht muss. Umweltanstöße dieser Art – also Zufälle – treffen dabei stets auf ein bereits evoluierendes System und werden von diesem unter Ausnutzung seiner Autopoiesis umgearbeitet. Strukturelle Kopplungen sozialer Systeme gestatten es dann, die vom System wahrgenommenen Irritationen zu kanalisieren (Luhmann, RdG, S. 285).
35
Das „Ergebnis“ der Evolution des Rechts ist denkbar einfach, es lautet: Positivität des Rechts (Luhmann, RdG, S. 38 ff., 280 f.; ders., Soz. Beobachtung des Rechts, S. 24 ff.). Das heißt, das Recht macht sich unabhängig von jeder externen Geltungsgarantie – sei es „Natur“ oder „Vernunft“ – und bindet sich einzig und allein an die laufende Produktion von Rechtstexten. Aus ihnen wird ersichtlich, was Rechtsgeltung beansprucht und was nicht (Luhmann, RdG, S. 280 f.). Irritationen in der Umwelt des Rechtssystems mag dieses zum Anlass nehmen, das geltende Recht zu ändern. Jede Rechtsentscheidung (z.B. jeder Verwaltungsakt) und jeder Rechtsetzungsakt (z.B. Gesetz oder Verordnung) verändern in diesem Sinne die Rechtslage und damit zugleich die Strukturen des Rechts. Kontrolle ist über diese Dynamik nicht zu behalten. Es bedarf ihrer aber auch nicht, denn an ihre Stelle tritt: Autopoiesis (Stichweh, Selbstorganisation, 269 f.).
b. Hierarchie des Rechts
36
Die Unterscheidung von Zentrum und Peripherie, die Niklas Luhmann als vierte Differenzierungsform der Gesellschaft neben segmentäre, stratifikatorische und funktionale Differenzierung treten lässt (Luhmann, GdG, S. 612 f., 663 ff.), wird ihm auch für das Rechtssystem zur Richtschnur bei der Behandlung der Frage nach der Hierarchie des Rechts. Allerdings: Genau so wenig wie die Zentrum/Peripherie-Differenz hierarchisch gedacht werden darf (S. dazu bereits Luhmann, Politische Theorie, S. 22), ohne damit stratifikatorische Differenzierung im Zentrum gesellschaftlicher Funktionssysteme auszuschließen, sollte sie räumlich (global, regional, lokal) verstanden werden (Luhmann, RdG, S. 321 Fn. 50). Geboten erscheint vielmehr ein funktionales Verständnis der Unterscheidung von Zentrum und Peripherie.
37
So besteht heute bspw. kein Zweifel mehr daran, dass Rechtsetzung und Rechtsprechung, Gesetzgeber und Gerichte, als autonome, arbeitsteilig zusammenwirkende Organisationen mit der fortlaufenden (autopoietischen) Normproduktion im Rechtssystem befasst sind (Zum Verhältnis von Gesetzgebung und Rechtsprechung in historischer Perspektive s. Luhmann, Die Stellung der Gerichte, 459 ff.; ders., RdG, S. 299 ff.;), wodurch sich ganz von selbst ein hierarchisches (rangmäßiges) Verständnis ihrer Unterscheidung verbietet. Gleiches gilt für die Vorstellung einer unterschiedlichen gesellschaftlichen Relevanz. Weder sind die Gerichte wichtiger als der Gesetzgeber noch kommt der Gesetzgebung eine größere Bedeutung zu als der Rechtsprechung. Vielmehr geht es einzig und allein darum, dass im Zentrum des Rechtssystems andere Funktionen als in der Peripherie desselben wahrgenommen werden (Luhmann, Die Stellung der Gerichte, 459, 469 f., ders., RdG, S. 323; ders., PdG, S. 251). Zentrum und Peripherie bilden von daher die zwei Seiten einer Form, die aber nur dadurch einzurichten ist, dass im Zentrum in funktionsspezifischer Hinsicht genau das Gegenteil von dem gilt, was in der Peripherie gilt (Ders., Die Stellung der Gerichte, 459, 470). Und dies ist das Verbot der Justizverweigerung, das eben nur für die Gerichte Geltung besitzt. Als „Grundnorm der Gerichtsbarkeit“ ist es in der Form einer „inhaltsleeren doppelten Negation“ konzipiert: Dem Richter ist nicht erlaubt, nicht zu entscheiden (Ders., ebd., 459, 467).
38
Funktional betrachtet obliegt dem Verbot der Justizverweigerung die Wahrung der Einheit und Komplexität des Rechtssystems, d. h., es geht ihm um die Erhaltung der Einheit des Rechtssystems auch unter den Bedingungen wachsender Komplexität (Luhmann, PdG, S. 429 f.). Das Justizverweigerungsverbot dient damit dem Paradoxiemanagement des Rechtssystems (Luhmann, RdG, S. 320). Indem den Gerichten ein „non liquet“ untersagt ist, gelingt es ihnen, die Paradoxie der unentscheidbaren Entscheidung zu invisibilisieren (Huber, Systemtheorie, S. 166 ff., 171). Die Komplexität des Rechtssystems wird gesteigert, ohne allerdings gleichzeitig seine Funktionserfüllung zu beeinträchtigen. Als Zentralorganisationen des Rechtssystems lassen die Gerichte nämlich im Sinne der Komplexitätssteigerung Irritationen aus der Peripherie (z.B. Gesetzes- und Vertragsrecht) durchaus zu, treffen aber zugleich weiterhin die funktionsrelevanten Entscheidungen über Recht und Unrecht (Lieckweg, Recht der Weltgesellschaft, S. 104 f.).
39
Diese Sonderstellung der Gerichte im Rechtssystem macht zugleich deutlich, dass das Rechtssystem als Ganzes nicht hierarchisch strukturiert sein kann. Dafür ist es operativ und strukturell viel zu komplex sowie zeitlich viel zu dynamisch (Luhmann, Die Stellung der Gerichte, 459, 470). Deshalb sieht sich die Rechtsdogmatik auch genötigt, in ihre Selbstbeschreibung „Rückkopplungsschleifen, Resymmetrisierungen, rekursiv operierende Netzwerke etc.“ (Ders., PdG, S. 250 m. Fn. 34) einzubauen. Überzeugender erscheint es aber von einer „Differenzierung von Differenzierungsformen“ (Ders., PdG, S. 251; ders., RdG, S. 323 f.; ders., Die Stellung der Gerichte, 459, 470) auszugehen, der zufolge sich nur im Zentrum Hierarchien ausbilden, während die Peripherie zur Wahrung höherer Komplexität segmentär differenziert bleiben kann. Nur die Gerichte bilden eine Hierarchie. Nur sie kennen mehrere Instanzen: unterste und oberste Gerichte. Nur hier wird der Entscheidungszwang entfaltet und tendenziell nach oben verlagert. In der Peripherie des Rechts hingegen kann es zu einer „Parallelisierung und Vernetzung von gesetzlicher und vertraglicher Geltungsproduktion“ (Ders., RdG, S. 324) kommen.
40
Und die Differenz von Zentrum und Peripherie des Rechtssystems trägt auch unter den veränderten Bedingungen von Europäisierung und Globalisierung sowie einer „Verlagerung der organisierten Normbildung“ in die Peripherie des Rechtssystems (S. dazu insb. Lieckweg, Recht der Weltgesellschaft, S. 105). Mit letzterer schwingt unterschwellig offenbar die Annahme eines Bedeutungsunterschiedes von Zentrum und Peripherie mit, und zwar in dem Sinne, dass das Zentrum grundsätzlich wichtiger sei als die Peripherie. Zur „Bedeutung“ von Zentrum und Peripherie will die Differenz aber gerade keine Aussagen treffen. Mit ebenso guten Gründen ließe sich nämlich die Peripherie für wichtiger halten, weil sich dort das Ausmaß an Umweltsensibilität (Irritabilität) entscheide, das sich ein System im Verhältnis zur Umwelt leisten könne. Deshalb dürfte schon die Frage falsch gestellt sein (Luhmann, GdG, S. 251). Die Differenz bleibt vielmehr einzig und allein eine funktionale: nur die Gerichte unterliegen dem Entscheidungszwang und nur sie treffen die letztverbindlichen funktionsrelevanten Entscheidungen über Recht und Unrecht. Und dass Europäisierung und Globalisierung des Rechts Auswirkungen auf die Hierarchieverhältnisse zwischen den Organisationen des Zentrums zeitigen, sei ganz unbestritten. Schon lange besitzen die letztinstanzlichen nationalen Gerichte nicht mehr das letzte Wort, wenn es darum geht, endgültig Rechtsfrieden herzustellen. Mehr und mehr gerät das nationale Rechtschutzmonopol, z.B. über Art. 267 AEUV, unter Druck. Diese „Streckung“ der Hierarchie im Zentrum des Rechtssystems, stellt sie aber als solche nicht grundsätzlich in Frage.
c. Rationalität des Rechts
41
Systemrationalität ist die adäquate Reaktion auf die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Wenn mit Grund davon auszugehen ist, dass die Gesellschaft kein evolutorisch in Vorsprung gegangenes Teilsystem (auch kein Leitsystem) mehr kennt (a.A. mit Blick auf das Wirtschaftssystem Di Fabio, Recht offener Staaten, S. 110 f.), dann heißt es von einer „einheitlichen Rationalitätsprätention“ (Luhmann, GdG, S. 185; ders., Rationalität, S. 186, 202) Abschied nehmen. Dass die einzelnen Funktionssysteme je für sich die Einheit der Differenz von System und Umwelt zu reflektieren suchen, steht auf einem anderen Blatt. Entscheidend ist es nur, die Systemreferenzen auseinander zu halten. Dies schließt es eben aus, dass ein Funktionssystem der Gesellschaft diese als solche in sich reflektiert. Denn dann müsste dieses auch die Operationsbeschränkungen sämtlicher anderer Funktionssysteme der Gesellschaft mitreflektieren.
42
Luhmanns Verständnis von Systemrationalität ist ein streng differenztheoretisches (Luhmann, GdG, S. 178, 185). Das heißt: Systeme, die ihren Beobachtungen die eigene Differenz zur Umwelt als Differenz von Selbst- und Fremdreferenz zugrunde legen, dürfen als rational bezeichnet werden (Ders., Rationalität, S. 186, 208 ff.). Damit wird eine Unterscheidung der Realität ausgesetzt und an ihr getestet (Ders., GdG, S. 184). Mit Blick auf normative Kommunikation am Maßstab des Codes Recht/Unrecht verlangt dies zunächst den Re-entry, also den Wiedereintritt, der System/Umwelt-Differenz als Selbst- und Fremdbeschreibung im Rechtssystem (durch Rechtspraxis, Rechtsdogmatik, Rechtsphilosophie/Rechtstheorie). Um als rational bezeichnet werden zu können, ist dies aber noch zu wenig. Hinzukommen muss die selbstreferentielle Verwendung des Begriffs der Differenz, indem im Rechtssystem eine Reflexion auf die Einheit der Differenz von System und Umwelt (durch Rechtsphilosophie/Rechtstheorie) erfolgt (Ders., SozS, S. 640). Gerade in der Erhaltung und Ausnutzung dieser Differenzen dürften die Rationalitätschancen für die Gesellschaft und ihre Funktionssysteme zu sehen sein.
43
Die Rechtspraxis gewährleistet Rationalität im Rechtssystem (d.h. bezogen auf Gesetzgebung und Rechtsprechung) im Wesentlichen über Organisation und Verfahren (S. dazu insb. Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht, S. 84 ff.). Dies macht schon ein erster kursorischer Blick auf staatliche Rechtsetzung und Rechtsprechung deutlich. Gesetzgebungsorgane (Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident), Sachverständigengremien (Enquetekommisionen, Wissenschaftliche Beiräte) und Evaluationseinrichtungen (Normenkontrollrat, Büro für Gesetzesfolgenabschätzung) gehören dazu für die Gesetzgebung genauso wie Gerichte, Schöffen und sachverständige Gutachter für die Rechtsprechung. Normative Vorgaben für das Gesetzgebungs- und Gerichtsverfahren (Art. 76 ff. GG, Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages; Art. 92 ff. GG, Gerichtsverfassungsgesetz, Prozessordnungen etc.) treten flankierend hinzu und Planungsinstrumente (Haushaltsplan; Geschäftsverteilungsplan) tun ihr übriges.
44
Die Rechtsdogmatik hat es bei diesem oberflächlichen Befund verständlicherweise nicht bewenden lassen. Will man Rationalität nicht bloß als „Anforderungsbündel“ von „Konsistenz, Kohärenz, Begründbarkeit, empirische Wahrheit, Effektivität, Optimierung und Reflexivität, unter Ungewissheitsbedingungen auch Revisibilität“ (Reimer, Parlamentsgesetz, S. 536) verstehen, so kommt es entscheidend darauf an, die Aspekte formaler und materieller Rationalität kleinzuarbeiten (Grundlegend dazu Schulze-Fielitz, Theorie und Praxis, S. 480 ff., 514 ff.). Eine „pragmatische“ Betrachtungsweise materieller Rationalität lässt dabei die Förderung des Alternativendenkens (z.B. durch Alternativgesetzentwürfe und die Aktivierung externen Sachverstandes) sowie die Sicherung rationaler Prognosen (z.B. durch die Ausschöpfung aller erreichbaren bzw. zugänglichen Erkenntnisquellen, durch ein Mindestmaß an empirisch-analytischem Sachverhaltswissen, durch Kostenanalysen) und pluraler Abwägungsprozeduren (z.B. durch eine ausgewogene Zusammensetzung von Sachverständigenkommissionen, durch Betroffenen-Analysen, durch plurale Anhörungen) sichtbar werden. Als formale Rationalitätskriterien erscheinen demgegenüber die Begründung von Entscheidungen (z.B. Gesetzesbegründung), Zweckbestimmungsklauseln in Gesetzen, rechtsdogmatische Konsistenz, gesetzgeberische Kontinuität, die Vernetzung von Gesetzesregeln sowie Sachangemessenheit und Verständlichkeit (S. dazu ders., ebd. und im Anschluss daran Horn, Experimentelle Gesetzgebung, S. 263 ff.).
45
Darüber hinaus verlangt Systemrationalität die selbstreferentielle Verwendung der System/Umwelt-Differenz im Sinne einer im Rechtssystem erfolgenden Reflexion auf die Einheit der Differenz von System und Umwelt. Diese Aufgabe wird in der Rechtsphilosophie/Rechtstheorie seit langem von der sog. juristischen Begründungslehre wahrgenommen. Begründung als Bestandteil von Argumentation meint ein Handeln, das darauf gerichtet ist, jemanden von der Berechtigung einer Behauptung und damit von der Richtigkeit des Behaupteten zu überzeugen (Dazu und zum Folgenden Alexy, S. 259 ff.). Als Theorie rationaler juristischer Argumentation sucht man in der Rechtswissenschaft nach Kriterien oder Regeln richtigen juristischen Argumentierens. Dabei wird zwischen internen und externen Rechtfertigungsregeln unterschieden. Erstere umschreiben das, was üblicherweise mit dem Begriff des „juristischen Syllogismus“ bezeichnet wird. Letztere dienen der Begründung der Prämissen, die zur Grundlage interner Rechtfertigungsregeln werden. Insoweit wird zwischen folgenden Argumentformen und Regeln differenziert: solchen der Auslegung (Gesetz), der dogmatischen Argumentation (Dogmatik), der Präjudizienverwertung (Präjudiz), der allgemeinen praktischen Argumentation (Vernunft), der empirischen Argumentation (Empirie) und sog. speziellen juristischen Argumentformen (juristisches Argument). Eine logische Analyse dieser Argumentformen führe dabei zu der Einsicht in die Notwendigkeit und die Möglichkeiten ihrer Verknüpfung im juristischen Diskurs (Alexy, S. 285).
46
Gegen eine solche „Intellektualisierung der Interpretation“ wendet sich die „Postmoderne“ Methodenlehre (Vesting, S. 119 ff.). Dadurch, dass die Anwendung von Rechtsnormen mit dem „Postulat einer angemessenen und vollständigen Erfassung aller relevanten Kontexte“ verbunden werde, trete an die Stelle der notwendigen Umweltselektivität jeder Rechtsinterpretation ein Argumentationsverfahren, das keine Grenzen kenne (Ders., S. 126 Fn. 152). Stattdessen plädiert die „Postmoderne“ Methodenlehre dafür, Charakter und Funktion der Rechtsinterpretation im Sinne einer „netzwerkartigen Systembildung“ neu zu fassen. Diese verknüpfe die Rechtsakte horizontal zu einem „rekursiv und nachbarschaftlich operierenden System“. Dabei komme es darauf an, jede Rechtsinterpretation mit den gemeinsamen, die gesellschaftlichen Funktionssysteme übergreifenden Wissensbeständen (dem in der Kommunikation mitlaufenden, mittransportierten und immer nur aktuell abrufbaren Wissen) zu relationieren und den „Eigenwert“ des gemeinsamen Wissens als Selektionskriterium für fremdreferentielles Interpretieren zu nutzen. Damit unterscheide sich die „Postmoderne“ Methodenlehre maßgeblich von der klassischen juristischen Hermeneutik, weil sich die Rechtsinterpretation nicht mehr an der Kontinuität eines historischen Vorverständnisses orientiere, sondern sich auf die „dynamische Stabilität der gemeinsamen Wissensbestände der modernen bzw. postmodernen Gesellschaft“ einstelle (Ders., S. 125).
47
Dies muss nach Ansicht der „Postmodernen“ Methodenlehre auch Konsequenzen für die Rationalität der Rechtsinterpretation haben. Während sich die klassische juristische Hermeneutik nämlich nach wie vor an einer Erhöhung von Rationalitätsansprüchen orientiere, sei ganz im Gegenteil eine „Abdämpfung von Rationalitätsansprüchen“ in dem Sinne erforderlich, dass es nicht mehr um die „Erkenntnis“ richtigen (gerechten) Rechts gehe, sondern „nur“ noch um die „Plausibilität von Begründungen“ (insb. bei Gerichtsentscheidungen). Deshalb müsse die Rechtsinterpretation zum Beispiel auch den Verwendungskontext der auszulegenden Regeln, die praktischen Erfahrungen und Zwänge, den Einfluss der im Sachbereich agierenden Rechtssubjekte und ihre Handlungsstrategien thematisieren (Ders., S. 126 bezieht sich insoweit auf das Konzept der „bounded rationality“ von Herbert A. Simon). Demzufolge könne immer nur von einer beschränkten Rationalität des juristischen Entscheidens die Rede sein.
48
Ob diskursiv-prozedurale Rationalität im Sinne juristischer Begründungslehre oder „bounded rationality“ im Sinne „Postmoderner“ Methodenlehre: Beide Ansätze verdeutlichen, dass sich das Rechtssystem nicht auf den re-entry der System/Umwelt-Differenz mit Hilfe von Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung beschränkt, sondern über Rechtsphilosophie/Rechtstheorie auf die Einheit der Differenz reflektiert und damit Anspruch auf Rationalität erheben darf.
3. Strukturelle Kopplungen des Rechtssystems
49
Recht und Politik gelten über die Verfassung, Recht und Wirtschaft über Eigentum und Vertrag als strukturell gekoppelt. Dies bedeutet, dass „ein System bestimmte Eigenarten seiner Umwelt dauerhaft voraussetzt und sich strukturell darauf verläßt“ (Luhmann, RdG, S. 441). Allerdings sind gerade in jüngster Zeit einige grundlegende Veränderungen globaler und wirtschaftlicher Strukturbildung unverkennbar, die eine differenzierte Betrachtung der strukturellen Kopplungen des Rechtssystems erforderlich machen.
50
Für den Staat des politischen Systems heißt dies vor dem Hintergrund der Weltgesellschaft als weltweiten Kommunikationssystems seine „Staatlichkeit im Wandel“ zu begreifen. Zwar steht weder der Untergang des Staates bevor, noch lebt er einfach munter weiter. Doch verändern Globalisierung und Privatisierung seine Staatlichkeit in umfassender und grundlegender Weise.
51
Globalisierungsphänomene lassen sich dabei in praktisch allen Politikfeldern ausmachen. Handel und Finanzwesen sind davon genauso betroffen wie Gesundheitsschutz und Telekommunikation. Für den Umweltschutz und die Landwirtschaft gilt selbstverständlich nichts anderes. Und sogar die Bildungspolitik – das ehemals „kleinstaaterische“ Politikfeld par excellence – bleibt davon nicht unberührt, wie die Pisa-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eindrucksvoll beweist. Privatisierungsphänomene treten genauso umfassend und sichtbar hinzu. Zu den wichtigsten Privatisierungsfeldern werden mit Grund Gefahrenabwehr (insb. Öffentliche Sicherheit, Flugsicherheit, Umwelt- und Produktüberwachung, Wirtschaftsüberwachung), Infrastruktur und Versorgung (insb. Bundesfernstraßen, Streitkräftebedarf, Schul- und Verwaltungsgebäude, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Wohnungswesen) sowie Vollzug und Vollstreckung (insb. Straf- und Maßregelvollzug, Rechtsdurchsetzung, Gerichtsvollzieherwesen) gerechnet.
52
In der Konsequenz kommt es zu einer „Zerfaserung von Staatlichkeit“ (Genschel/Zangl, Zerfaserung von Staatlichkeit, 2007), d.h. im Umfeld des Staates etablieren sich nicht-staatliche Träger von Staatlichkeit. So gibt es im Gefolge der Globalisierung mittlerweile kaum noch einen Regelungsbereich, der nicht von internationalen Organisationen nachhaltig beeinflusst würde. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier nur genannt: die Vereinten Nationen (UNO), der internationale Strafgerichtshof (ICC), die Welthandelsorganisation (WTO), die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), ICANN für die Internetregulierung usw. usw. Und die Privatisierung mit ihren Idealtypen der Organisationsprivatisierung, der Aufgabenprivatisierung, der funktionalen Privatisierung und der Vermögensprivatisierung hat dazu geführt, dass zunehmend private Unternehmen und Organisationen in die Implementation kollektiv-verbindlicher Entscheidungen eingebunden werden. Projektbezogene oder institutionalisierte PPP (Public-Private-Partnership), Zertifizierungs- und Akkreditierungsagenturen, Toll-Collect für die Erhebung der Straßenmaut und DIN, CEN, CENELEC als private Unternehmen im Bereich der technischen Normung seien dabei wiederum nur beispielhaft erwähnt.
53
In allen Fällen aber gibt es zur Letztverantwortung des Staates keine Alternative. Der Staat bleibt zentral, bisweilen werden staatliche Entscheidungen sogar erst durch die Globalisierung erforderlich. Er mutiert allerdings „vom Herrschaftsmonopolisten zum Herrschaftsmanager“ (Genschel/Zangl, ebd., S. 9 f.).
54
Für das Wirtschaftssystem lassen sich prinzipiell ähnliche Entwicklungen der Globalisierung und Privatisierung beobachten.
55
Idealtypisch ist die Globalisierung der Wirtschaft durch zwei Prozesse gekennzeichnet: zum einen durch die Auflösung zuvor nationalstaatlich organisierter Ökonomien und/oder zum anderen durch die Entstehung globalisierter Märkte (insb. Konsum- und Finanzmärkte). Eine strukturbestimmende Veränderung in diesem Prozess der Globalisierung stellt die zunehmende Bedeutung von multinational operierenden Unternehmen dar. Darunter werden solche Unternehmen verstanden, die selbst ein globales Netzwerk von Unternehmen sind. In den Bereichen Produktion sowie Forschung und Entwicklung (F&E) tätigen sie ¾ des gesamten Welthandels und verantworten 80 % der weltweiten Forschungsaktivitäten. Sie sind gleichsam die Vehikel der Globalisierung der Wirtschaft (Lieckweg, Recht der Weltgesellschaft, S. 4 ff., 65 ff.).
56
Multinational operierende Unternehmen tätigen globale Transaktionen. Zur Gestaltung und Strukturierung derselben treten ihnen sog. Formulating Agencies (zwischenstaatliche oder private Organisationen, die – neben den Branchenorganisationen – Empfehlungen zur Vertragsgestaltung herausgeben) zur Seite. Dazu zählen z.B. die United Nations Commission on International Trade (UNCITRAL), die Economic Commission for Europe (ECE), die International Chamber of Commerce (ICC), die International Maritime Commission (IMC) usw. usw. Im Nachgang zu dieser Entwicklung hat sich mittlerweile eine internationale (Handels)Schiedsgerichtsbarkeit etabliert. So verzeichnet das Project on International Courts and Tribunals (PICT) 125 internationale Institutionen, in denen unabhängige Autoritäten rechtskräftige Urteile fällen (Sassen, Paradox des Nationalen, S. 434 ff.). Die Spanne der Institutionen umfasst unterschiedlichste Schiedszentren: zu den „klassischen“ Institutionen – wie dem London Court of Arbitration, der American Arbitration Association oder der Stockholm Chamber of Commerce – treten neuere Einrichtungen wie das Singapore International Arbitration Centre, das Hongkong International Arbitration Centre, das Deutsche Institut für Schiedsgerichtsbarkeit, das Cairo Centre for International Commercial Arbitration oder das International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) (Albert, Politik der Weltgesellschaft, S. 239 ff.). Für die Kommunikation aller drei Organisationen – seien es nun multinational operierende Unternehmen, Formulating Agencies oder internationale Schiedszentren – ist der Vertrag als klassische Erscheinungsform der Privatautonomie und juristische Beobachtung wirtschaftlicher Transaktionen von fundamentaler Bedeutung.
57
Die dargestellten Veränderungen globaler politischer und wirtschaftlicher Strukturbildung lassen für das Verhältnis von Recht und Politik sowie Recht und Wirtschaft Präzisierungsbedarf sichtbar werden. Zwar können und sollen Verfassung und Vertrag insoweit auch weiterhin als maßgebliche strukturelle Kopplungen des Rechtssystems betrachtet werden, doch sind sie im Zeichen von Globalisierung und Privatisierung einem Bedeutungswandel unterworfen.
58
So wie private Rechtsetzung jenseits des Nationalstaats mittlerweile Normalität geworden ist, scheint sich in jüngster Zeit eine vergleichbare Entwicklung für die „Verfassung jenseits des Nationalstaats“ abzuzeichnen. Dabei wird die Vermutung geäußert, dass sich die Positivierung konstitutioneller Normen im globalen Maßstab auf unterschiedliche gesellschaftliche Sektoren ausdehne, die parallel zu politischen Verfassungsnormen zivilgesellschaftliche Verfassungsnormen erzeugen. Es handele sich insoweit um den „Realtrend“ einer „globalen Konstitutionalisierung ohne Staat“. Er gipfelt in der These: „Die Verfassung der Weltgesellschaft verwirklicht sich nicht exklusiv in den Stellvertreter-Institutionen der internationalen Politik, sie kann aber auch nicht in einer alle gesellschaftlichen Bereiche übergreifenden Globalverfassung stattfinden, sondern sie entsteht inkrementell in der Konstitutionalisierung einer Vielheit von autonomen weltgesellschaftlichen Teilsystemen.“ (Teubner, 6). Und am Ende steht der Entwurf einer „normativen Netzwerktheorie globaler Rechtsregime“ (Fischer-Lescano/Teubner, Regime-Kollisionen, S. 64 f.).
59
Wie für die Verfassung gilt auch für den Vertrag als strukturelle Kopplung von Recht und Wirtschaft, dass er in jüngster Zeit einem Bedeutungswandel unterworfen ist. Er wird primär in seiner Globalisierung gesehen (Zum Folgenden Lieckweg, Recht der Weltgesellschaft, S. 49 ff.). Durch die Bezugnahme auf die als Lex Mercatoria beschriebenen Regeln und Normen in Vertragsverhandlungen und Schiedsverfahren wird der Vertrag zu einem global gültigen Konditionalprogramm. Das Rechtssystem vermag damit auf weltgesellschaftlicher Ebene zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und so für andere Funktionssysteme Erwartungssicherheit und Konfliktlösungspotential zu produzieren. Die bereits erwähnten sog. Formulating Agencies unterstützen mit ihrer schriftlichen Fixierung der „Principles“ diesen Prozess. In weiteren Vertragsverhandlungen besteht nun nämlich die Möglichkeit, diese über den konkreten Einzelfall hinausreichenden Normen zu bemühen, die dadurch wiederum aufgrund ihrer kontinuierlichen Anwendung im Rahmen globaler Wirtschaftskommunikation und ihrer schriftlichen Fixierung durch weltweit anerkannte Organisationen (z.B. Unidroit) globale Gültigkeit erlangen. Insoweit wird ein zirkulärer Rechtserzeugungsprozess sichtbar, der seinen Ausgangspunkt in Normen mit unbekannter Rechtsgrundlage nimmt, über die Anwendung dieser Normen in Verträgen und vor Schiedsgerichten führt und schließlich in die erneuten Normfixierung durch sog. Formulating Agencies mündet.
60
Vor dem Hintergrund dieses Bedeutungswandels, den Verfassung und Vertrag in der Weltgesellschaft erfahren, könnte die strukturelle Kopplung von Recht und Politik sowie Recht und Wirtschaft durch eine vertiefte Betrachtung des Verhältnisses von Organisation und struktureller Kopplung aufrechterhalten werden. Gerade die Selbstbeschreibung des Rechtssystems im Zeichen von Globalisierung und Privatisierung liefert in vielfacher Hinsicht Anlass, der Bedeutung von Organisation im Rahmen struktureller Kopplung von Recht und Politik sowie Recht und Wirtschaft nachzugehen. Hier sei noch einmal in Erinnerung gerufen, dass es im Gefolge der Globalisierung mittlerweile kaum noch einen Regelungsbereich gibt, der nicht von internationalen Organisationen nachhaltig beeinflusst würde. Für das transnationale Wirtschaftsrecht im Besonderen sind vor allem multinational operierende Unternehmen, sog. Formulating Agencies und zahlreiche internationale Schiedsorganisationen zu nennen. Und auch die Privatisierung hat in der Form der Organisationsprivatisierung dazu geführt, dass zunehmend private Unternehmen und Organisationen in die Implementation kollektiv-verbindlicher Entscheidungen einbezogen werden. Organisation und Organisationsrecht erleben angesichts weitreichender Privatisierungsanstrengungen des Staates, der damit verbundenen Entwicklung einer Dogmatik der Gewährleistungs- und Regulierungsverwaltung sowie einer diese überformenden Neuen Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft geradezu eine „Neuvermessung“ im Rechtssystem (Wahl, Privatorganisationsrecht, 318 ff.).
61
Organisation spielt deshalb eine besondere Rolle bei der strukturellen Kopplung von Funktionssystemen, insbesondere von Recht und Politik sowie Recht und Wirtschaft. Dabei geht es genau gesagt um den bisher kaum ausgearbeiteten Zusammenhang der Systemebenen Interaktion, Organisation und Gesellschaft. Insoweit wird man sich von dem Gedanken lösen müssen, dass es stets nur um Beziehungen zwischen Funktionssystemen geht. In den Blick sollten vielmehr auch die Beziehungen zwischen Organisationen und Funktionssystemen sowie zwischen Organisationen genommen werden.
62
Organisationen sind – im Gegensatz zu allen anderen Sozialsystemen – durch die Besonderheit der Entscheidungsfähigkeit gekennzeichnet (Luhmann, Organisation und Entscheidung, passim). Sie tragen für die Funktionssysteme die Programmstrukturen und statten dadurch diese mit Entscheidungsfähigkeit aus. Für den Leistungsaustausch zwischen den Funktionssystemen sind Organisationen nachgerade unverzichtbar, weil sie die Kommunikation zwischen den Funktionssystemen erst ermöglichen. Organisationen scheinen sich auf den ersten Blick stets einem Funktionssystem eindeutig zuordnen zu lassen, bei genauerer Betrachtung wird aber deutlich, dass an der Organisationskommunikation regelmäßig mehrere Funktionssysteme beteiligt sind. Niklas Luhmann hat dies mit der Theoriefigur des „loose coupling“ erklärt: „Offenbar können Funktionssysteme sich gerade dank dieses ›› loose coupling ‹‹ in Organisationssystemen einnisten – und zwar mehrere Funktionssysteme in ein und derselben Organisation.“ (Luhmann, PdG, S. 398).
63
Auf welche Weise Organisationen zur strukturellen Kopplung von Funktionssystemen beitragen, ist dabei nach wie vor ungeklärt. Die häufiger auftauchende Formulierung Niklas Luhmanns, dass die strukturelle Kopplung „über“ Organisation erfolge (z.B. ders, ebd., S. 396), bleibt angesichts ihrer Unbestimmtheit letztlich unbefriedigend. Zu etwas mehr Klarheit könnte der Vorschlag beitragen, zwischen Organisation als Voraussetzung für strukturelle Kopplung, Organisation als strukturelle Kopplung und Organisation als Vermittler struktureller Kopplung zu unterscheiden (Lieckweg, Strukturelle Kopplung, 275 ff.). Zur erstgenannten Gruppe dürfte die überwiegende Zahl von Organisationen zählen, da strukturelle Kopplungen in der notwendigen Komplexität und Differenziertheit kaum möglich wären, „wenn es nicht Organisationen gäbe, die Informationen raffen und Kommunikationen bündeln können und so dafür sorgen können, dass die durch strukturelle Kopplungen erzeugte Dauerirritation der Funktionssysteme in anschlussfähige Kommunikation umgesetzt wird.“ (Luhmann, Organisation und Entscheidung, S. 400). Zur zweiten Gruppe hingegen werden wohl nur ganz wenige Organisationen zu rechnen sein, weil nur solche als strukturelle Kopplung in Betracht kommen, bei denen sich jeweils das eine der gekoppelten Systeme in seinen Strukturen auf das andere verlässt, und umgekehrt. Bei der dritten Gruppe schließlich ginge es um Organisationen, „die sich auf eine strukturelle Kopplung und ihre Umsetzung beziehen oder als Träger dieser strukturellen Kopplung ausgemacht werden können.“ (Lieckweg, Strukturelle Kopplung, 278). Für die strukturelle Kopplung von Recht und Politik wären hier z.B. das Bundesverfassungsgericht und auf supra- bzw. internationaler Ebene der Europäische Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der Internationale Strafgerichtshof zu nennen. Und was die strukturelle Kopplung von Recht und Wirtschaft anbelangt, so lassen sich die sog. Formulating Agencies und die internationalen Schiedsgerichte der Lex Mercatoria als Voraussetzung struktureller Kopplung und die multinationalen Unternehmen als Vermittler derselben begreifen (zu Einzelheiten siehe Schulte, Eine soziologische Theorie des Rechts, S. 136 ff., 164 ff.).
IV. Bibliographie
Albert, Mathias, Zur Politik der Weltgesellschaft: Identität und Recht im Kontext internationaler Vergesellschaftung, Weilerswist 2002.
Alexy, Robert, Theorie der juristischen Argumentation. Eine Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, Frankfurt a. M. 1978.
Amelung, Knut, Die Ehre als Kommunikationsvoraussetzung. Studien zum Wirklichkeitsbezug des Ehrbegriffs und seiner Bedeutung im Strafrecht, Baden-Baden 2002.
Di Fabio, Udo, Das Recht offener Staaten, Tübingen 1998.
Fischer-Lescano, Andreas/Teubner, Gunther, Regime-Kollisionen. Zur Fragmentierung des globalen Rechts, Frankfurt a. M. 2006.
Fögen, Marie Theres, Rechtsgeschichte – Geschichte der Evolution eines sozialen Systems, Rg 1 (2002), 14 ff.
–, Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems, Göttingen 2002.
–, Zufälle, Fälle und Formeln, Rg 6 (2005), 84 ff.
Frevert, Ute, Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft, München 1991.
Genschel, Philipp/Zangl, Bernhard, Die Zerfaserung von Staatlichkeit und die Zentralität des Staates, TranState Working Papers No. 62, Bremen 2007.
Gephart, Werner, Gesellschaftstheorie und Recht, Frankfurt a. M. 1993.
Heun, Werner, Kommentierung zu Artikel 3, in: Dreier, Horst (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Band I, 2. Aufl., Tübingen 2004.
Hiller, Petra, Der Zeitkonflikt in der Risikogesellschaft: Risiko und Zeitorientierung in rechtsförmigen Verwaltungsentscheidungen, Berlin 1993.
Horn, Hans-Detlef, Experimentelle Gesetzgebung unter dem Grundgesetz, Berlin 1989.
Huber, Thomas, Systemtheorie des Rechts: Die Rechtstheorie Niklas Luhmanns, Baden-Baden 2007.
Kaufmann, Franz-Xaver, Ein Wittgenstein’sches Schweigen, in: Stichweh, Rudolf (Hrsg.), Niklas Luhmann. Wirkungen eines Theoretikers. Gedenkcolloquium der Universität Bielefeld am 8. Dezember 1998, Bielefeld 1999, S. 9 ff.
Kieserling, André, Kommunikation unter Anwesenden. Studien über Interaktionssysteme, Frankfurt a. M. 1999.
Kirste, Stephan, Die Zeitlichkeit des positiven Rechts und die Geschichtlichkeit des Rechtsbewusstseins, Berlin 1998.
Lieckweg, Tania, Strukturelle Kopplung von Funktionssystemen „über“ Organisation, Soziale Systeme 7 (2001), 267 ff.
–, Das Recht der Weltgesellschaft. Systemtheoretische Perspektiven auf die Globalisierung des Rechts am Beispiel der Lex Mercatoria, Stuttgart 2003.
Luhmann, Niklas, Legitimation durch Verfahren, Neuwied, Berlin 1969.
–, Gerechtigkeit in den Rechtssystemen der modernen Gesellschaft, Rechtstheorie 4 (1973), 131 ff.
–, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1974.
–, Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, München, Wien 1981.
–, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M. 1984.
–, Die Codierung des Rechtssystems, Rechtstheorie 17 (1986), 171 ff.
–, Die soziologische Beobachtung des Rechts, Frankfurt a. M. 1986.
–, Die Stellung der Gerichte im Rechtssystem, Rechtstheorie 21 (1990), 459 ff.
–, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1993.
–, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1997.
–, Evolution des Rechts, in ders., Ausdifferenzierung des Rechts. Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Frankfurt a.M. 1999, S. 11 ff.
–, Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2000.
–, Organisation und Entscheidung, Opladen 2000.
–, Short Cuts, Frankfurt a.M. 2000.
–, Soziologische Aufklärung 1. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, 7. Aufl., Wiesbaden 2005.
–, Rationalität in der modernen Gesellschaft, in: ders., Ideenrevolution. Beiträge zur Wissenssoziologie, hrsg. v. Kieserling, André, Frankfurt a. M. 2008, S. 186 ff.
Ossenbühl, Fritz, Gesetz und Recht – Die Rechtsquellen im demokratischen Rechtsstaat, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band III, 2. Aufl., Heidelberg 1996, S. 281 ff.
–, Rechtsverordnung, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band III, 2. Aufl., Heidelberg 1996, S. 387 ff.
–, Autonome Rechtsetzung der Verwaltung, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band III, 2. Aufl., Heidelberg 1996, S. 425 ff.
–, Satzung, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band III, 2. Aufl., Heidelberg 1996, S. 463 ff.
Osterkamp, Thomas, Juristische Gerechtigkeit, Tübingen 2004.
Reese-Schäfer, Walter, Niklas Luhmann zur Einführung, 3. Aufl., Hamburg 1999.
Reimer, Franz, Das Parlamentsgesetz als Steuerungsmittel und Kontrollmaßstab, in: Hoffmann-Riem, Wolfgang,/Schmidt-Aßmann, Eberhard/Voßkuhle, Andreas (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band 1, München 2006, § 9, S. 533 ff.
Sassen, Saskia, Das Paradox des Nationalen, Frankfurt a. M. 2008.
Schelsky, Helmut, Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen, Reinbek bei Hamburg 1963.
Schmidt-Aßmann, Eberhard, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee: Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg 2004.
Schulte, Martin, Eine soziologische Theorie des Rechts, Berlin 2011.
Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung – besonders des 9. Deutschen Bundestages (1980-1983), Berlin 1988.
Stichweh, Rudolf, Selbstorganisation und die Entstehung nationaler Rechtssysteme (17.-19. Jahrhundert), RJ 9 (1990), 254 ff.
Teubner, Gunther, Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur staatszentrierten Verfassungstheorie, ZaöRV 63 (2003), 1 ff.
Vesting, Thomas, Rechtstheorie, München 2007.
Wahl, Rainer, Privatorganisationsrecht als Steuerungsinstrument bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, in: Schmidt-Aßmann, Eberhard/Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, Baden-Baden 1997, S. 301 ff.
V. Verwandte Themen
Gerechtigkeit | Gleichheit | Habermas, Jürgen | Institution | Methodenlehre | Norm | Positives Recht | Rechtsdogmatik | Rechtsstaat