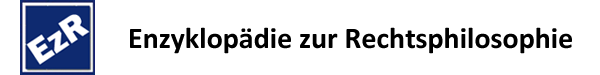Grundlagen der Methodenlehre I: Aufgaben und Kritik
Erstveröffentlichung: 04. Februar 2013
- Theorie und Methode
- Verfassungsauftrag und wissenschaftlicher Anspruch
- Herausforderungen der Methode durch das Europäische Recht
- Methodenlehre, Kunstregeln und Arbeitstechniken
Die Kritik der juristischen Methodenlehre
- Methodengewissheit und Methodenkritik
- „Harte“ und „weiche“ Normen
- Alte Methodenkritik
- Neue Methodenkritik
- Macht oder Ohnmacht der Methode?
Aufgaben der Methodenlehre
I. Theorie und Methode
1
Eine Methode ist eine Anweisung für das planmäßige (und insofern theoriegeleitete) Vorgehen zur Lösung von bestimmten Aufgaben oder Problemen. Eine als solche benannte Methodendiskussion wird vor allem im öffentlichen Recht geführt.[1] Dabei wird in der Regel[2] nicht zwischen Theorie und Methode unterschieden. Damit entfernt sich die Rechtwissenschaft von dem in anderen Disziplinen üblichen Methodenbegriff, der unterhalb der Theorie angesiedelt ist. Mit Podlech (1972:492) kann man sagen, eine Methode ist „nur eine geordnete Klasse von Verhaltensanordnungen (Operationen) zum Zwecke von Problemlösungen. Methoden sind nicht wahr oder falsch, sondern fruchtbar oder unfruchtbar“. Das entspricht dem engeren Methodenbegriff, wie er in der empirischen Sozialforschung üblich ist. Der engere Methodenbegriff entspricht der Aufgabenstellung der juristischen Methodenlehre. Sie versteht sich als Anleitung zur Beantwortung konkreter Rechtsfragen oder zur Entscheidung einzelner Rechtsfälle.
2
Die Rechtstheorie befindet sich, vorsichtig gesprochen, in einem pluralistischen Zustand. Ihre Methodenkritik adressiert sie meistens an die Methodenlehre. Betroffenen sind aber viel mehr die Methoden der Rechtswissenschaft in ihren verschiedenen Fächern: dogmatische Fächer, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Rechtssoziologie, ökonomische Analyse des Rechts. Hinter der verbreiteten Methodenkritik verbergen sich vielfach rechtstheoretische Kontroversen, sozusagen ein »Methodenstreit« der Rechtstheorie. Rechtstheoretische Kontroversen können aber nicht in der Methodenlehre ausgetragen werden, wenn die Praxis handlungsunfähig bleiben soll. Die notwendige Verknüpfung zwischen Theorie und Methode muss außerhalb der Methodenlehre stattfinden. Die Methodenlehre darf sich zwar gegenüber neuen rechtstheoretischen Entwicklungen nicht unempfindlich zeigen, muss aber nicht jeder Wendung der Rechtstheorie folgen, sondern kann aus einer gewissen Distanz abwarten, bis sich neue methodische Standards entwickeln.
3
Was als juristische Methodenlehre bezeichnet wird, ist nur eine Teilmenge der juristischen Methoden. Mit der Methodenlehre gibt sich die Rechtwissenschaft selbst eine Anleitung zur Beantwortung konkreter Rechtsfragen oder zur Entscheidung einzelner Rechtsfälle. Die Methodenlehre ist aber gleichzeitig eine Brücke zur Praxis. Im Streitfall haben die Gerichte das letzte Wort. Die Methodenlehre ist daher in letzter Konsequenz eine Anleitung zur Rechtsgewinnung für die Gerichte. Die nicht selten zu hörende Kritik, die juristische Methodenlehre sei zu eng, weil sie sich auf die Anleitung zur Fallentscheidungspraxis konzentriere[3], geht deshalb fehl.
4
Im Mittelpunkt der Methodenlehre stehen Anleitungen zur Textauslegung, der so genannte Kanon der Auslegungsmethoden. Es wäre aber zu eng, die Methodenlehre auf die Textinterpretation einzuschränken, denn ein Grundproblem der Methodenlehre besteht gerade darin, dass nicht selten die Interpretation von Texten zu keinem Ergebnis führt. Auch solche Fälle muss die Methodenlehre bedenken. Daher ist es zweckmäßig, die juristische Methodenlehre nach dem Titel eines Buches von Kriele als „Theorie der Rechtsgewinnung“ de lege lata zu verstehen.[4] Im Zusammenhang mit der juristischen Ausbildung wird oft gefordert, es müsse auch die gestaltende Tätigkeit von Juristen berücksichtigt werden. Das mag per se sinnvoll sein, verlangt aber nicht, dass der auf Entscheidungsfindung ausgerichtete Begriff der Methodenlehre erweitert wird.
5
Bemerkenswert ist die lange Reihe von Lehr- und Lernbüchern zur Methodenlehre.[5] Zusammen mit selbständigen Kapiteln zur Methodenlehre in vielen anderen Büchern, die vornehmlich für die juristische Ausbildung bestimmt sind (z. B. Sauer 2011), zeigen sie das große Bedürfnis nach Reflexion und Vergewisserung für einen zentralen praxiszugewandten Bereich der juristischen Arbeit und zugleich Vertrauen in die Lehr- und Lernbarkeit der juristischen Methode.
II. Verfassungsauftrag und wissenschaftlicher Anspruch
1) Die Methodenlehre als Fortsetzung der Rechtsquellenlehre
6
Die juristische Methodenlehre bildet die Fortsetzung der Rechtsquellenlehre. In der Rechtsquellenlehre gibt es manche Streitpunkte, die auch in der Methodenlehre wiederkehren. Es geht etwa darum, ob die Rechtsquellenlehre monistisch oder pluralistisch konzipiert werden soll, ob sie noch etatistisch verankert werden darf oder ob sie sich global orientieren muss, ob sie vertikal am Stufenbau der Rechtsordnung oder horizontal im Sinne von „Interlegalität“ (Amstutz 2003) auszurichten ist. Auch die Verbindlichkeit von Präjudizien ist ein Problem der Rechtsquellenlehre.
7
Bisher ist die Rechtsquellenlehre noch überall national-etatistisch geprägt. Mit verschiedenen Rechtsordnungen verbinden sich daher unterschiedliche Methodenlehren (Fikentscher 1975 ff.; Vogenauer 2001). Das hat zur Entstehung einer besonderen Methodenlehre für das Europarecht geführt.
8
In Deutschland ist Ausgangspunkt der Rechtsquellenlehre und damit auch der Methodenlehre Art. 20 III GG: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Die Methodenlehre muss also die Bindungen und als Kehrseite den Freiraum für Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung beachten. Methodenfragen sind insoweit Verfassungsfragen (Rüthers 2009). Das bedeutet nicht, dass die Lehren der Methodenlehre ihrerseits als Recht anzusehen wären. Die Methodenlehre ist nur die praktische Umsetzung der Theorie der Rechtsquellen, die normativen Vorgaben ihres Anwendungsbereichs übernimmt.
9
Zutreffend hat Christensen (1989: 221 f.) den Einwand Krieles (1972: 33ff.) zurückgewiesen, die Methode könne nicht an normative Vorgaben der Verfassung gebunden sein, da der Gehalt der Verfassung seinerseits erst durch die Methode erschlossen werden müsse. Es handelt sich nicht um einen logischen, sondern um einen hermeneutischen Zirkel. Vor allen methodischen Bemühungen gibt es ein Alltagsverständnis der Verfassung, das sich mit jedem Durchgang durch den Zirkel des Verstehens verbessern lässt. Trotzdem bleibt hier ein Problem, denn das Bundesverfassungsgericht spricht wiederholt[6] von „anerkannten Auslegungsgrundsätzen“, von denen die Verfassung jedoch keinen als verbindlich vorschreibe, hat sich aber gleich in einer seiner ersten Entscheidungen und danach in ständiger Rechtsprechung zu der so genannten objektiven Auslegungstheorie bekannt[7]. Erst in jüngster Zeit scheint das Gericht von diesem Standpunkt abzurücken, indem es im Sinne der subjektiven Theorie die Gesetzesbindung betont.[8]
10
Die Verfassung beantwortet die Kompetenzfrage. Die Kompetenz für die Rechtsschöpfung liegt beim demokratischen Gesetzgeber, und unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung ist es immer noch zutreffend, dass die Gerichte bloß den „Mund des Gesetzes“ (Montesquieu) bilden. Aber das bedeutet nicht, dass alle Entscheidungen durch das Gesetz vorgezeichnet sind. Dann brauchte es keine Methodenlehre. Eine mechanische Bindung lässt sich mit sprachlichen und auch mit anderen Mitteln gar nicht realisieren. Das Gesetz muss immer wieder konkretisiert und auch ergänzt werden. Dabei ist der Gesetzgeber auf die Kooperation der Gerichte angewiesen, und die Verfassung verlangt, dass die Gerichte sich auf solche Kooperation einlassen. Ob das im Geiste „denkenden Gehorsams“ (Heck 1932:107) geschehen soll, in kritischer Distanz oder mit selbstbewusstem Gestaltungsanspruch, ist eine zentrale Frage der Methodenlehre, die als Kontroverse zwischen der„subjektiven“ und der „objektiven“ Theorie geläufig ist.
2) Der Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit
11
Die wichtigste methodenrelevante Norm ist Art. 3 I GG. Aus ihr folgt der Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit. Rechtsanwendungsgleichheit bedeutet gleichmäßigen Vollzug der Gesetze durch Exekutive und Judikative. Sie kann einmal an praktischen Schwierigkeiten des Gesetzesvollzugs scheitern. Das war und ist ein Problem z.B. des Steuerrechts. Rechtsanwendungsgleichheit wird aber auch verfehlt, wenn sie gar nicht Ziel der juristischen Methode ist oder die Methode nicht richtig angewendet wird. Die Herstellung von Rechtsanwendungsgleichheit bei der Anwendung der Gesetze muss daher ein zentrales Ziel der juristischen Methodenlehre sein. Das ergibt sich nicht nur aus Art. 3 GG. Dahinter steht auch die Forderung nach Allgemeinheit des Gesetzes als Rechtsprinzip, das wiederum auf das Generalisierungsprinzip der Ethik[9] gestützt werden kann.
12
Rechtsanwendungsgleichheit setzt regelbewusstes Entscheiden auch dort voraus, wo keine Regel zur Verfügung steht. Von den Gerichten ist zu fordern, dass sie jede Entscheidung in der Bereitschaft treffen, in gleichen Situationen ebenso zu entscheiden, dass sie also stets unter dem Gesichtspunkt einer für alle gleichartigen Fälle gültigen Regel urteilen, mag auch diese Regel im konkreten Fall zum ersten Mal aufgestellt und als solche nicht einmal ausgesprochen werden.
13
Ein Einwand liegt auf der Hand: „Kein Fall ist einem anderen in jeder Hinsicht gleich.“[10] Heute beruft man sich gerne auf Vertreter der Cultural Studies und des Feminismus, die als Konsequenz des Konstruktivismus jedem Menschen, jeder Situation, jedem kulturellen Artefakt Einmaligkeit bescheinigen. Der erste Impuls ist Zustimmung, da es immer auch um Menschen geht, die man nicht über einen Kamm scheren darf. Aber wollte man dem Einwand stattgeben, bräche aller Wissenschaft und auch der wissenschaftlichen Jurisprudenz die Basis weg. Für alle Dinge gilt: Je genauer wir sie betrachten, umso mehr schwinden die Gemeinsamkeiten. Bei genauester Beobachtung gibt es in Natur und Kultur keinen Gegenstand, der einem anderen gleicht. Und dennoch: Erfahrung ist Wiedererkennen. Erfahrung ist möglich, wenn auch nur unter Verzicht auf Genauigkeit. Mit abnehmender Genauigkeit fügen sich die Dinge zu Klassen, und die Klassen werden gröber und größer. Blumen und Gräser, Bäume und Sträucher werden zu Pflanzen. Würmer und Käfer, Fische und Warmblüter werden zu Tieren. Stets können wir feiner unterteilen oder weiter zusammenfassen. Die Klassifizierungen bleiben notwendig unscharf, denn es gilt, mit einer endlichen Zahl von Begriffen die unendliche Vielfalt der Welt einzufangen. Doch ohne Generalisierung geht es nicht. So kann und muss auch das Recht mit seinen Regeln nach gleichartigen Fällen generalisieren.
14
Postmoderne Rechtstheorie verwirft das Regelkonzept von der anderen Seite her mit der These, dass eine Anwendung von Rechtsregeln gar nicht möglich sei, weil jeder Rückgriff auf eine Regel die Regel selbst verändere. In der Tat geschieht es häufig, dass sich eine Regel im Zuge ihrer Verwendung verändert. Aber noch häufiger bedeutet die Anwendung der Regel ihre Konsolidierung.
15
Rechtsanwendungsgleichheit scheitert auch nicht an der vom Bundesverfassungsgericht (E 87, 273/278) so genannten konstitutionellen Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung. Gemeint ist die Tatsache, dass die richterliche Unabhängigkeit eine Bindung an bestimmte Auslegungen von Gesetzen verhindert. Gerichte sind grundsätzlich frei, von der Rechtsprechung anderer Gerichte oder einer herrschenden Meinung[11] abzuweichen. Diese Freiheit besteht jedoch nur im Rahmen der juristischen Methode. Die verlangt als Minimum, dass man die Rechtsprechung anderer Gerichte und die Auslegungsvorschläge des Schrifttums zur Kenntnis nimmt und nur mit guten Gründen von etablierten Meinungen abweicht.
16
Rechtsanwendungsgleichheit bedeutet nicht unbedingt Präjudizienbindung. Aber es ist zu wenig, wenn das Bundesverfassungsgericht (E 84, 212 = NJW 1991, 2549/2550) erklärt, der Geltungsanspruch einer Entscheidung über den Einzelfall hinaus beruhe allein auf der Überzeugungskraft ihrer Gründe. Die Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist ein Wert von Verfassungsrang (Art. 95 Abs. 3 GG). Auch ohne Rücksicht auf seine Gründe ist jedes Präjudiz mehr als eine bloße Meinungsäußerung. Eine Abweichung ohne Begründung ist ein Kunstfehler. In diesem Sinne sagt Alexy (2008: 339) „Wenn ein Präjudiz für oder gegen eine Entscheidung angeführt werden kann, ist es anzuführen … Wer von einem Präjudiz abweichen will, trägt die Argumentationslast.“[12]
3) Verfassungsrechtlicher Auftrag und Wissenschaftlichkeit
17
Die Frage nach der richtigen juristischen Methode ist also im Ausgangspunkt eine Rechtsfrage. Die Verfassung gibt das Ziel der Methodenlehre vor. Die Wahl der Mittel überlässt sie jedoch der Jurisprudenz. Insofern ist die Frage eine solche der Wissenschaft.
18
Wegen ihres verfassungsrechtlichen Auftrags und als wissenschaftliche ist die juristische Methode ein und dieselbe für alle Bereiche des Rechts. Es gibt keine besondere Methodenlehre etwa für das Verwaltungsrecht, für das Europarecht oder für das Völkerrecht.[13] Es gibt jedoch für einzelne Rechtsgebiete besondere Rechtsgrundsätze, die der Methode Grenzen ziehen oder ihr besondere Wege weisen. So gilt für das Strafrecht wegen Art. 103 II GG, § 1 StGB das Analogieverbot. Außerdem gibt es in verschiedenen Rechtsgebieten spezifische Sachprobleme, die besondere methodische Anstrengungen erfordern. Das gilt wegen der Offenheit der Grundrechtstatbestände besonders für das Verfassungsrecht selbst. Das Zivilrecht wird durch eine zentrale Kodifikation geprägt. Im Arbeitsrecht muss die Praxis in zentralen Fragen ohne ein Gesetz auskommen. Für das öffentliche Recht ist eine stark ausgeprägte Normenhierarchie und eine Vielfalt von Kompetenzträgern (Bund – Land – Kommunen) bedeutsam.
III. Herausforderungen der Methode durch das Europäische Recht
19
Das Europarecht erteilt der Methodenlehre zusätzliche Aufträge und stellt sie vor spezifische Sachprobleme, die nach eigenen Lösungen verlangen.[14] Das Primärrecht bietet vielfach offene Tatbestände. Lange Zeit waren die Materialien nicht zugänglich; jedenfalls in den ersten Jahren der Gemeinschaft war das Europarecht auch wissenschaftlich nicht vorbereitet; hinzu tritt das Sprachenproblem. Auslegungsziel ist im Zweifel eine Harmonisierung des Rechts in Europa. Darus erklärt sich ein Übergewicht der teleologischen Auslegung in den Urteilen des Gerichtshofs. Der Europäische Gerichtshof (EUGH) hat die mitgliedstaatlichen Gerichte auf den effet utile als Auslegungsgrundsatz verpflichtet.
20
Institutionelle Besonderheiten treten hinzu: Die Rechtsanwendung erfolgt in einer zuvor ungewohnten Arbeitsteilung zwischen nationalen und europäischen Gerichten. Den nationalen Gerichten letzter Instanz verbietet Art. 267 III AEUV, das Gemeinschaftsrecht auszulegen. Umgekehrt wenden die europäischen Gerichte nur europäisches Recht an. Für die Auslegung spiegelt sich das nationale Recht allenfalls indirekt in ihren Entscheidungen, obwohl es häufig ihr Gegenstand ist. Das folgt aus dem Grundsatz der autonomen Begriffsbildung des Gemeinschaftsrechts. In Europa begegnen sich unterschiedliche nationale Traditionen des Umgangs mit dem Recht, so insbesondere das eher systematisch ausgerichtete deutsche Recht mit dem Richter- und Fallrecht des Common Law. Daher ist der EUGH nicht durch Auslegungstraditionen und eine wissenschaftliche Begleitung diszipliniert, wie es etwa die deutschen Gerichte sind. Die Urteilsbegründungen sind häufig eher knapp, wenn auch nicht von der Kürze französischer Urteile. Schließlich fehlt die Einbindung in einen kontinuierlichen Dialog mit den Instanzgerichten, wie ihn die obersten Gerichte in den Mitgliedstaaten kennen.
IV. Methodenlehre, Kunstregeln und Arbeitstechniken
21
Arbeitstechniken und Kunstregeln bilden die kleine Münze der Methodenlehre. Im juristischen Studium wird die akademische Methodenlehre durch Anleitungen zur Fallbearbeitung[15]und so genannte Aufbauschemata, im Vorbereitungsdienst durch Einübung in die Gutachtentechnik[16] kleingearbeitet und standardisiert, so dass sie nicht zuletzt auch einen Maßstab für die Bewertung von Prüfungsleistungen abgeben. Das geschieht unter der stillschweigenden Prämisse, dass auch die spätere Rechtspraxis nach diesen Techniken verfährt.
22
Die Bearbeitung einer konkreten Rechtsfrage beginnt regelmäßig mit der Suche nach einer (möglichen) Anspruchsgrundlage, das heißt, nach einer Anknüpfung an eine Rechtsquelle, in aller Regel an ein Gesetz. Ist eine Anspruchsgrundlage in Sicht, greifen die Auslegungsmethoden.
23
Der Rechtsdogmatik kommt ebenso wie den Präjudizien eine wichtige Entlastungsfunktion für die Rechtspraxis zu (Kriele 1976: 262 ff; Alexy 1978: 338).[17] Auslegung und damit die Anwendung von Gesetzen starten selten mit dem blanken Normtext, sondern sind von Präjudizien und Rechtsdogmatik vorstrukturiert. Die Anwendung der Standardmethoden setzt nicht unbedingt voraus, dass zuvor Rechtsprechung und Schrifttum zur Kenntnis genommen werden. Dem Entscheider steht es frei, sich selbst die relevanten Argumente auszudenken. Aber er darf keine wichtigen Argumente übersehen. Deshalb ist es nicht nur eine Arbeitserleichterung, sondern eine Kunstregel juristischen Arbeitens, dass der Stand der Meinungen recherchiert wird. Oft ergibt sich, dass der Entscheider selbst gar nicht mehr die von der Methodenlehre vorgezeichneten Schritte durchlaufen muss, weil Wissenschaft und Rechtsprechung sie schon vorweggenommen haben.
24
Jede Bezugnahme auf ein Präjudiz fordert einen Fallvergleich. Der Fallvergleich ist eine wie selbstverständlich geübte juristische Praxis, die methodisch kaum reflektiert wird. Das geringe Ansehen von Präjudizien hat zur Folge, dass deutsche Juristen die Kunst des Fallvergleichs (distinguishing) nicht beherrschen. Wenn man sich in Deutschland auf Präjudizien beruft, werden oft nur einzelne Sätze aus dem angeführten Urteil herausgegriffen. Die Bildung von Fallgruppen ist auch über den Umgang mit Präjudizien hinaus eine geläufige Methode zur Konkretisierung auslegungsbedürftiger Rechtsbegriffe (Wank 2008: 49 f.).
25
Die Informationsbeschaffung selbst ist kein Gegenstand der Methodenlehre, sondern wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Wie Rechtsprechung und Schrifttum recherchiert werden, ist weitgehend von der Vermittlung durch die juristischen Verbreitungsmedien (Zeitschriften, Kommentare, Datenbanken) und von den Arbeitsbedingungen der Praxis abhängig. Eine Kunstregel, mit welcher Gründlichkeit der Meinungsstand im Schrifttum und in der Rechtsprechung zu einer anstehenden Rechtsfrage zu erforschen ist, gibt es explizit nur für Übungsarbeiten während der juristischen Ausbildung. Für die Anwaltspraxis lassen sich einige Anforderungen indirekt aus dem Haftungsrecht erschließen. Die Rechtspraxis darf sich grundsätzlich auf die ihr als zuverlässig bekannten Kommentare verlassen und ist nicht gehalten, deren Quellen nachzugehen. Immerhin wird verlangt, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung eigenständig zur Kenntnis genommen wird. Die Praxis wäre jedoch überfordert, sollte sie in jedem Fall die Ergebnisse methodengerecht nachvollziehen. Es ist deshalb nicht adäquat, die These vom Theorie-Praxis-Bruch darauf zu stützen, dass die Praxis sich in aller Regel mit einem Blick in einen der gängigen Kommentare und der Berufung auf einige Präjudizien begnügt, anstatt selbst ein Rechtsproblem von Grund auf methodisch aufzubereiten.
Die Kritik der juristischen Methodenlehre
I. Methodengewissheit und Methodenkritik
26
Wenn die Aufgabe der Methodenlehre darin besteht, nach Methoden für die Entscheidung konkreter Rechtsfragen möglichst aus dem Bestand des Rechts zu suchen, so ist sie von drei Voraussetzungen abhängig, nämlich davon, ob überhaupt geeignete Entscheidungsgrundlagen verfügbar sind, ob sie sich hinreichend konkretisieren lassen und ob sie tatsächlich die juristische Entscheidung determinieren können. Die juristische Methodenlehre baut auf Methodengewissheit, das heißt, sie bejaht mindestens grundsätzlich alle drei Voraussetzungen. Die Methodenkritik dagegen stellt skeptisch alle drei Voraussetzungen in Frage.
27
Die Verfügbarkeit von Entscheidungsgrundlagen ist relativ unproblematisch. Die Rechtsquellenlehre verweist dazu auf ein riesiges Angebot von Normen. Aus Sicht der Methodenkritik handelt es sich eher um ein Überangebot, das schon als solches die Entscheidungsfindung behindert, wenn nicht gar verhindert. Der Schwerpunkt der Methodenkritik liegt aber bei der Frage, ob aus dem vorhandenen Angebot von Normen Regeln von solcher Genauigkeit herausgearbeitet werden können, dass sich damit konkrete Rechtsfragen beantworten lassen. Insoweit argumentiert die Kritik immanent, das heißt, sie kritisiert die Leistungsfähigkeit der von der Lehre empfohlenen Methoden. Zeitgenössische Methodenkritik argumentiert aber auch grundsätzlich, das heißt, sie problematisiert philosophisch die Möglichkeit des Regelfolgens.Schließlich wird die Methodengewissheit auch empirisch in Frage gestellt mit der These: Selbst wenn die Methodenlehre an sich in der Lage wäre, aus Rechtsregeln Lösungen für konkrete Fälle abzuleiten, so suche sich doch die Rechtspraxis ihre Lösungen aus anderen Quellen.
28
Es liegt auf der Hand, dass Selbstverständnis, Fremdwahrnehmung und Funktionsbeschreibung der juristischen Arbeit nicht notwendig übereinstimmen. Methodenkritik legt ein bestimmtes Selbstverständnis der Rechtspraxis zugrunde: Die Praxis glaube an ihre Methoden. Sie gehe davon aus, dass die Lösung konkreter Rechtsfragen in Gesetzen und Präjudizien, Lehrbüchern und Kommentaren, vorgezeichnet sei. Die Methodenkritik bemüht sich sodann um den Nachweis, dass und warum die von der Jurisprudenz in Anspruch genommenen Methoden gar nicht funktionieren können. Dieser Nachweis kann nur gelingen, wenn die Kritik Selbstverständnis und Funktion der juristischen Methode zutreffend einschätzt. Zwar tritt die Methodenkritik mit dem Anspruch auf, die Selbstwahrnehmung und auch die Funktionsweise der juristischen Methode angemessen zu beschreiben. Aber nähere Analysen haben inzwischen gezeigt, dass dieser Anspruch sowohl von der Methodenkritik der Freirechtsschule als auch des Legal Realism und schließlich der Critical Legal Studies nicht eingelöst worden ist. Die Kritik arbeitet mit Metaphern oder „Theorien“ (im untechnischen Sinne), welche die Wahrnehmung der Methode strukturieren. Als solche dienen das „Subsumtionsmodell“ oder gar der „Subsumtionsautomat“, die „Begriffsjurisprudenz“, „Formalismus“ oder „Realismus“, der „Richterkönig“ oder der „politische Richter“. Die sprachphilosophische Kritik beruht auf einer einseitigen Interpretation der Spätphilosophie Wittgensteins und entfernt sich von der Perspektive des zur Entscheidung genötigten Richters, wiewohl sie genau das Gegenteil für sich in Anspruch nimmt. Postmoderne Methodenkritik folgt einem fundamentalen Antifundamentalismus, der an der Praxis vorbeiläuft. Psychologische und soziologische Untersuchungen haben jedenfalls keine massiven Fremdeinflüsse auf juristische Entscheidungen nachgewiesen.
II. „Harte“ und „weiche“ Normen
29
Bevor man weiter auf die Methodenkritik eingeht, ist es hilfreich, zwischen bestimmten und unbestimmten Normen zu unterscheiden. Viele Normen sind relativ bestimmt wie z.B. die Abstandsvorschriften im Baurecht. Andere sind höchst unbestimmt, wie z.B. § 138 BGB, der besagt, dass Rechtsgeschäfte bei einem Verstoß gegen die guten Sitten unwirksam sein sollen. Die Methodenlehre tritt zwar, meist unausgesprochen, mit dem Anspruch auf, auf den gesamten Normenbestand anwendbar zu sein. Die geläufigen Auslegungsmethoden eignen sich jedoch grundsätzlich nur für (relativ) bestimmte Normen. Umgekehrt hat die Methodenkritik vor allem unbestimmte Rechtsnormen im Blick, formuliert aber meistens so, als ob auch der Umgang mit (relativ) bestimmten Normen gemeint sei.
30
Um deutlich zu machen, dass es bei aller Relativität der Unterscheidung doch um einen deutlichen Gegensatz geht, ist die Benennung als „harte“ und „weiche“ Normen vorzuziehen. Unter „harten“ Normen sind solche zu verstehen, die sich im Wege semantischer Interpretation konkretisieren lassen. „Weich“ sind dagegen Normen, die dem Anwender einen größeren Spielraum geben.
31
Über das Unterscheidungskriterium, die Anwendbarkeit im Wege semantischer Auslegung, entscheidet eben diese Auslegung. Man ist daher schnell mit dem Argument zur Hand, das Kriterium sei zirkulär. Das ist aber kein durchschlagender Einwand, denn die Tauglichkeit einer Methode – in diesem Fall der Instrumente des Auslegungskanons – lässt sich oft nur dadurch belegen, dass sie funktioniert. Tatsächlich ist eine semantische Auslegung bis zu einem gewissen Grade möglich.
32
Sieht man näher hin, lassen sich verschiedene Arten „weicher“ Normen aufzeigen. Als solche kommen zuerst die so genannten Generalklauseln in den Blick, also Formeln von einiger Tradition und Prominenz wie Treu und Glauben, die guten Sitten, der wichtige Grund und die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Als „weiche“ Normen drängen sich ferner solche auf, die vom Anwender eine Abwägung oder eine Ermessensentscheidung verlangen. „Weich“ sind auch informelle außerrechtliche Maßstäbe, auf die das Recht verweist, z.B. Wert-, Pflicht- oder Sorgfaltsanschauungen, wie sie allgemein oder in bestimmten Verkehrskreisen anzutreffen sind. Sie werden oft als Standards bezeichnet.[18] Es geht um den Standard verkehrsüblicher Sorgfalt, eines ordentlichen Kaufmanns oder des lauteren Wettbewerbs, um den Facharztstandard oder um den Stand der Technik. Durch einen solchen Standard wird der Rechtsanwender auf einen empirisch vorhandenen Maßstab verwiesen. Deshalb spricht man auch von Verweisungsbegriffen.[19]
33
Die große Restkategorie von Ausdrücken gesteigerter Vagheit, die eine Norm „weich“ machen, bilden die sog. unbestimmten Rechtsbegriffe. Hier kann man wieder drei Gruppen unterscheiden. In der ersten bezieht sich die gesteigerte Vagheit auf den Sachverhalt (z.B. „unnötiger Lärm“, „vermeidbare Abgasbelästigung“). Hinsichtlich der zweiten Gruppe spricht man von wertausfüllungsbedürftigen Begriffen (z.B. „niedrige Beweggründe“ in § 211 StGB). Eine dritte Gruppe schließlich umfasst Begriffe wie „erheblich“, „geringfügig“ oder „auffälliges Missverhältnis“ (§ 138 BGB) und natürlich „verhältnismäßig“ bei jeder Güterabwägung. Dabei geht es darum, auf einer gleitenden Skala den Schwellenwert festzulegen.
34
Lässt man die verschiedenen Erscheinungsformen „weicher“ Normen Revue passieren, so ist klar, dass die Unterscheidung zwischen hart und weich, zwischen bestimmt und unbestimmt, ihrerseits höchst weich oder unbestimmt ist. Man kann die Unterscheidung zwischen harten und weichen Normen weiter relativieren, indem man aufzeigt, wie einerseits weiche Normen nicht erst im Einzelfall bei ihrer Anwendung, sondern vielfach schon auf Vorrat durch Präjudizien und Kommentarliteratur zu harten Regeln kleingearbeitet werden, und wie andererseits auch harte Regeln, wenn sich der Kontext verändert, zu weichen Normen werden können.
35
Die Aufgabe der juristischen Methodenlehre besteht in der Auslegung „harter“ und der Konkretisierung „weicher“ Rechtsnormen. Für die Auslegung bietet sie den so genannten Kanon der Auslegungsmethoden und Theorien über die Relevanz der verschiedenen Auslegungsinstrumente an. Für die Konkretisierung von weichen Normen verweist die Methodenlehre auf Verfahren, die als juristische Argumentation geläufig sind, auf den Ersatz von Entscheidungsregeln durch Relevanzregeln im Verfahren der Abwägung sowie auf Letztentscheidungskompetenzen für Verwaltungen und Gerichte.
36
Die Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“ Rechtsnormen entspricht weitgehend der amerikanischen Unterscheidung zwischen rules und standards.[20] Sie dient dort aber in erster Linie zur Beschreibung der funktionalen Vorzüge oder Nachteile des einen oder des anderen Normtyps. In der anglo-amerikanischen Methodenlehre benutzt man stattdessen die von Ronald Dworkin eingeführte Unterscheidung zwischen hard cases und easy cases.[21]Easy Cases sind Fälle, die sich ohne weiteres an Hand von Gesetzen und Präjudizien entscheiden lassen, hard cases solche, bei denen das nicht zutrifft.[22] Für die letzteren hat Dworkin in Abgrenzung vom, und als Kritik des, Rechtspositivismus von H. L. A. Hart (The Concept of Law, 1961) seine Prinzipientheorie und die Right-Answer-These entwickelt. Sie geht davon aus, dass das Recht sich nicht in subsumtionsfähigen Rechtsnormen erschöpft, sondern auch Prinzipien umfasst, von denen man nicht sagen kann, ob sie rechtlicher oder moralischer Natur seien. In schwierigen Fällen könne oder müsse der Richter daher auch moralische Prinzipien heranziehen und damit über das positive Recht, wie H. L. A. Hart (1961/1973) es definiert hatte, hinausgehen.
III. Alte Methodenkritik
1) „Richterkönig oder Subsumtionsautomat?“
37
Die Methodenkritik nahm ihren Anfang mit der Kritik der Begriffsjurisprudenz durch Rudolf von Ihering und der Aufwertung des Richterrechts durch Oskar von Bülows Rektoratsrede über „Gesetz und Richteramt“ von 1895.[23] Im alten Methodenstreit, der zwischen der Jahrhundertwende und dem ersten Weltkrieg tobte, ging es um immanente Kritik an der Leistungsfähigkeit der juristischen Methode. Der Titel des Buches von Ogorek (1986) benennt die damals entstandenen Feindbilder, die bis in die Gegenwart nachwirken. Das Modell vom Richter als Subsumtionsautomaten wurde von der Freirechtsschule aufgebaut, einer von Eugen Ehrlich, Hermann Kantorowicz und Ernst Fuchs vorgetragenen Rechtstheorie, die den Richter von den „Fesseln des Gesetzes“ lösen wollte, um dem sozialen Wandel Rechnung zu tragen. Ogorek hat gezeigt, dass sich die Justiztheorie des 19. Jahrhundert nicht auf den Gegensatz zwischen Begriffsjurisprudenz und Freirecht, zwischen Subsumtionsautomat und Richterkönigtum reduzieren lässt. Sie hat zahlreiche Quellen aus Theorie und Praxis ausgewertet, die keinen Zweifel aufkommen lassen, wie wenig die Juristen im 19. Jahrhundert an die Möglichkeit einer logisch-mechanischen Jurisprudenz glaubten. Die Diskussion war schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch Savigny und Puchta viel differenzierter angelegt worden, und sie verengte sich auch in der Folgezeit nicht auf die von Ihering gebrandmarkte Begriffsjurisprudenz (Haferkamp 2004). Das Entweder-Oder einer mechanischen Jurisprudenz vom Typ Subsumtionsautomat und einer freien, von subjektiven Vorlieben der Richter geprägten Rechtsanwendung bildet einen falschen Gegensatz.
38
Die Beobachtungen Ogoreks für die deutsche Justiztheorie des 19. Jahrhundert hat Tamanaha (2010) für die Entwicklung in den USA wiederholt. Tamanaha zeigt, dass zunächst die Schule der Legal Realists und später noch einmal die Schule der Critical Legal Studies ein falsches Feindbild von der traditionellen Rechtswissenschaft aufgebaut hat. Bis heute gilt es in den USA als ausgemacht, dass die traditionelle Jurisprudenz in dem Sinne formalistisch war, dass sie das Recht als objektives, unpolitisches System begriff, aus dem die Gerichte mechanisch-logisch ihre Entscheidungen ableiten konnten. Erst die Legal Realists, so die gängige Lesart, hätten entdeckt, dass und wie sehr das juristische Urteil aus anderen Quellen schöpft, und erst die Critical Legal Studies hätten den politischen Charakter aller Justiz aufgezeigt. Tamanaha hält dagegen, dass und wie Legal Realists und „Crits“ ihrerseits politische Absichten verfolgt und in einer geradezu unwissenschaftlichen Weise ihre Augen vor der Differenziertheit der als formalistisch denunzierten Jurisprudenz verschlossen hätten.
39
Tatsächlich behauptet heute kein ernst zu nehmender Jurist, dass die Methodenlehre dazu anleiten könne, stets eine in Gesetz und Recht genau vorgezeichnete Entscheidung aufzufinden. Aber ernsthaft kann auch niemand behaupten, dass Gerichte ihre Entscheidungen freischwebend nach persönlichem, mehr oder weniger sozial geprägtem Gusto oder unter dem Einfluss extralegaler Kräfte treffen. Dennoch wirkt die Polarisierung weiter.
2) Das Dogma vom Subsumtionsdogma
40
Eine zentrale Rolle im Methodenstreit spielt das so genannte Subsumtionsdogma. Bis heute halten manche Autoren es für notwendig, das Subsumtionsdogma zurückzuweisen, das im Zentrum des alten Methodenstreits liegt. Sie verkennen dabei, dass „der Schluss von einem Tatbestand auf eine Rechtsfolge … für den Juristen nur die Endgestalt (ist), in der er sein Arbeitsergebnis präsentiert, nicht aber ein Abbild oder Modell seiner faktischen Entscheidungstätigkeit“ (Luhmann, 1966: 51).[24] Zwar folgt wohl auch schon die Gedankenproduktion logischen Bahnen. Andernfalls würden Psychiater dem Denker formale Denkstörungen bescheinigen. Aber bei der Gedankenproduktion ist eher eine Alltagslogik[25] am Werk als die Logik der Subsumtion.
41
Die Subsumtion, von der das Modell seinen Namen bezieht, ist ein ebenso unentbehrlicher wie trivialer logischer Vorgang. Der Vorgang ist unentbehrlich, solange man an der Regelhaftigkeit des Normbegriffs festhält. Der Vorgang ist trivial, weil mit dem so genannten Justizsyllogismus lediglich die Konsequenz aus der Übereinstimmung des Sachverhalts mit den Tatbestandsmerkmalen eines vollständigen Rechtssatzesfestgestellt wird. Trivial ist allerdings nur die Logik der Subsumtion. Kein Logiker würde in Abrede stellen, dass die Ermittlung des Obersatzes, unter den subsumiert werden soll, und die Feststellung des Sachverhalts höchst problematisch sind. Um diesem Problem auszuweichen, werden in der juristischen Logik die Prämissen des Subsumtionsschlusses formalisiert.
42
Beginnend mit einer Darstellung von Ulrich Klug (1951) erlebte die juristische Logik in Deutschland und darüber hinaus einen Aufschwung als analytische Disziplin. Hassemer (2007: 126f.; 2008: 8) entnimmt der Logikliteratur die „Botschaft: Wenn juristische Logik erst das Licht der Welt erblickt, ist es aus mit den Möglichkeiten der Justiz, dem Gesetz im Prozess der Auslegung fremde Inhalte zu unterschieben; Juristische Logik ist der Königsweg zur unbeschränkten Herrschaft des Gesetzes“. Das ist wohl eine Fehlinterpretation. Die Konjunktur der juristischen Logik erklärt sich viel eher vor dem Hintergrund des sich anbahnenden Informationszeitalters.
3) Das Dezisionismusargument
43
Juristische Urteile sind letztlich immer Werturteile, denn sie sagen, wie Menschen sich künftig verhalten sollen oder wie sie sich in der Vergangenheit hätten verhalten müssen. Eine Konsequenz der 1904 von Max Weber ausgelösten Debatte um die Objektivierbarkeit von Werturteilen ist die Annahme, dass juristische Urteile sich nicht definitiv begründen lassen und daher einen Akt der Willkür darstellen. Selbst bei der Anwendung eines eindeutigen Gesetzes steckt mindestens in der impliziten Entscheidung über seine Geltung ein Werturteil. Die Ansicht, juristische Entscheidungen seien als Werturteil stets willkürlich, ist zuerst von Carl Schmitt (1912) als Dezisionismusargument formuliert worden.[26] Schmitt ging es allerdings nicht nur um eine Beschreibung des Entscheidungsspielraums, sondern um die affirmative Auszeichnung politischer Autorität als Überwinderin des Zweifels. Eine jedenfalls im Ergebnis ähnliche Position nahm Kelsen ein (Kelsen 1960: 350 ff). Er beschränkte die Aufgabe der Rechtswissenschaft auf die wertfreie Erkenntnis des von Gesetzen regelmäßig eröffneten Entscheidungsspielraums. Zur authentischen Ausfüllung durch ein politisches Werturteil seien die zuständigen Organe, also vor allem die Gerichte berufen. In kritischer Absicht wurde die starke Form des Dezisionismusarguments in den USA zunächst von den sog. Legal Realists und später auch von Mitgliedern des Critical Legal Studies Movement übernommen. Heute ist eine schwache Form des Dezisionismusarguments verbreitet (Unterscheidung von Langenbucher 2002). Sie besagt, dass nicht in allen, aber doch in vielen Urteilen ein dezisionistischer Rest verbleibt, der sich nicht durch Begründungen ausräumen lässt und durch ein Werturteil überwunden werden muss. Die wichtigste moderne Gegenposition gegen das Dezisionismusargument bietet die Argumentationstheorie. Sie begegnet dem Werturteilsproblem mit der These, auch dort, wo der kognitive Bereich verlassen werde, sei das Recht nicht auf pure Dezision angewiesen, denn eine Entscheidung könne durch Argumente mehr oder weniger gut begründet werden (Alexy 2008; Neumann 2001: 243).
4) Entdecken oder erfinden?
44
„Richterkönig oder Subsumtionsautomat“ war nie wirklich die Alternative. Im Hintergrund stand und steht aber die Frage, ob (Juristen und) Richter das Recht bloß entdecken oder ob sie es erfinden. Wer die Frage im Sinne des Entdeckens beantwortet, behauptet nicht ohne weiteres, dass die Lösung offen zu Tage liegt und nicht einmal notwendig, dass sie immer aufgefunden werden kann, sondern allein, dass es eine richtige Entscheidung gibt. Ihre Entdeckung kann im Einzelfall sehr schwierig sein. Nicht selten bleibt sie sogar verborgen. Dworkin (1984) vertritt und verteidigt diese Vorstellung als single answer thesis, nämlich als die unausrottbare Idee, dass es jedenfalls im Prinzip auf jede Rechtsfrage eine einzige richtige Antwort gebe, die sich, wenn auch oft nur unter großen Mühen, auffinden lasse. Aber auch, wer der Ansicht ist, die juristische Entscheidung werde stets erst mit ihrer Herstellung erfunden, behauptet nicht zwangsläufig, dass solche „Erfindung“ reine Willkür sei, sondern akzeptiert, dass auch das „Erfinden“ transsubjektiven Methoden folgen kann. In der deutschen Methodenlehre wird die Idee der einzig richtigen Entscheidung kaum noch vertreten. Man hat sich weitgehend auf die Vorstellung geeinigt, dass es nicht selten mehrere vertretbare Antworten auf eine Rechtsfrage geben könne. Von diesem Standpunkt aus sieht Neumann (2011: 343) in dem Modell der einzig richtigen Entscheidung immerhin noch eine „unverzichtbare regulative Idee“ mindestens für die Rechtspraxis.
5) Die jüngere Methodendebatte
45
Nach 1945 gab es eine kurze Renaissance naturrechtlicher Ideen, die bald durch einen unreflektierten Alltagspositivismus abgelöst wurde. Der Methodenstreit kam wieder in Gang, als Theodor Viehweg in einem kleinen Buch, das erstmals 1953 erschien und in schneller Folge fünf Auflagen erlebte, das Rationalitätsmonopol der logisch-systematischen Methode bestritt. Als überlegenen Konkurrenten brachte er mit der Topik eine klassische Form der rhetorischen Argumentation ins Spiel, die auf die Sacheinsicht der an der Diskussion Beteiligten und deren Konsens über die Vernünftigkeit plausibler Begründungen oder die Zurückweisung unhaltbarer Positionen baut. Die Gedanken Viehwegs sind zwar vom Mainstream der Jurisprudenz zurückgewiesen worden, haben aber in der Folgezeit einigen Einfluss auf die Theorie der juristischen Argumentation gehabt und leben im Übrigen als juristische Rhetorik in Arbeiten seiner Schüler[27] fort. „Eine juristische Methodenlehre“, so Gräfin von Schlieffen (2011: 110), sei „ohne Kenntnis der Vielfalt rhetorischer Formen unvollständig“.
46
Zur Universaltheorie der juristischen Methode wurde die Hermeneutik. Hermeneutik ist ein Etikett für sehr verschiedene Verfahren des Umgangs mit Sinngebilden, insbesondere mit Texten. Theologie und Jurisprudenz haben seit Schleiermacher und Savigny[28] eine hermeneutische Tradition.[29] In den 1960er Jahren begannen viele Juristen jedoch, jene „hermeneutische Ontologie“ oder „ontologische Hermeneutik“ zu rezipieren, wie sie sich von Dilthey bis Heidegger entfaltet hatte und nunmehr durch Hans-Georg Gadamers „Wahrheit und Methode“[30] repräsentiert wurde.[31] Sie wendet sich dagegen, Hermeneutik bloß als „Kunstlehre der Auslegung“ zu verstehen, die mit einem Kanon anerkannter Methoden arbeitet. Arthur Kaufmann meinte, die von Savigny herrührende Auslegungslehre, nach der es nur die geschlossene Zahl von vier „Elementen“ gebe, sei durch die Hermeneutik als falsch nachgewiesen worden.[32]
47
Der ontologischen Hermeneutik ist es nicht gelungen, ihre Ideen in praxistaugliche Methoden zu übersetzen. Als Kunstlehre der Auslegung bleibt Hermeneutik unzureichend, wenn sie von der Autonomie des Textes ausgeht und sich als bloße Verstehenslehre begreift, im Gegensatz zu einer Kommunikationslehre, die einen Text nicht als geschichts- und kontextloses Material nimmt, sondern den Gesamtzusammenhang seiner Entstehung als Voraussetzung der Interpretation berücksichtigt.
48
Die Methodenkritik erhielt neuen Schub, als Josef Esser 1970 in seiner Schrift „Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung“ die Brauchbarkeit der Standardmethoden in Frage stellte, da die verschiedenen Auslegungsmethoden nicht selten zu abweichenden Ergebnissen gelangten, so dass die Entscheidung von der Wahl der Auslegungsmethode abhängen könne.[33] Da eine klare Hierarchie unter den Methoden nicht erkennbar sei, sei die Entscheidung von dem immer irgendwie politisch geprägten Vorverständnis des Richters abhängig. Esser zielte damit nicht auf eine Kritik der „politischen Richters“, sondern blieb im Paradigma der Hermeneutik, der das Vorverständnis als objektivierende Grundlage der Interpretation dient.[34] Für die gesellschaftskritisch orientierte Methodenkritik wurde das „Vorverständnis“ aber alsbald zum Einfallstor für eine Kritik des Rechts als politisch.
49
Der analytischen Rechtstheorie[35], die der Rechtsanwendung mit logischen und wahrscheinlichkeitsmathematischen Methoden aufhelfen wollte, ist der Durchbruch versagt geblieben. Ihr sprachphilosophischer Ansatz konzentrierte sich darauf, die Ambiguitäten der natürlichen Sprache zu beschreiben. Dazu dienten die Kategorien Vagheit, Mehrdeutigkeit und Porosität. Die logischen Untersuchungen bescheinigten der Rechtssprache eine weitgehende Unbestimmtheit und lenkten so den Blick auf die richterliche Rechtsschöpfung. Aber sie entgingen den Sichtbegrenzungen der hermeneutischen Auslegungslehre nicht, weil sie sich wie diese auf die wortsemantische Perspektive konzentrierten und darüber vernachlässigten, wie in realen Kommunikationen Ambiguität pragmatisch abgearbeitet wird (Hegenbarth 1982:102ff). Immerhin hat die analytische Rechtstheorie mit der Juristischen Begründungslehre von Koch und Rüßmann (1982) ein Standardwerk hinterlassen, das immer wieder, mindestens zur Klärung der eigenen Position, zitiert wird.
50
Als Fortsetzung der Hermeneutik Gadamers kann man den semantischen Holismus von Davidson[36] begreifen, der in Deutschland für die Jurisprudenz vor allem von Ralph Christensen aufgenommen worden ist.[37] Auch der Holismus ist eine Sprachphilosophie und setzt als solche die textsemantische Perspektive von Hermeneutik und analytischer Philosophie fort.[38] Seit Wittgenstein betont zwar jeder Sprachphilosoph, dass sprachliche Praxis auch eine soziale Praxis sei. Aber die linguistische Pragmatik wird nicht wirklich rezipiert. Die pragmatische Dimension der Sprache (Sprecher, Hörer, Kommunikationssituation) bleibt unterbelichtet.
VI. Neue Methodenkritik
1) Semantische und konstruktivistische Methodenlehre
51
Am Ausgang des 20. Jahrhunderts teilt sich die Methodenlehre weiter in zwei große Lager. Das eine wird oft als das traditionelle oder positivistische bezeichnet. Neutraler kann man von der semantischen Schule der Methodenlehre sprechen. Tragender Pfeiler dieser Schule ist die Vorstellung vom Wortlaut des Gesetzes als Ausgangspunkt und Grenze der Auslegung, allerdings in unterschiedlichen Schattierungen. Sie wird durch die großen Lehrbücher von Larenz/Canaris, Bydlinski und Pawlowski oder die kompakteren Darstellungen von Wank und Zippelius repräsentiert. Ihr führender Theoretiker ist wohl Ulfried Neumann. Ihr folgt der Mainstream der juristischen Dogmatik, und ihr folgen weitgehend die Gerichte. Sie stützt sich vor allem auf die klassische Hermeneutik und hat in der von Alexy entwickelten Argumentationstheorie eine kräftige Stütze gefunden. Sie investiert relativ wenig in epistemologische Debatten und vertraut auf die Standardmethoden der Auslegung. Das andere Lager, das die Rolle, aber nicht unbedingt das Erbe, der Freirechtsschule übernommen hat, sieht sich selbst als das neuere oder modernere. Es wird von Regelskeptizismus geprägt, der sich aus den wissenschaftstheoretischen Positionen postmoderner Rechtstheorie speist. Auch dieses Lager, das sich als das konstruktivistische kennzeichnen lässt, ist in sich wenig homogen. Eine relativ geschlossene Gruppe bildet die Müller-Schule (Friedrich Müller, Ralph Christensen, Hans Kudlich u. a.), die sich dadurch auszeichnet, dass sie mit großem Aufwand moderne Linguistik und Sprachphilosophie rezipiert[39] und am Ende zu erstaunlich konventionellen Lösungen findet.[40] Eine andere Gruppe besteht aus systemtheoretisch orientierten Autoren (Teubner, Amstutz, Ladeur, Vesting u. a.). Der Gegensatz der beiden Lager zeigt sich darin, dass die semantische Schule am Begriff der Rechtsanwendung festhält, während die Konstruktivisten regelskeptisch jeder Entscheidung prinzipiell den Charakter einer Neuschöpfung zusprechen.
52
Esser (1970: 71ff) hatte darauf hingewiesen, dass das Konzept einer bloßen Anwendung von Rechtsnormen durch die Rede von der Konkretisierung verdrängt worden sei. Sie besagt in ihrer schlichten Gestalt, dass eine für die unmittelbare Anwendung noch zu allgemeine Norm spezifiziert werden muss, damit eine Subsumtion möglich wird. Das Ergebnis ist die nunmehr genauer formulierte, anwendungsgeeignete Regel. Elaborierter sind die (von Fikentscher[41] so genannten) Gleichsetzungslehren, die durch wechselseitige Zurichtung von Recht und Sachverhalt die Subsumtion überflüssig machen. Als Vertreter nannte Fikentscher Engischs Lehre von der Konkretisierung[42], die von Esser in „Grundsatz und Norm“ ausgeführte Idee, nach der die Entscheidung zugleich Interpretation und die Interpretation zugleich Entscheidung sei[43], und Arthur Kaufmanns Konzept einer hermeneutischen Verdichtung, die Recht und Sachverhalt assimiliert[44]. Fikentscher steuerte noch seine Lehre von der „Fallnorm“ bei.[45] Solche Konkretisierung erschöpft sich zwar nicht in nackter Subsumtion, bleibt aber als Zurichtung eines nicht substanzlosen Textes doch Rechtsanwendung.
53
Erst mit der postmodernen Rechtstheorie wird die Konkretisierung zur Konstruktion.[46] Nach dem Vorbild der Literaturwissenschaftler, die den Tod des Autors ausgerufen haben, verkünden Konstruktivisten den Tod des Gesetzgebers. Sie sprechen seinen Texten einen semantischen Gehalt ab und erklären die Gesetzesbindung zur Fiktion.[47] Die Konstruktion ist eine doppelte. Zunächst wird der prinzipiell für unbestimmt gehaltene Normtext in der Anwendungssituation zur konkreten Entscheidung gestaltet. Darüber hinaus verändere jede Heranziehung einer Norm als Entscheidungsgrundlage die Norm selbst und lasse damit die Vorstellung einer bloßen Anwendung von Rechtsnormen obsolet werden. Die „Verschleifung von Regel und Anwendung“ (Ladeur) und damit die „Erschütterung der Trennung von Rechtssetzung und Rechtsanwendung“ führe dazu, die „Vorstellung eines steuernden Subjekts in Form des Gesetzesautors“ zu verabschieden (Augsberg 2007: 491).
54
Hinter der These von der Verschleifung von Regel und Entscheidung steckt ein theoretisch wohl begründeter, aber für die Praxis unangemessener Regelskeptizismus. Es ist an sich richtig, dass jede Anwendung einer Norm auf die Norm selbst zurückwirkt. Es ist auch gar nicht selten, dass eine Norm im Zuge ihrer Verwendung eine inhaltliche Veränderung erfährt. Aber der Normalfall der Anwendung führt eher zu einer Befestigung der Norm. Auch durch eine ganz unproblematische Anwendung wird die Regel bestätigt und gefestigt. Durch jede Konkretisierung wird die Summe der erinnerten oder vorgestellten Anwendungsfälle konsolidiert. In der großen Mehrzahl der Anwendungsfälle ist die Veränderung so marginal, dass das Anwendungskonzept Bestand haben kann.[48]
55
Es geht hier um Anderes und mehr als um eine bloße Methodenfrage, nämlich um unterschiedliche juristische Weltsichten (Fischer 2007: 140). Wenn man das Anwendungskonzept verwirft, hat das Folgen. Wer der Ansicht ist, eine Rechtsanwendung sei gar nicht möglich, versteht sich bei der Herstellung juristischer Entscheidungen als Gestalter und fühlt sich im Umgang mit Gesetz und Präjudizien freier. Vesting (2007: Rn. 225) sieht die Aufgabe einer modernen Methodenlehre darin, „das Bewusstsein für die Eigenleistung der rechtsprechenden Gewalt“ zu schärfen und will dazu „die Vorstellung einer hierarchischen Überordnung des Gesetzgebers über den Richter … aufgeben“. Praktisch folgt daraus eine größere Nähe zu der so genannten objektiven Auslegungstheorie mit der Konsequenz etwa, dass „Normbildung“ oder „Rechtsfortbildung“ zum Prozesszweck erhoben werden. Die semantische Schule dagegen müsste eigentlich eher der subjektiven Auslegungstheorie zuneigen. Sie ist insoweit jedoch gespalten. Während für die einen die Anwendung des Rechts die Anwendung von Gesetzen und die Bezugnahme auf Regeln aus Präjudizien bedeutet, verstehen andere, für die stellvertretend Alexy genannt sei, Rechtsanwendung nicht bloß als Anwendung vorfindlicher Regeln, sondern als Anwendung des Rechts einschließlich seiner Prinzipien und Werte. Auch die Erwartung, dass die semantische Schule eher dem von Sunstein (1999) so genannten Rechtsprechungsminimalismus[49] zuneigt, lässt sich nicht bestätigen. Schließlich ist auch die betonte Einzelfallabwägung, die eher bei Konstruktivisten naheliegt, in beiden Lagern anzutreffen.
2) Methodenkritik der postmodernen Rechtstheorie
56
Postmoderne Rechtstheorie[50] baut auf einen fundamentalen Antifundamentalismus und auf radikalen Konstruktivismus, die beide aus der Wissenschaftstheorie in die Methodenlehre importiert werden. Sie knüpft bei Wittgenstein und Kripke, bei Quine und Davidson, bei Sellars und Brandom an. Sie tauscht Kant gegen Nietzsche und sucht sich ihre Kronzeugen in Frankreich: Foucault und Deleuze, Derrida und Lyotard. Oder sie übernimmt von Luhmann die autopoietische Version der Systemtheorie.
57
Postmoderne Rechtstheorie verabschiedet die Cartesianische Bewusstseinsphilosophie und mit ihr die klassischen Wahrheitstheorien, die Subjekt-Objekt-Trennung und den Dualismus von Sein und Sollen. Bei der Beobachtung der Welt stößt sie auf blinde Flecken, irritierende Paradoxien und Iterativität im Sinne transformierender Wiederholung. Bei der Beobachtung des Rechts findet sie den Verlust etatistischer Einheit, Pluralisierung des Rechts, Fragmentierung der Gesellschaft und konfligierende Binnenrationalitäten oder Eigenlogiken in den Fragmenten.
58
59
„Die Entscheidung muß über sich selbst, aber dann auch noch über die Alternative informieren, also über das Paradox, daß die Alternative eine ist (denn sonst wäre die Entscheidung keine Entscheidung) und zugleich keine ist (denn sonst wäre die Entscheidung keine Entscheidung).“ (Luhmann 2000: 142)
60
Damit spielt Luhmann auf die Vorstellung an, dass juristische Entscheidung Rechtserkenntnis sei. Wenn die Lösung jedoch schon vorgezeichnet ist und bloß erkannt zu werden braucht, gibt es nichts zu entscheiden. Ist sie dagegen nicht aus Regeln ableitbar, kann man nicht entscheiden. Darin liegt also das Paradox. Auch wenn juristische Entscheidungen in der Methodenlehre noch immer gern als Rechtserkenntnis dargestellt werden, hat sich doch die Jurisprudenz längst von der Vorstellung verabschiedet, dass ihre Urteile kognitiver Natur sind. Luhmann beutet nur den Doppelsinn der Begriffe aus; einmal verwendet er Entscheidung für den kognitiven Vorgang der Deduktion, das andere Mal gleichbedeutend mit Dezision. Auch der Zirkel, „der sich ergeben würde, wenn man zugeben müsste, dass das Gericht das Recht erst ‚schafft‘, das es ‚anwendet‘ “ Luhmann 1993:306) ist keiner. Ein Zirkel ergibt sich nur, wenn man sich über den Doppelsinn des Wortes »Recht« als vorgegebene Regel und als Fortbildung der Regel täuschen lässt. Man kann auch sagen: Was uns höchst kunstvoll als Paradoxie des Entscheidens oder als Auslegungsparadox vorgeführt wird, ist nichts anderes, als das alte Werturteilsproblem in neuer, nicht gerade nutzerfreundlicher Verpackung.
61
Die postmoderne Rechtstheorie versteht sich als externe Beobachterin der Rechtspraxis. Wegen des rechtsexternen Beobachterstandpunkts sind ihre Beschreibungen aber zu einer Kritik der juristischen Methodenlehre prinzipiell ungeeignet. Aus dem von Luhmann entwickelten Gedanken der Autonomie des Rechtssystems müssten sie der juristischen Methode ihre Eigenständigkeit belassen. Doch wiewohl immer wieder betont wird, dass alle wissenschaftlichen Aussagen relativ zum Standpunkt des Beobachters seien, wird die vom Selbstverständnis der Methodenlehre abweichende Fremdwahrnehmung in Kritik umgemünzt.
62
Systemtheoretisch orientierte Autoren beschreiben die Rechtsgewinnung als evolutionäres Geschehen. Als Folge des technologischen Wandels und der unaufhaltsamen Globalisierung, der sich beschleunigenden Selbsttransformation der Gesellschaft und deren wachsender Komplexität werden der Verlust der Einheit, zunehmende Fragmentierung und Pluralisierung des Gegebenen und der Zerfall von hierarchischen oder vertikalen Systemen festgestellt. Die methodische Einsicht lautet, nur die ständige Revision des Rechts im Zuge seiner Anwendung könne der Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen. Die Dynamitätsrhetorik, von der diese Einsicht getragen wird, wird nahezu widerspruchslos hingenommen, verliert aber im Rückblick an Plausibilität. Spätestens seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts hat wohl jede Zeit von sich selbst den Eindruck, sie entwickle sich besonders schnell und radikal. Die gesellschaftliche Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert war aus der Sicht der Zeitgenossen nicht weniger aufregend als in der zweiten oder nach der Jahrtausendwende.
63
Kaum überzeugender sind methodische Ratschläge, die aus einer Analyse postkolonialer Gesellschaften und transnationaler Rechtsbildungen abgeleitet werden. Für beide Felder lautet die Diagnose auf Rechtspluralismus. Die modernen rechtstheoretischen Konzepte – Stufenbau des Rechts, Gerichtshierarchie, öffentlich-rechtlich und privatrechtlich, national und international, Koordination durch das Völkerrecht – funktionierten weder hier noch dort. In der „Global Bukowina“ – so Teubner (1996) unter Anspielung auf das „lebende Recht“ Eugen Ehrlichs – hätten sich verschiedene Rechtsregimes von unterschiedlichen Ausgangspunkten her – also polyzentrisch – entwickelt, und sie stünden ohne Hierarchie „heterarchisch“ nebeneinander. Die Schwäche des globalen Rechtssystems zeige sich darin, dass es nicht im Stande sei, die verschiedenen Rechtsregimes zu koordinieren. Längst habe aber auch das staatliche Recht die Kraft zur Regulierung der Gesellschaft verloren. Von außen ragten transnationale Rechtsregime hinein und innen betrieben gesellschaftliche Kräfte aller Art das Werk der Selbstregulierung. Im Weltrecht werde die Koordination nur durch „Interlegalität“ erreicht. Gemeint ist, „dass parallele Normensysteme unterschiedlicher Herkunft sich wechselseitig anregen, gegenseitig verbinden, ineinander greifen und durchdringen, ohne zu einheitlichen Superordnungen zu verschmelzen, die ihre Teile absorbieren, sondern in ihrem Nebeneinander als heterarchische Gebilde dauerhaft bestehen, kurzum, das Rechtspluralismus Realität ist“ (Amstutz 2003: 213). Der Rat an die Methodenlehre geht dahin, die Realität des Rechtspluralismus zu akzeptieren und nach dem Vorbild der Kollisionsregeln des Internationalen Privatrechts zu verfahren (Teubner/Korth 2009; Vesting 2007: Rn. 185). Wollte die Methodenlehre diesem Rat folgen, verlöre sie ihr wichtigstes Instrument zum Umgang mit Normkollisionen, nämlich das Konzept einer gestuften Rechtsquellenhierarchie.
64
Natürlich darf und muss man die Frage stellen, ob das Rechtssystem sich weiterhin mit dem klassischen Modell des Stufenbaus beschreiben lässt oder ob nicht eher das Bild eines (heterarchischen) Nebeneinander adäquat ist. Für das transnationale Recht jenseits der Staaten und ihrer Unionen gab es indessen nie eine hierarchische Ordnung, so dass die Pluralitätsdiagnose für das transnationale Rechts eher trivial anmutet. Bemerkenswerter ist vielleicht sogar, dass auch im Völkerrecht Zentralisierungstendenzen zu beobachten sind. Die Europäische Union hat längst eine hierarchische Gestalt gewonnen. Wenn in modernen Staaten westlichen Musters tatsächlich staatsunabhängige Einrichtungen wie Vereine und Universitäten, Unternehmen und NGOs normative Substanz beisteuern, so zeigt sich darin für den soziologischen Beobachter plurales oder gesellschaftliches Recht. Für die Methodenlehre wird solcher Rechtspluralismus jedoch erst relevant, wenn und soweit die Rechtsquellenlehre ihn verarbeitet hat. Vieles fügt sich als delegierte Rechtsetzung oder als Rechtsbildung qua Privatautonomie in das Stufenbaumodell ein, das letztlich auf die staatliche Verfassung zurückführt. Damit sind längst nicht alle modernen Formen gesellschaftlichen Rechts erfasst. Hier muss aber zunächst die Rechtstheorie vorarbeiten und neue Kategorien entwerfen, um gesellschaftliche Normbildungen zu rezipieren.[53]
65
Das Netzwerk ist kein juristischer Begriff (Buxbaum 1993). Handfeste Netzwerkbegriffe kennen nur die Mathematiker und die Soziologen.[54] In seiner Anwendung auf das Recht bleibt der Begriff insofern zweideutig, als er einerseits reale Phänomene – Vernetzung von politischen Akteuren oder Verwaltungsbehörden, von Wirtschaftsteilnehmern oder Wissenschaftlern – und andererseits die inhaltliche Konvergenz von Informationen und Argumenten bezeichnet. Zunächst dient der Netzwerkbegriff[55] der postmodernen Rechtstheorie aber als Metapher[56], mit deren Hilfe hierarchische Ordnungsvorstellungen ausgeräumt werden. „Die stabile, um das Verhältnis von Subjekt, Objekt und Vernunft zentrierte Synthesis der Verknüpfungen transformiert sich in ein Konfliktverhältnis multipler Ordnungen, deren Binnenrationalitäten nicht mehr auf das Subjekt als Zentrum verweisen, sondern anonyme Relationen koordinieren.“ (Ladeur 1995: 39) „Die Einführung des Netzwerksmodells ist … ein Versuch, die irritierenden Paradoxa durch Einführung von Unterscheidungen abzuspannen. Ein Polyperspektivismus soll das traditionell-rationalistische, auf Einheit fixierte Modell ablösen.“ Das „Denken in Netzwerken“ soll dem „deduktiv-rational“ über die Welt reflektierenden Subjekt einen „transversal-verknüpfenden Denkgestus“ nahelegen (Augsberg 2007: 485f.).
66
Als reales Phänomen ist die Vernetzung soziologisch interessant, weil jenseits einer bestimmten Verdichtung das Netz selbst zum Akteur wird. Juristisch ist solche Vernetzung relevant, weil damit über Rechtssubjektivität und Zurechnungsfragen neu entschieden werden muss.[57] Das sind wichtige Rechtsfragen, die man nicht in die Methodenlehre abschieben kann. Näher an der Methodenlehre sind Netzwerke unter Gerichten und Richtern[58], unter Rechtsprofessoren[59] sowie Zitationsnetzwerke in der juristischen Literatur[60] oder in Gerichtsurteilen[61]. Ihre Analyse kann zeigen, dass juristische Entscheidungen nicht unbedingt aus der Kraft der Argumente entstehen. Sie zeigt andererseits, wie eng tatsächlich Entscheidungen miteinander vernetzt sind. In realen Netzwerken kann man agieren. Man kann über Netzwerke nachdenken, sie beschreiben und analysieren. Aber ein „Denken in Netzwerken“[62] ist nicht denkbar. Der Rechtsanwender oder Entscheider kann nicht aus seiner Haut als Subjekt herausschlüpfen. Die Netzwerkperspektive eröffnet für ihn nur eine neue Beobachtungsebene.
67
Auch die Generierung und Verteilung von Wissensbeständen über Netzwerke ist ein reales Phänomen. Netzwerke bilden eine Informationsressource. Aber das bedeutet nicht, dass es darauf ankäme, in sozialen Netzwerken neue Informationsquellen zu erschließen. Die Methodenlehre kann ihre Adressaten schwerlich anleiten, sich als reale Personen oder Institutionen zu vernetzen oder ihr Material aus sozialen Netzwerken zu beziehen. Die juristische Methode ist auf die spezifisch juristischen Informationsquellen festgelegt. Vernetzung bedeutet für sie Vernetzung der Inhalte und Argumente. Diese Art der Vernetzung ist aber immer schon als Kohärenz im Blick der juristischen Methode gewesen. Neue Methoden lassen sich aus der Netzwerkperspektive bisher nicht ableiten.
3) Sprachphilosophischer Regelskeptizismus
68
Sprachphilosophisch orientierte Autoren haben die Methodenlehre durch die Übernahme des sprachphilosophischen Regelskeptizismus (Ausdruck von H. L. A. Hart) verunsichert, der sich an Kripkes Wittgenstein-Interpretation orientiert (Kripke 1987). Damit übertragen sie kurzschlüssig epistemologische Aporien auf die Praxis. Wittgensteins skeptisches Paradox ergibt sich daraus, dass einerseits keine feste Referenzbeziehung zwischen sprachlichem Ausdruck und bezeichnetem Gegenstand besteht, dass andererseits die Verständigung in der normalen Sprache aber doch ganz gut funktioniert.
69
Ein Sprachausdruck wird immer nur an endlich vielen Beispielen gelernt, aber auf zahllose gleiche oder ähnliche Gegenstände angewendet. Wenn jemand einen erlernten Begriff verwendet, folgt er anscheinend einer Regel, die sagt, dass der Ausdruck im konkreten Fall passt, die Verwendung somit korrekt ist. Aber die Tatsache eines Wortgebrauchs weist als solche nicht über sich hinaus und kann daher nicht als Norm für den künftigen Gebrauch fungieren. Jede neue Verwendung fordert eine Entscheidung, die sich nicht notwendig aus dem bisherigen Sprachgebrauch ergibt. Die Verwendung eines Begriffs ist also durch den bisherigen Gebrauch nicht festgelegt. Nur wenn man die Regel als Gebot verstehe, meinte Kripke, lasse sich beurteilen, ob der Wortgebrauch korrekt sei. Diese Normativitätsvoraussetzung scheitert aber an dem Regressproblem, denn keine Regel kann ihre eigene Anwendung regeln; die Norm wäre ihrerseits eine Regel, die man als Norm deuten müsste.[63] Solche Aporien zeigen sich jedoch nur, wenn man die Privatsprache einer isolierten Einzelperson betrachtet. Sie verschwinden, wenn man den Sprachgebrauch als soziale Praxis beobachtet.
70
Sprache gehorcht insofern keiner Norm, als sie sich laufend und unvorhersehbar ändert. Jeder Sprecher ist frei, neue Wortzeichen zu erfinden oder alte anders zu verwenden als bisher. Und jeder Entscheider glaubt vor der Entscheidung, er könnte anders, wenn er denn wollte. Aber das gilt immer nur für die Zukunft. Rückschauend betrachtet handeln alle im Großen und Ganzen wie gehabt. In der Vergangenheit war Sprache regelmäßig – oder sie wäre unverständlich gewesen. Insofern steckt in dem Schluss von der Entwicklungsoffenheit der Sprache auf die Unmöglichkeit einer Bedeutungsermittlung[64] die Übernahme von Kripkes fundamentalistischer Wittgenstein-Interpretation.
71
Bei Wittgenstein ging es um die Regeln der Sprachspiele. Die analoge Frage stellt sich für Rechtsregeln, denn auch eine Rechtsregel soll auf unbestimmt viele Fälle angewendet werden. Steht die Anwendung einer Regel auf einen neuen Fall in Frage, so geht es deshalb streng genommen nie um die bloße Anwendung der Regel, sondern um ihre Veränderung. Das ist die Position des (juristischen) Regelskeptizismus. Er spiegelt sich in der „Rechtsnormtheorie“ der Müller-Schule[65] (Müller 2001:361; Müller/Christensen 2009:225). Die Rezeption Wittgensteins, vermittelt durch den Linguisten Dietrich Busse (1988, 1992) hat sie dazu veranlasst, jede Wortauslegung, die eine vorgegebene Bedeutung ermitteln soll, zu verabschieden. Texte haben danach als solche keine Bedeutung, sondern bilden bloße Sprachdaten, mit denen erst im Zuge der „Textarbeit“ konstruktiv Sinn verbunden wird: „Der Normtext als Ausdruck, als Zeichen ‚hat’ seine Bedeutung nur so, wie sie ihm vom Rechtsarbeiter durch die Erklärungen gegeben wird, die den Text im Prozeß der Rechtserzeugung auf eine Lesart festlegen. Ohne die bliebe der Normtext ein Stück Papier, bedeckt mit Druckerschwärze, allenfalls bedeckt mit Chiffren. ... Die ‚Wortlautgrenze’ ist überhaupt keine, die durch die Sprache selbst vorgegeben wäre. (...) Eine solche Grenze ist in der Sprache zu errichten.“[66]
72
H. L. A. Hart meinte, der Regelskeptiker sei „manchmal ein enttäuschter Absolutist“, der entdeckt habe, „daß Regeln nicht das sind, was sie im Himmel des Formalisten wären … Der Begriff, den der Skeptiker von einer Regel hat, ist deshalb ein unerreichbares Ideal, und er wird seiner Enttäuschung dadurch Ausdruck verleihen, daß er überhaupt die Möglichkeit der Existenz von Regeln leugnet, wenn er entdeckt, daß der Begriff der Regel ein solches Ideal nicht hergibt.“ (1973, 193). Analog macht Neumann geltend, der Regelskeptiker sei im Grund ein enttäuschter Regelplatonist.[67] Er könne sich nur eine ideal existierende Regel mit scharfen Grenzen als verhaltens- und entscheidungsleitend vorstellen. Eine bloß soziale Praxis genüge ihm nicht als Regel.[68] In der Praxis sind viele Regeln durch übereinstimmende Erwartungen über ihre Anwendbarkeit in fiktiven Fällen und durch Anwendungsbeispiele (Präzedenzfälle) so gut etabliert, dass sie trotz aller theoretischen Berechtigung des Skeptizismus Bedeutung haben. Schon vor ihrer Anwendung im Streitfall sind Normen alles andere als virtuell. Auch ohne vorgängige Kommunikation und Entscheidung steuern sie vielfach das Verhalten.
73
Wortgebrauchsregeln haben allerdings die Besonderheit, dass sie im Normalfall funktionieren müssen, ohne benannt oder bewusst gemacht zu werden. Deshalb kann man auch nicht erwarten, dass die Explikation solcher Regeln, etwa die Heranziehung von Lexika, im Zweifelsfall weiterhilft. Und deshalb ist die Vorstellung von der Grenzfunktion des Wortlauts, die noch immer die Methodenlehre beherrscht, nicht haltbar, soweit sie die Bedeutung eines Rechtstextes nur aus dem Zusammenspiel von Wortbedeutung und sprachlichem Kontext entnehmen will. Daraus folgt jedoch kein methodischer Nihilismus. Auch wenn die Worte und Sätze der Rechtstexte als bloße Zeichen per se keine objektive Bedeutung haben, so gibt es doch eine allgemeine soziale Praxis, die Beliebigkeit ausschließt, und es gibt darüber hinaus für Rechtstexte die besondere soziale Praxis der interpretativen Gemeinschaft der Juristen, die schon bei der Produktion der Texte am Werk war und die bei der Interpretation mit relativ einheitlichen Konventionen und Deutungsansätzen arbeitet. Darauf hat ausgerechnet der Literaturtheoretiker Stanley Fish hingewiesen, nachdem er zunächst mit der Übertragung der Reader-Response-Theorie auf Rechtstexte Verwirrung gestiftet hatte.[69]
4) Die pragmatische Lösung: Skeptischer Bedeutungsrealismus
74
Mehr oder weniger alle[70] bekennen sich heute zur „Pragmatik“. Nach der ursprünglichen Bedeutung von „Pragmatismus“ besteht zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und ihrem Zweck ein untrennbarer Zusammenhang mit der Folge, dass es nicht auf eine korrekte Ableitung aus sicheren Fundamenten, sondern auf die praktische Bewährung ankommt. In der Sprachphilosophie ist jedoch aus „Pragmatismus“ – insbesondere bei Rorty, Sellars und Brandom[71] – ein Synonym für radikalen Konstruktivismus geworden, nämlich für die Auffassung, dass die Realität, mit der wir es zu tun haben, nicht vorgegeben ist, sondern durch kommunikative Praxis ständig neu erzeugt wird.[72] Doch in einem Akt der Kommunikation ist stets nur das wenigste neu. Hauptsächlich werden alte Bestände umgewälzt, und mit ihnen auch Rechtstexte. Dabei verändern sie sich nicht so grundlegend, dass sie ihre Bedeutung verlieren. Es ist anscheinend die List der kommunikativen Vernunft, dass sich am Ende doch so etwas wie Bedeutung durchsetzt.
75
Wissenschaftstheorie, auch im Gewand der Sprachphilosophie, hat zwar die Hoffnung auf eine definitiv abgesicherte Erkenntnis zerstört. Doch für die Alltagspraxis bedeutet das – abgesehen von einer allgemeinen Warnung vor Selbstgewissheit und Selbstgerechtigkeit – wenig. Kein Naturwissenschaftler verzichtet auf Experimente, weil er von Popper gelernt hat, dass eine Verifizierung von empirischen Gesetzen nicht möglich ist. Entsprechend ist die juristische Methode berechtigt, mit der Vermutung zu arbeiten, dass die Texte selbst Bedeutung haben. Ein Gesetzbuch ist kein Fahrplan. Aber Fahrpläne zeigen, dass man sich im Prinzip verständlich machen und verstanden werden kann. In der großen Mehrzahl der rechtlich relevanten Lebensvorgänge ist die Gesetzesanwendung unproblematisch. Deshalb lassen sich große Anwendungsbereiche sogar automatisieren, vom Mahnverfahren über Grundbuch und Steuererklärungen bis hin zur elektronischen Abwicklung vieler Verwaltungsverfahren im Rahmen des sog. E-Government. Und deshalb lässt sich auch mit erheblicher Zuversicht sagen, dass die Rechtsquellen, insbesondere die Gesetze, einen Informationsgehalt haben, der sich wiedergewinnen lässt.
76
Die Instanzgerichte haben es vor allem mit Streitigkeiten über den Sachverhalt, weniger mit Auslegungsfragen zu tun. Die Aufmerksamkeit der Wissenschaft ist daher auf die Obergerichte gerichtet, bei denen sich die Auslegungsfragen bündeln. Auf diese Weise konzentrieren sich die juristischen Bemühungen auf die unklaren Randbereiche, und deshalb tritt das Sichere perspektivisch hinter das Zweifelhafte zurück. In schwierigen Fällen sind Gesetze und Präjudizien keine zuverlässigen Wegweiser zu sicheren Entscheidungen. Aber sie sind auch nicht bedeutungslos.
77
Die Methodenlehre braucht nicht in die Tiefen von Wissenschaftstheorie und Sprachphilosophie vorzudringen. Sie kann sich mit einer empirisch orientierten pragma-linguistischen Sprachtheorie zufriedengeben, wie sie von Hegenbarth (1982) für die Rechtswissenschaft rezipiert worden ist.
V. Macht oder Ohnmacht der Methode?
1) Gesellschaftskritische Methodenskepsis
78
Die Kritik der Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts durch Interessenjurisprudenz und Freirechtsschule behauptete eine Entfremdung der Rechtswissenschaft von der gesellschaftlichen, politischen und moralischen Wirklichkeit des Rechts. Daher war es kein Zufall, dass die Gegenbewegung nicht philosophischen Ursprungs war, sondern ihren Ausgang von der neu entstandenen Wissenschaft von der gesellschaftlichen Realität, von der Soziologie nahm. Eine moderne Version soziologischer Jurisprudenz und Rechtskritik in den USA bildete das Critical Legal Studies Movement (CLS), das durch seine Radikalität, Pluralität und literarische Produktivität gleichermaßen auffiel.[73] Es verschärfte die Kritik des Legal Realism zu einem radikalen Unbestimmtheitstheorem[74] und verneinte damit die Möglichkeit eines demokratisch legitimierten Rechtspositivismus. Sein Credo lautete: Das Recht bleibt trotz aller Texte unbestimmt. Es bezieht seinen Inhalt erst aus dem politischen Vorverständnis der Beteiligten. Diese Bewegung wollte das Recht von gesellschaftstheoretischen Ansätzen her begreifen, erschöpfte sich aber in sozialphilosophischer Rechtskritik, insbesondere in einer Kritik der liberalen Sozialphilosophen und der von diesen bevorzugten Institutionen. So wurden die CLS zum Auffangbecken kritischer Rechtstheorie, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten als feministische Rechtstheorie, Critical Race Theory, Post-Colonial Studies oder gar Queer Theory firmiert.
79
Auch in Deutschland gab und gibt es immer wieder Vorstöße, welche die politische Färbung juristischer Entscheidungen kritisieren oder jedenfalls thematisieren und dafür auch Rechtstheorie und Methodenlehre bemühen.[75] Es liegt daher nahe, auch die verschiedenen Versionen der Methodenlehre bestimmten gesellschaftspolitischen Grundüberzeugungen zuzuordnen. Das mag bei einzelnen Autoren durchaus gelingen. Doch wenn man abstrakter auf die großen Theorielager blickt, bleiben die Affinitäten weitgehend unklar. Immerhin dürften Konservative eher im Lager der semantischen Schule anzutreffen seien, während man Liberale und Linke eher bei den Konstruktivisten suchen wird. Auch die Anhänger der objektiven und der subjektiven Auslegungstheorie verteilen sich, wenn auch nicht ganz gleichmäßig, auf beide Lager.[76]
2) Soziologischer Regelskeptizismus
80
Soziologie im Allgemeinen und Rechtssoziologie im Besonderen haben ein Zeitalter des reflexiven Umgangs mit sozialen Normen – und dazu gehören auch die Rechtsnormen – eingeleitet. Normen sind nicht länger eine Selbstverständlichkeit, sondern ein Problem. Soziologie reflektiert über Normen. Sie beschreibt, zählt und misst die Normen, nicht selten in kritischer Absicht. Derart ins Bewusstsein gehoben, haben die Normen einen Teil ihrer Wirkungskraft eingebüßt. Die Beteiligten haben sich in die Rolle des Beobachters begeben. Sie erhalten dadurch die Chance, gegenüber der Norm einen kritischen, zynischen oder taktischen Standpunkt einzunehmen. Die reflexive Einstellung gegenüber Normen ist nicht mehr allein die Einstellung der Wissenschaft. Sie ist durch die Medien weithin popularisiert worden und beherrscht heute nicht zuletzt den Erziehungsprozess. Damit ist in der juristischen Profession ebenso wie im Publikum das Vertrauen in die Berechenbarkeit und Objektivität des Rechts und der Rechtsprechung geschwunden. Jedenfalls gehört es sich, so zu reden, als ob das Recht unsicher sei, während man doch meistens so handelt, als ob man sich darauf verlassen könne.
81
Die Rechtssoziologie hat empirisch wenig dazu beigetragen, was den Regelskeptizismus stützen könnte. Schulz-Schaeffer (2004) hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich kaum wirklich mit der juristischen Dogmatik (gemeint ist vor allem: mit der Methode) befasst habe. Man habe vielmehr „Irrtumssoziologie“ betrieben. Das soll heißen, man habe mit verschiedenen Ansätzen (Richtersoziologie, Verfahrenssoziologie) nachgewiesen, dass sich am Ende soziale Ungleichheit immer wieder durchsetze, ohne aber dabei den Anteil der juristischen Dogmatik und der Methode auszutesten. Immerhin kam Rottleuthner (1984) in einer breit angelegten Untersuchung der Arbeitsgerichtsbarkeit zu dem „überraschenden Befund“, dass sich bei den Richtern im Interview zwar durchaus mehr oder weniger arbeitnehmerfreundliche Einstellungen zeigten, dass sich aber zwischen diesen Einstellungen (und auch zwischen weiteren sozialen Hintergrundmerkmalen) und einer arbeitnehmerfreundlichen Entscheidung kein Zusammenhang ergeben habe. Auf der anderen Seite haben wohl über 200 Untersuchungen über den US Supreme Court eine gewisse ideologische oder parteipolitische Konstanz bei einzelnen Richtern belegen können.[77] Nach erneuter Durchsicht der amerikanischen Justizforschung kommt Tamanaha (2010: 132ff.) jedoch zu dem Ergebnis, die Forscher hätten die falsche Frage gestellt. Sie hätten beweisen wollen, dass Richter politisch urteilen, und dabei übersehen oder gar unterdrückt, wie gering der Einfluss politischer Einstellungen auf die Entscheidungen in Wirklichkeit sei.
3) „Unbegrenzte Auslegung“ in der Zeit des Nationalsozialismus
82
Ihrer härtesten Bewährungsprobe war die juristische Methode in der Zeit des Nationalsozialismus ausgesetzt, als das Recht zum Instrument einer menschenverachtenden Politik wurde. Heute ist jede Rechtsanwendung mit einem Gerechtigkeitsvorbehalt versehen, der aus Art. 1, 20 III GG und übernationalen Rechtsquellen, insbesondere der Europäischen Menschenrechtskonvention, hergeleitet wird. Die Frage nach der Bewährung der juristischen Methode in der NS-Zeit ist nur sinnvoll, wenn man diesen Vorbehalt ausklammert und annimmt, dass sich die Rechtsanwender methodengerecht an die positiv geltenden Gesetze, und nur an diese, gehalten hätten. Nur dann zeigt sich, ob die Standardmethoden versagt haben. Zu diesem Problemkreis liegen außer der grundlegenden Arbeit von Rüthers (1997 [1968]) weitere Untersuchungen vor.[78] Das nationalsozialistische Recht arbeitete, wie Rüthers eindringlich dargestellt hat, mit einer geradezu paradoxen Mischung von formal-positiven Gesetzen und ideologieoffenen Generalklauseln. Am Ende beantwortet Rüthers die Frage, „ob die juristische Methodenlehre nicht wirksame Schranken gegen die durch Auslegung bewirkte Umdeutung des gesamten Privatrechts im Dienste eines totalitären System errichten könne“, mit einem „eindeutigen Nein“ (1997:442 f.). Nach den Anforderungen, die Rüthers an die juristische Methode von heute stellt, war die nationalsozialistische Auslegungspraxis jedoch alles andere als methodengerecht. Das gilt selbst dann, wenn man, anders als Rüthers, auch eine objektiv-teleologische Auslegung von Gesetzen akzeptiert (Ogorek 2010). Mit gutem Grund hat Luig daher gegen Rüthers geltend gemacht, „daß die wirklich gravierenden Unrechtsurteile jeder Methode spotteten“ (1992:2537). Tatsächlich zeigt Rüthers durch die Analyse einzelner Urteile, dass die Gerichte in der NS-Zeit unter dem Vorwand der Auslegung die Gesetze nach politischen Vorgaben des Regimes korrigiert haben (Rüthers 1997: 148 ff., 197 f.). Die korrekte Anwendung der Standardmethoden hätte selbst bei positivistischem Gesetzesgehorsam viele Unrechtsurteile verhindern können.
Bibliographie
Axel Adrian, Grundprobleme einer juristischen (gemeinschaftsrechtlichen) Methodenlehre, Die begrifflichen und ("fuzzy"-)logischen Grenzen der Befugnisnormen zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und die Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, Berlin 2009
Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation (1978), Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung; Nachwort (1991): Antwort auf einige Kritiker, 6. Aufl., Frankfurt am Main 2008
Joachim Arntz/Hans-Peter Haferkamp/Margit Szöllösi-Janze, Justiz im Nationalsozialismus, Positionen und Perspektiven, Hamburg 2006
Anthony Arnull, The European Union and its Court of Justice, 2. ed., Oxford 2006
Ino Augsberg, Das Gespinst des Rechts. Zur Relevanz von Netzwerkmodellen im juristischen Diskurs, Rechtstheorie 38, 2007, 479-493.
Carsten Bäcker, Begründen und Entscheiden, Kritik und Rekonstruktion der Alexyschen Diskurstheorie des Rechts, Baden-Baden 2008
Rolf Bender, Das „Sandhaufentheorem“, Ein Beitrag zur Regelungstechnik in der Gesetzgebungslehre, in: U. Klug (Hg.), Gesetzgebungstheorie, juristische Logik, Zivil- und Prozessrecht, Gedachtnisschrift für Jürgen Rödig, Berlin 1978, S. 34ff.
Stefan Brink, Über die richterliche Entscheidungsbegründung, Funktion - Position - Methodik, Frankfurt am Main 1999
Wolfgang Buerstedde, Juristische Methodik des Europäischen Gemeinschaftsrechts, Ein Leitfaden, Baden-Baden 2006
Dietrich Busse, Zum Regelcharakter von Normtextbedeutungen und Rechtsnormen, Was leistet Wittgensteins Regelbegriff in einer anwendungsbezogenen Semantik für das Interpretationsproblem der juristischen Methodenlehre?, Rechtstheorie 19, 1988, 305-322.
Dietrich Busse, Recht als Text, Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution, Tübingen 1992
Dietrich Busse, Ist die Anwendung von Rechtstexten ein Fall von Kommunikation?, Rechtslinguistische Überlegungen zur Institutionalität der Arbeit mit Texten im Recht., in: Kent D. Lerch (Hg.), Recht vermitteln, Strukturen, Formen und Medien der Kommunikation im Recht, Bd. 3, Berlin 2005, S. 23-53.
Richard M. Buxbaum, Is „Network“ a Legal Concept, Jounal for Institutional and Theoretical Economics (JITE) 149 , 1993, 698-705.
Franz Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl., Wien , New York 1991
Claus-Wilhelm Canaris/Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtwissenschaft, 4. Aufl., Berlin 2006
Ralph Christensen, Was heißt Gesetzesbindung?, Eine rechtslinguistische Untersuchung, Berlin 1989
Ralph Christensen/Andreas Fischer-Lescano, Das Ganze des Rechts, Vom hierarchischen zum reflexiven Verständnis deutscher und europäischer Grundrechte, Berlin 2007
Ralph Christensen/Hans Kudlich, Theorie richterlichen Begründens, Berlin 2001
Ralph Christensen/Hans Kudlich, Gesetzesbindung, Vom vertikalen zum horizontalen Verständnis, Berlin 2008
Helmut Coing, Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik, Köln 1959
Martina R. Deckert, Die folgenorientierte Auslegung, JuS, 1995, 480-484.
Mary Douglas, Wie Institutionen denken, Frankfurt am Main 1991
Gunnar Duttge, Zum typologischen Denken im Strafrecht, Ein Beitrag zur „Wiederbelebung“ der juristischen Methodenlehre, Jahrbuch für Recht und Ethik 11, 2003, 103-126.
Ronald Dworkin, Bürgerrechte ernst genommen, Frankfurt am Main 1984 (Taking Rights Seriously, 1977)
Eugen Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, München 1913
Karl Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, Heidelberg 1943
Karl Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, 1953, 2. Aufl., Heidelberg 1968
Josef Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Rationalitätsgrundlagen richterlicher Entscheidungspraxis, 2. Aufl., Kronsberg/Ts. 1972
Josef Esser, Bemerkungen zur Unentbehrlichkeit des juristischen Handwerkszeugs, Juristenzeitung 1975, 555-558.
Josef Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts (1956), Rechtsvergleichende Beiträge zur Rechtsquellen- und Interpretationslehre, 4., unveränderte Aufl., Tübingen 1990
Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, 5 Bde., Tübingen 1975-1977
Christian Fischer, Topoi verdeckter Rechtsfortbildungen im Zivilrecht, Tübingen 2007
Andreas Fischer-Lescano/Ralph Christensen, Auctoritatis Interpositio. Die Dekonstruktion des Dezisionismus durch die Systemtheorie, Der Staat 44 , 2005, 213-242.
Stanley Eugene Fish, Is There a Text in This Class?, The Authority of Interpretive Communities, Cambridge Mass. 1980
Stanley Eugene Fish, Doing What Comes Naturally, Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies, Oxford 1989
Axel Flessner, Juristische Methode und europäisches Recht, Juristenzeitung , 2002, 14-23.
Stephan M. Grundmann, Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts durch den Europäischen Gerichtshof, Zugleich eine rechtsvergleichende Studie zur Auslegung im Völkerrecht und im Gemeinschaftsrecht, Konstanz 1997
Susan Haack, Manifesto of a Passionate Moderate, Unfashionable Essays, Chicago 1998
Peter Häberle, Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, Juristenzeitung , 1975, 297-305.
Peter Häberle, Grundrechtsgestaltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat – zugleich zur Rechtsvergleichung als „fünfter“ Auslegungsmethode, Juristenzeitung , 1989, 913-919.
Hans-Peter Haferkamp, Georg Friedrich Puchta und die "Begriffsjurisprudenz", Frankfurt am Main 2004
Günter Hager, Rechtsmethoden in Europa, Tübingen 2009
H. L. A. Hart, Der Begriff des Rechts, [The Concept of Law, 1961], Frankfurt am Main 1973
Winfried Hassemer, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, in: Winfried Hassemer (Hg.), Erscheinungsformen des modernen Rechts, Bd. 26, Frankfurt am Main 2007, S. 119-151.
Winfried Hassemer, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, Rechtstheorie 39, 2008, 1-22.
Görg Haverkate, Gewißheitsverluste im juristischen Denken, Zur politischen Funktion der juristischen Methode, Berlin 1977
Philipp Heck, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tübingen 1932
Philipp Heck, Das Problem der Rechtsgewinnung (1912), 2. Aufl., Tübingen 1932
Rainer Hegenbarth, Juristische Hermeneutik und linguistische Pragmatik, Königstein/Ts. 1982
Birte Hellmig, Recht als Verantwortungsinstanz – Ein empirischer Beitrag zu den Funktionen von Recht, in: Michelle Cottier u. a. (Hg.), Wie wirkt Recht?, Ausgewählte Beiträge zum Ersten Gemeinsamen Kongress der Deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereinigungen, Luzern, 4. - 6. September 2008, Bd. 1, Baden-Baden 2010, S. 391-407.
Thomas Henninger, Europäisches Privatrecht und Methode, Entwurf einer rechtsvergleichend gewonnenen juristischen Methodenlehre, Tübingen 2009
Manfred Herbert, Rechtstheorie als Sprachkritik, Zum Einfluß Wittgensteins auf die Rechtstheorie, Baden-Baden 1995
Burkhard Heß, Methoden der Rechtsfindung im Europäischen Zivilprozessrecht, IPRax , 2006, 348.
Wolfgang Hoffmann-Riem, Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Eberhard Schmidt-Aßmann u. a. (Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, Baden-Baden 2004, S. 9-72.
Klaus J. Hopt, Was ist von den Sozialwissenschaften für die Rechtsanwendung zu erwarten?, Juristenzeitung 1975, 341-349.
Ulrich Huber, Savignys Lehre von der Auslegung der Gesetze in heutiger Sicht, Juristenzeitung 2003, 1-17.
Hermann Isay, Rechtsnorm und Entscheidung, Berlin 1929
Dorothea Jansen, Theoriekonzepte in der Analyse sozialer Netzwerke, Entstehung und Wirkungen, Funktionen und Gestaltung sozialer Einbettung, Speyer 2007
Matthias Jestaedt, Wie das Recht, so die Auslegung, Zeitschrift für öffentliches Recht 55 , 2000, 133-162.
M. Ethan Katsh, The Electronic Media and the Transformation of Law, New York, NY 1989
Arthur Kaufmann, Analogie und "Natur der Sache". Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus, Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 22. April 1964, Karlsruhe 1965
Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien 1960
Andreas Kemmerling, Regel und Geltung im Lichte der Analyse Wittgensteins, Rechtstheorie 6, 1975, 104-131.
Urs Kindhäuser, Zur Definition qualitativer und komparativer Begriffe -- Eine Entgegnung auf Herschels Typologie im Arbeitsrecht, Rechtstheorie 12 , 1981, 226-248.
Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze, Semantische Normativität in der juristischen Argumentation, Baden-Baden 2004
Ulrich Klug, Juristische Logik, Berlin 1951
Florian Knauer, Juristische Methodenlehre 2.0?, Der Wandel der juristischen Publikationsformate und sein Einfluss auf die juristische Methodenlehre, Rechtstheorie 40, 2009, 379-403.
Hans Joachim Koch/Helmut Rüßmann, Juristische Begründungslehre, München 1982
Hans Joachim Koch/Helmut Rüßmann, Juristische Methodenlehre und analytische Philosophie, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie Beiheft 44, 1991, 186-200.
Horst Konzen, Normtatsachen und Erfahrungssätze bei der Rechtsanwendung im Zivilprozeß, in: Festschrift für Hans Friedhelm Gaul zum 70. Geburtstag, Bielefeld 1997, S. 335-356.
Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3. Aufl., Bern 2010
Martin Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, Entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation, 2. Aufl., Berlin 1976
Saul A. Kripke, Wittgenstein über Regeln und Privatsprache, (Wittgenstein on Rules and Private Language, 1982), Frankfurt am Main 1987
Hans Kudlich/Ralph Christensen, Wortlautgrenze: Spekulativ oder pragmatisch?, Zugleich Besprechung von Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der juristischen Argumentationstheorie (2004), Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 93 , 2007, 128-142
Lothar Kuhlen, Typuskonzeptionen in der Rechtstheorie, Berlin 1977
Karl-Heinz Ladeur, Computerkultur und Evolution der Methodendiskussion in der Rechtswissenschaft, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 74 , 1988, 218-238
Karl-Heinz Ladeur, Postmoderne Rechtstheorie, Selbstreferenz - Selbstorganisation - Prozeduralisierung, 2. Aufl., Berlin 1995
Karl-Heinz Ladeur, Die rechtswissenschaftliche Methodendiskussion und die Bewältigung des gesellschaftlichen Wandels, Zugleich ein Beitrag zur Bedeutung der ökonomischen Analyse des Rechts, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 64, 2000, 60-103
Katja Langenbucher, Die Entwicklung und Auslegung von Richterrecht, Eine methodologische Untersuchung zur richterlichen Rechtsfortbildung im deutschen Zivilrecht, München 1996
Katja Langenbucher, Vorüberlegungen zu einer Europarechtlichen Methodenlehre, in: Thomas Ackermann (Hg.), Tradition und Fortschritt im Recht, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1999, Stuttgart 2000, S. 65-83
Katja Langenbucher, Das Dezisionismusargument in der deutschen und in der US-amerikanischen Rechtstheorie, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 88, 2002, 399-406
Katja Langenbucher, Europarechtliche Methodenlehre, in: Katja Langenbucher/Andreas Engert (Hg.), Europarechtliche Bezüge des Privatrechts, 2. Aufl., Baden-Baden 2008, S. 1-40.
Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., Berlin 1991
Agnes Launhardt, Methodenlehre aus rechtsrhetorischer Perspektive: Abschied von der Normativität?, Rechtstheorie 32, 2001, 141-157.
Agnes Launhardt, Topik und Rhetorische Rechtstheorie, Eine Untersuchung zu Rezeption und Relevanz der Rechtstheorie Theodor Viehwegs, Frankfurt am Main 2010
Rüdiger Lautmann, Justiz - die stille Gewalt, Teilnehmende Beobachtung und entscheidungssoziologische Analyse, Frankfurt am Main 1972
Detlef Leenen, Typus und Rechtsfindung, Die Bedeutung der typologischen Methode für die Rechtsfindung dargestellt am Vertragsrecht des BGB, Berlin 1971
Kent D. Lerch (Hg.), Recht vermitteln, Strukturen, Formen und Medien der Kommunikation im Recht Bd. 3, Berlin 2005
Kent D. Lerch, Wissen oder Willkür? Zur Konstruktion des Rechtsfalls durch den Richter, in: Ulrich Dausendschön-Gay (Hg.), Wissen in (Inter-)Aktion, Verfahren der Wissensgenerierung in unterschiedlichen Praxisfeldern, Berlin 2010, S. 225-247.
Karl N. Llewellyn, Some Realism About Realism: Responding to Dean Pound, Harvard Law Review 44, 1931, 1222-1264.
Dirk Looschelders/Wolfgang Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, Zugleich ein Beitrag zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen von Gesetzesauslegung und Rechtsfortbildung, Berlin 1996
Niklas Luhmann, Funktionale Methode und juristische Entscheidung, Archiv des öffentlichen Rechts 94, 1969, 1-31
Niklas Luhmann, Die Paradoxie des Entscheidens, Verwaltungsarchiv 84 , 1993, 287-310
Niklas Luhmann, Organisation und Entscheidung, Opladen [u.a.] 2000
Klaus Luig, Macht und Ohnmacht der Methode, NJW, 1992, 2536-2539.
Axel Mennicken, Das Ziel der Gesetzesauslegung, Eine Untersuchung zur subjektiven und objektiven Auslegungstheorie, Bad Homburg 1970
Christoph Möllers, Braucht das öffentliche Recht einen neuen Methoden- und Richtungsstreit?, Verwaltungsarchiv 99, 1999, 187-207.
Thomas M. J. Möllers, Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, Klausur, Hausarbeit, Seminararbeit, Staatsexamen, Dissertation, München 5. Aufl., 2010
Friedrich Müller, Normstruktur und Normativität, Zum Verhältnis von Recht und Wirklichkeit in der juristischen Hermeneutik, entwickelt an Fragen der Verfassungsinterpretation, Berlin 1966
Friedrich Müller, Virtualität im Rahmen der strukturierenden Rechtslehre, Rechtstheorie 32, 2001, 359-371.
Friedrich Müller/Ralph Christensen, Juristische Methodik: Grundlegung für die Arbeitsmethoden der Rechtspraxis, 10. Aufl., Berlin 2009
Karlheinz Muscheler, Entstehungsgeschichte und Auslegung von Gesetzen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in: Joachim Bohnert (Hg.), Verfassung - Philosophie - Kirche, Festschrift für Alexander Hollerbach zum 70. Geburtstag, Berlin 2001, S. 99.
Olaf Muthorst, Gottfried Wilhelm Leibniz’ »Neue Methode, Jurisprudenz zu lernen und zu lehren« – ein Vordenker rechtswissenschaftlicher Fachdidaktik?, in: Judith Brockmann u. a. (Hg.), Exzellente Lehre im juristischen Studium, Auf dem Weg zu einer rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik, Bd. 1, Baden-Baden 2011, S. 97-105.
Ulfrid Neumann, Die Abgrenzung von Rechtsfrage und Tatfrage und das Problem des revisionsgerichtlichen Augenscheinsbeweises, Goldtammers Archiv, 1988, 387-402.
Ulfrid Neumann, Juristische Methodenlehre und Theorie der juristischen Argumentation, Rechtstheorie 32, 2001, 239-255.
Ulfrid Neumann, Theorie der juristischen Argumentation, in: Arthur Kaufmann u. a. (Hg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 8. Aufl., Heidelberg 2011, S. 333-347.
Regina Ogorek, Richterkönig oder Subsumtionsautomat?, Zur Justiztheorie im 19. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1986
Regina Ogorek, Alltagstheorien/Sonntagstheorien. Zum Einsatz „ungewissen Wissens“ bei der Rechtsanwendung, in: Regina Ogorek (Hg.), Aufklärung über die Justiz. Abhandlungen und Rezensionen I, Frankfurt am Main 2008, S. 413-438.
Regina Ogorek, Gefährliche Nähe? Richterliche Rechtsfortbildung und Nationalsozialismus, in: Felix Herzog/Ulfrid Neumann (Hg.), Festschrift für Winfried Hassemer, Heidelberg 2010, S. 159-171.
Dirk Olzen/Rolf Wank, Zivilrechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium, 6. Aufl., München 2010
Hans-Martin Pawlowski, Methodenlehre für Juristen, 3. Aufl., Heidelberg 1999
Niels Petersen, Braucht die Rechtswissenschaft eine empirische Wende?, Rechtstheorie 41, 2010, 435-455.
Claes Peterson, Zur Anwendung der Logik in der Naturrechtslehre von Christian Wolff, in: Jan Schröder (Hg.), Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und Philosophie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Beiträge zu einem interdisziplinären Symposion in Tübingen, 18. - 20. April 1996, Bd. 46, Stuttgart 1998, S. 177-189.
Karen Petroski, Does It Matter What We Say About Legal Interpretation?, http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1769680_code1099811.pdf?abstractid=1746102&mirid=1 (Stand: 2. 6. 2011).
Klaus Juergen Philippi, Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts, Köln, Berlin, Bonn, München 1971
Adalbert Podlech, Wertungen und Werte im Recht, Archiv des öffentlichen Rechts 95, 1970, 185-223.
Stephan Pötters/Ralph Christensen, Richtlinienkonforme Rechtsfortbildung und Wortlautgrenze, Juristenzeitung, 2011, 387-394.
Holm Putzke, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, Klausuren, Hausarbeiten, Seminare, Bachelor- und Masterarbeiten, 3. Aufl., München 2010
Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 12. Aufl. 1969
Peter Raisch, Vom Nutzen der überkommenen Auslegungskanones für die praktische Rechtsanwendung, Heidelberg 1988
Karl Riesenhuber (Hg.), Europäische Methodenlehre, Handbuch für Ausbildung und Praxis, 2. Aufl., Berlin 2010
Klaus F. Röhl, Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung, Tübingen 1974
Klaus F. Röhl/Hans Christian Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl., Köln 2008
Helmut Rüßmann, Normtatsachen – Ein vorläufiger Überblick, Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1991, 402-415.
Bernd Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus, 5. Aufl., Heidelberg 1997 [1968]
Bernd Rüthers, Die neuen Herren - Rechtsdogmatik und Rechtspolitik unter dem Einfluss des Richterrechts, Zeitschrift für Rechtsphilosophie 2005, 1-13.
Bernd Rüthers, Methodenrealismus in Jurisprudenz und Justiz, Juristenzeitung 2006, 53-60.
Bernd Rüthers, Methodenfragen als Verfassungsfragen, Rechtstheorie 40, 2009, 253-283.
Jürgen H. A. Sander, Normtatsachen im Zivilprozess, Berlin 1998
Heiko Sauer, Juristische Methodenlehre, in: Julian Krüper (Hg.), Grundlagen des Rechts, Baden-Baden 2011, S. 168-186.
Katharina Gräfin von Schlieffen, Wie Juristen begründen, Entwurf eines rhetorischen Argumentationsmodells für die Rechtswissenschaft, Juristenzeitung 2011, 109-116.
Dieter Schmalz, Methodenlehre für das juristische Studium, 4. Aufl., Baden-Baden 1998
Jeannette Schmid/Thomas Drosdeck/Detlef Koch, Der Rechtsfall - ein richterliches Konstrukt, Baden-Baden 1997
Eike Schmidt, Der Umgang mit Normtatsachen im Zivilprozeß, in: Christian Broda (Hg.), Festschrift für Rudolf Wassermann zum sechzigsten Geburtstag, Neuwied 1985, S. 807-818.
Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, Baden-Baden 2004
Carl Schmitt, Gesetz und Urteil, Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis, Berlin 1912
Jan Schröder (Hg.), Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und Philosophie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Beiträge zu einem interdisziplinären Symposion in Tübingen, 18. - 20. April 1996 Bd. 46, Stuttgart 1998
Jan Schröder, Rechtsbegriff und Auslegungsgrundsätze im frühen 20. Jahrhundert, Anmerkungen zum Streit zwischen „objektiver“ und „subjektiver“ Interpretationstheorie, in: Friedrich-Christian Schroeder (Hg.), Rechtswissenschaft in der Neuzeit, Geschichte, Theorie, Methode; ausgewählte Aufsätze 1976 - 2009, Tübingen 2010, S. 585-598.
Friedrich-Christian Schroeder, Die normative Auslegung, Juristenzeitung 2011, 187-194.
Ingo Schulz-Schaeffer, Rechtsdogmatik als Gegenstand der Rechtssoziologie, Für eine Rechtssoziologie „mit noch mehr Recht“, Zeitschrift für Rechtssoziologie, Zeitschrift für Rechtssoziologie 25, 2004, 141-174.
Winfried Schuschke/Hermann Daubenspeck/Paul Sattelmacher, Bericht, Gutachten und Urteil, 34. Aufl., München 2008
Wolfgang Seiler, Höchstrichterliche Entscheidungsbegründungen und Methode im Zivilrecht, Baden-Baden 1992
Eric Simon, Gesetzesauslegung im Strafrecht, Eine Analyse der höchstrichterlichen Rechtsprechung, Berlin 2005
Katharina Sobota (Gräfin von Schlieffen), Sachlichkeit, rhetorische Kunst der Juristen, Frankfurt am Main, New York 1990
Peter Stegmaier, Wissen, was Recht ist, Richterliche Rechtspraxis aus wissenssoziologisch-ethnografischer Sicht, Wiesbaden 2009
Hans-Joachim Strauch, Grundgedanken einer Rechtsprechungstheorie, Thüringer Verwaltungsblätter 2003, 1-7.
Gerhard Struck, Zur Theorie juristischer Argumentation, Berlin 1977
Cass R. Sunstein, One case at a time, Judicial minimalism on the Supreme Court, Cambridge, Mass., London 1999
Brian Z. Tamanaha, Beyond the Formalist-Realist Divide, The Role of Politics in Judging, Princeton N.J. 2010
Gunther Teubner, Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe, Folgenorientiertes Argumentieren in rechtsvergleichender Sicht, Baden-Baden 1995
Gunther Teubner, Globale Bukowina: Zur Emergenz eines transnationalen Rechtspluralismus, Rechtshistorisches Journal 15, 1996, 255-290.
Gunther Teubner/Peter Korth, Zwei Arten des Rechtspluralismus: Normkollisionen in der doppelten Fragmentierung der Weltgesellschaft, in: Matthias Kötter/Gunnar Folke Schuppert (Hg.), Normative Pluralität ordnen, Baden-Baden 2009, S. 137-168.
Bart van Klink/SanneTaekema (Hg.), Law and Method, Interdisciplinary Research into Law Bd. 4, Tübingen 2011
Thomas Vesting, Rechtstheorie, München 2007
Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz, Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 5. Aufl., München 1974
Friedemann Vogel, Blinde Flecken in der juristischen Hermeneutik, (Besprechung von Ino Augsberg, Die Lesbarkeit des Rechts, 2009), Rechtstheorie 41, 2010, 25-33.
Stefan Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent, 2 Bde, Tübingen 2001
Stefan Vogenauer, Eine gemeineuropäische Methodenlehre des Rechts – Plädoyer und Programm, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 13, 2005, 235-263.
Andreas von Arnauld, Möglichkeiten und Grenzen dynamischer Interpretation von Rechtsnormen, Ein Beitrag zur Rekonstruktion autor-subjektiver Normauslegung, Rechtstheorie 32, 2001, 465-495.
Rainer Wahl, Der Vorrang der Verfassung, Der Staat 20, 1981, 485-516.
Rolf Wank, Die Auslegung von Gesetzen, 4. Aufl., Köln 2008
Walter Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, Rede, gehalten bei der Inauguration als Rector magnificus der Karl-Franzens-Universität in Graz am 22. November 1950, Graz 1950
Reinhold Zippelius, Juristische Methodenlehre, 10. Aufl., München 2006
Ernst Zitelmann, Lücken im Recht, Rede, gehalten bei Antritt des Rektorats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn am 18. Oktober 1902, Leipzig 1903
[1] Vgl. etwa Michael Stolleis, Der Methodenstreit der Weimarer Staatsrechtslehre – ein abgeschlossenes Kapitel der Wissenschaftsgeschichte?, 2001; Christoph Möllers, Braucht das öffentliche Recht einen neuen Methoden- und Richtungsstreit?, Verwaltungsarchiv 90, 1999, 187-207; ders., Der Methodenstreit als politischer Generationenkonflikt: ein Angebot zur Deutung der Weimarer Staatsrechtslehre, Der Staat 43, 2004, 399-423; Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann-Hoffmann-Riem (Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004. Allgemeiner Karl-Heinz Ladeur, Die rechtswissenschaftliche Methodendiskussion und die Bewältigung des gesellschaftlichen Wandels, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 64, 2000, 60-103.
[2] Anders etwa Fikentscher, der die Methode der Rechtsanwendung ausdrücklich der Rechstheorie zuordnet und sie dort neben die Rechtsphilosophie stellt (Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts Bd. IV, 1977, S. 121 ff., 125, 664 ff.); deutlich ferner Wolfgang Hoffmann-Riem, Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Eberhard Schmidt-Aßmann u. a. (Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004, 9-72, S. 14 ff.
[3] Z. B. Matthias Jestaedt, Braucht die Wissenschaft vom Öffentlichen Recht eine fachspezifische Wissenschaftstheorie?, in: Andreas Funke/Jörn Lüdemann (Hg.), Öffentliches Recht und Wissenschaftstheorie, 2009, 18-43, S. 23 ff; Thomas Vesting, Rechtstheorie, 2007, Rn. 244.
[4]Für eine gewisse Verwirrung sorgen Müller/Christensen, Juristische Methodik, durch den Begriff „Methodik“, den sie als „Oberbegriff für ‚Hermeneutik‘, ‚Interpretation‘, ‚Auslegungsmethoden‘ und ‚Methodenlehre‘“ verstanden wissen wollen (Juristische Methodik, Rn 7, in der 10. Aufl. S. 37). Ganz und gar überflüssig ist die Rede von einer Methodologie.
[5] Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Guy Beaucamp/Lutz Treder, Methoden und Technik der Rechtsanwendung, 2. Aufl., 2011; Franz Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl., Wien 1991; ders., Grundzüge der juristischen Methodenlehre, Wien 2005; Claus-Wilhelm Canaris/Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtwissenschaft, 4. Aufl., 2006; Helmut Coing, Juristische Methodenlehre, 1972; Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., 1991; Hans Joachim Koch/Helmut Rüßmann, Juristische Begründungslehre, 1982; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3. Aufl., Bern 2010; Dirk Looschelders/Wolfgang Roth, Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 1996; Friedrich Müller/Ralph Christensen, Juristische Methodik: Grundlegung für die Arbeitsmethoden der Rechtspraxis, 10. Aufl., 2009; Hans-Martin Pawlowski, Methodenlehre für Juristen, 3. Aufl., 1999; Jan Schapp, Hauptprobleme der juristischen Methodenlehre, 1983; ders., Methodenlehre des Zivilrechts, 1998; Dieter Schmalz, Methodenlehre für das juristische Studium, 4. Aufl., 1998; Jochim Vogel, Juristische Methodik, 1998; Rolf Wank, Die Auslegung von Gesetzen, 4. Aufl., 2008; Reinhold Zippelius, Juristische Methodenlehre, 10. Aufl., 2006.
[6] Z. B. E 88, 145/167; BVerfG, 2 BvR 2939/93 vom 29.4.1998 Abs. 13; BVerfG, 1 BvR 224/07 vom 28.4.2009 Abs. 15.
[7]BVerfGE 1, 299/312 = NJW 1952, 737 (Leitsatz: Maßgebend für die Auslegung einer Gesetzesbestimmung ist der in dieser zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, wo wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den diese hineingestellt ist. Nicht entscheidend ist dagegen die subjektive Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe oder einzelner ihrer Mitglieder über die Bedeutung der Bestimmung. Der Enstehungsgeschichte einer Vorschrift kommt für deren Auslegung nur insofern Bedeutung zu, als sie die Richtigkeit einer nach den angegebenen Grundsätzen erhaltenen Auslegung bestätigt oder Zweifel behebt, die auf dem angegebenen Weg allein nicht ausgeräumt werden können.); bestätigt durch BVerfGE 10, 234/244 = NJW 1960, 235 und BVerfGE 11, 126/130 = NJW 1960, 1563/1564. Die ganze Reihe der einschlägigen Entscheidungen bei Müller/Christensen, 2009, S. 48 Fn. 2; zur methodischen Praxis des Bundesverfassungsgerichts ausführlich ebd. S. 50 ff.
[8]Beschluss vom 15.01.2009 - 2 BvR 2044/07. Auf dieser Linie jetzt auch der Beschluss des BVerfG vom 4. 5. 2011 (2 BvR 2365/09 Rn. 160) zu den Grenzen der verfassungskonformen Auslegung.
[9] Dazu allgemein Richard M. Hare, Freiheit und Vernunft (Freedom and Reason, 1963), 1983; Norbert Hoerster, Utilitaristische Ethik und Verallgemeinerung, 2. Aufl., 1977; Georg Meggle, Das Universalisierbarkeitsproblem in der Moralphilosophie, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie Beiheft 45, 1992, 143-156 [http://sammelpunkt.philo.at:8080/815/1/1992d.pdf]; Marcus George Singer, Verallgemeinerung in der Ethik (Generalization in Ethics, 1961), 2. Aufl., 1975. Für die Rechtswissenschaft Alexy, Juristische Argumentation, S. 90 ff., passim, sowie S. 273 ff.
[10]Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl. 1960, 256; ähnlich Heck AcP 112, 1914, 1/102; Zitelmann, Lücken im Recht, 1903, 30.
[11] Zur Kritik dieser Figur Müller/Christensen 2009, S. 420 f. Ich teile diese Kritik nicht.
[12] Ähnlich schon Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, S. 243 ff. Heute ist diese Vermutungswirkung von Präjudizien wohl herrschende Meinung.
[13]Theoretisch müsste die juristische Methode in allen modernen Verfassungsstaaten übereinstimmen. Praktisch bestehen jedoch erhebliche Unterschiede. Damit befasst sich die rechtsvergleichende Literatur zu Methodenfragen: Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, 5 Bde., 1975-1977; Thomas Henninger, Europäisches Privatrecht und Methode, Entwurf einer rechtsvergleichend gewonnenen juristischen Methodenlehre, 2009; Stefan Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent, 2 Bde, 2001.
[14] Darüber gibt eine umfangreiche Spezialliteratur Auskunft: Axel Adrian, Grundprobleme einer juristischen (gemeinschaftsrechtlichen) Methodenlehre, Die begrifflichen und ("fuzzy"-)logischen Grenzen der Befugnisnormen zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und die Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, 2009; Wolfgang Buerstedde, Juristische Methodik des Europäischen Gemeinschaftsrechts, 2006; Günter Hager, Rechtsmethoden in Europa, 2009; Katja Langenbucher, Vorüberlegungen zu einr Europarechtlichen Methodenlehre, in: Thomas Ackermann (Hg.), Tradition und Fortschritt im Recht, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1999, 2000, 65-83; dies., Europarechtliche Methodenlehre, in: Katja Langenbucher/Andreas Engert (Hg.), Europarechtliche Bezüge des Privatrechts, 2. Aufl., 2008, 1-40; Friedrich Müller/Ralph Christensen, Juristische Methodik: Europarecht, 2. Aufl., 2007; Karl Riesenhuber (Hg.), Europäische Methodenlehre, Handbuch für Ausbildung und Praxis, 2. Aufl., Berlin 2010; Stefan Vogenauer, Eine gemeineuropäische Methodenlehre des Rechts – Plädoyer und Programm, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 13, 2005, 235-263.
[15] Genannt seien ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Uwe Diederichsen/Gerhard Wagner, Die BGB-Klausur, 9. Aufl., 1998; Heike Krieger/José Martínez Soria, Die Anfängerklausur im Öffentlichen Recht, 2011; Thomas M. J. Möllers, Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, Klausur, Hausarbeit, Seminararbeit, Staatsexamen, Dissertation, 5. Aufl. 2010; Dirk Olzen/Rolf Wank, Zivilrechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium, 6. Aufl., 2010; Holm Putzke, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, Klausuren, Hausarbeiten, Seminare, Bachelor- und Masterarbeiten, 3. Aufl., 2010; Gunther Schwerdtfeger, Öffentliches Recht in der Fallbearbeitung, Grundfallsystematik, Methodik, Fehlerquellen, 13. Aufl., 2008; Ekkehart Stein, Die rechtswissenschaftliche Arbeit, Methodische Grundlegung und praktische Tipps, 2000. In jedem Heft der juristischen Ausbildungszeitschriften JuS, JURA und Juristische Schulung finden sich Hinweise zur Arbeitstechnik oder zur Fallbearbeitung. Bemerkenswert Guy Beaucamp/Lutz Treder, Methoden und Technik der Rechtsanwendung, 2. Aufl., 2011, die Methodenlehre und Fallbearbeitung jedenfalls in einem Buch behandeln.
[16] Die klassische Anleitung war und ist der „Sattelmacher“, heute als Winfried Schuschke/Hermann Daubenspeck/Paul Sattelmacher, Bericht, Gutachten und Urteil, 34. Aufl., 2008, einschlägig sind ferner Monika Anders/Burkhard Gehle, Das Assessorexamen im Zivilrecht, 10. Aufl., 2010; Georg Furtner, Das Urteil im Zivilprozess, 5. Aufl., 1985; Uwe Gottwald, Das Zivilurteil, 2. Aufl., 2005; Michael Huber, Das Zivilurteil, 2. Aufl., 2003; Dieter Knöringer, Die Assessorklausur im Zivilprozess, 9. Aufl., 2002; Hans-Günther Nordhues/Ralf Trinczek, Technik der Rechtsfindung, 6. Aufl., Neuwied , Kriftel , 1994; Peter Siegburg, Einführung in die Urteilstechnik, 5. Aufl., 2003; Walter Zimmermann, Klage, Gutachten und Urteil, Eine Anleitung für die zivilrechtlichen Ausbildungs- und Prüfungsarbeiten mit Beispielen, 19. Aufl., 2007.
[17]Deshalb ist es verfehlt, die „Rechtsdogmatik als mächtige Konkurrentin der Methodenlehre“ anzusehen (so aber Hassemer 2008:15).
[18]Nach neuerem Sprachgebrauch sind Standards ausformulierte private Regelwerke wie DIN-Normen oder Regeln der Rechnungslegung.
[19] Auch von Maßstabsnormen ist die Rede. Diese Benennung stiftet allerdings leicht Verwirrung, denn von Maßstabsnomen oder Maßstabsgesetzen spricht man auch bei dem zweistufigen Gesetzgebungsverfahren, welches das Bundesverfassungsgericht für die Regelung des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern gefordert hat: Zunächst soll ein Gesetz beschlossen werden, das die Maßstäbe für den Finanzausgleich festlegt. Erst im Anschluss daran soll ein weiteres Gesetz die konkreten Zahlungspflichten und Ansprüche bestimmen (BVerfGE 101, 158). Spätestens seit dieser Entscheidung wird die Möglichkeit diskutiert, die Qualität von Gesetzen durch sog. Grundlagengesetze zu verbessern (z.B. Ulrich Smeddinck, Zur Dogmatik von Grundlagengesetzen, Zeitschrift für Gesetzgebung 22, 2007, 62-73). Das jüngste Beispiel ist die so genannte Schuldenbremse. Das Problem solcher Gesetze liegt darin, dass sie gegenüber Durchbrechungen keine erhöhte Bestandsfestigkeit aufweisen.
[20]In diesem Sinne unterscheiden Amerikaner in der Tradition von Roscoe Pound zwischen rules und legal standards (Pierre Schlag, Rules and Standards, UCLA Law Review 33, 1985, 379-430). „Legal standard“ lässt sich nicht einfach als Standard ins Deutsche übersetzen.
[21] Ronald Dworkin, The Model of Rules I, 1967, wieder abgedruckt in: Taking Rights Seriously (1977) = Bürgerrechte ernstgenommen, 1984, Kap. 2, 4 und 13. Darauf hatte Hart 1977 in dem Aufsatz „American Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream“, Georgia Law Review11, 1977, 969-989, und in einem Nachwort zur 2. Aufl. von „The Concept of Law“ (1994) geantwortet. Daran knüpft die unendliche so genannte Hart-Dworkin-Debatte. Dazu Scott J. Shapiro, The "Hart-Dworkin" Debate: A Short Guide for the Perplexed, 2007, SSRN: http://ssrn.com/abstract=968657.
[22] Näher Allan Hutchinson/John N. Wakefield, A Hard Look at 'Hard Cases': The Nightmare of a Noble Dreamer, Oxford Journal of Legal Studies 2, 1982, 86-110, S. 91 f.
[23] Die Ideengeschichte der Methodenlehre hat ausführlich Karl Larenz im ersten Teil seiner „Methodenlehre“ (6. Aufl. 1991) nachgezeichnet.
[24] Luhmann 1966, 51. Dafür bezieht Luhmann sich auf Dietrich Schindler, Verfassungsrecht und soziale Struktur, 3. Aufl., Zürich 1950, S. 4.
[25] Zu dieser Manfred Kienpointner, Alltagslogik, Struktur und Funktion von Argumentationsmustern, 1992.
[26] Für eine postmoderne Sicht auf den Dezisionismus Carl Schmitts vgl. Andreas Fischer-Lescano/Ralph Christensen, Auctoritatis Interpositio. Die Dekonstruktion des Dezisionismus durch die Systemtheorie, Der Staat 44, 2005, 213-242.
[27] Zu ersten Generation zählen Ottmar Ballweg, Wolfgang Gast, Fritjof Haft, Hubert Rodingen und Waldemar Schreckenberger, zu den jüngeren Rolf Gröschner und Katharina Gräfin von Schlieffen. Eine Würdigung Viehwegs bietet Gräfin von Schlieffens Doktorandin Agnes Launhardt (Topik und Rhetorische Rechtstheorie. Eine Untersuchung zu Rezeption und Relevanz der Rechtstheorie Theodor Viehwegs, 2010).
[28] Dazu Ulrich Huber, Savignys Lehre von der Auslegung der Gesetze in heutiger Sicht, Juristenzeitung, 2003, 1-17; Stephan Meder, Mißverstehen und Verstehen, Savignys Grundlegung der juristischen Hermeneutik, 2004.
[29] Die Hermeneutik im Sinne der traditionellen und bewährten philologischen und juristischen Auslegungsmethoden wird dargestellt bei Helmut Coing, Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik, Köln 1959.
[30] Erstmals erschienen 1960. Das Startzeichen gab Emilio Betti, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre, in: Festschrift für Ernst Rabel, Tübingen 1954, S. Bd. II, S. 79-168. Von Betti 1962: Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften (Teorie generale della Interpretazione).
[31]Alexander von Baeyer, Bemerkungen zum Verhältnis von juristischer und philosophischer Hermeneutik, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 54 , 1961, 27-42; Winfried Hassemer, Tatbestand und Typus, Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik, 1968; ders., Juristische Hermeneutik, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 72 , 1986, 195-212; Joachim Hruschka, Das Verstehen von Rechtstexten, Zur hermeneutischen Transpositivität des positiven Rechts, 1972; Arthur Kaufmann, Naturrecht und Geschichtlichkeit, 1957; ders., Durch Naturrecht und Rechtspositivismus zur juristischen Hermeneutik, Juristenzeitung, 1975, 337-341; ders., Beiträge zur juristischen Hermeneutik, 1984; Friedrich Müller, Normstruktur und Normativität. Zum Verhältnis von Recht und Wirklichkeit in der juristischen Hermeneutik, entwickelt an Fragen der Verfassungsinterpretation, 1966. Vgl. ferner Monika Frommel, Die Rezeption der Hermeneutik bei Karl Larenz und Josef Esser, 1981. Zur Kritik Hans Albert, Kritik der reinen Hermeneutik, 1994.
[32]Arthur Kaufmann, Problemgeschichte der Rechtsphilosophie, in: ders. u. a. (Hg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 8. Aufl., Heidelberg 2011, 26-147, S. 103. Kaufmanns Verdikt ist schon deshalb unhaltbar, weil es Rechtstheorie und Methode zusammenwirft.
[33] Vorverständnis und Methodenwahl, 2. Aufl. 1972, S. 7, 123, und vorher schon in Grundsatz und Norm S. 112 ff, 123 ff, 176 ff und 257 ff.
[34] Näher Vesting, Rechtstheorie, 2007, Rn. 210 ff, 214.
[35] Sie wird vertreten durch Autoren wie Koch und Rüßmann, Kindhäuser, Podlech, Rödig und Herberger.
[36]Donald Davidson, Wahrheit und Interpretation (Inquiries into Truth and Interpretation, 1984), 2. Aufl., Frankfurt am Main 1994.
[37]Ralph Christensen/Andreas Fischer-Lescano, Das Ganze des Rechts, 2007; Ralph Christensen/Kent D. Lerch, Dass das Ganze das Wahre ist, ist nicht ganz unwahr, Juristenzeitung, 2007, 438-445; Hans Kudlich/Ralph Christensen, Wortlautgrenze: Spekulativ oder pragmatisch?, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 93, 2007, 128-142.
[38] Das ist unübersehbar in den Formulierungen von Georg W. Bertram/Jasper Liptow, Holismus in der Philosophie. Eine Einleitung, in: dies. (Hg.), Holismus in der Philosophie, Weilerswist 2002, S. 7-29, S. 7.
[39]Friedrich Müller (Hg.), Untersuchungen zur Rechtslinguistik 1989; Friedrich Müller/Rainer Wimmer (Hg.), Neue Studien zur Rechtslinguistik, Dem Gedenken an Bernd Jeand'Heur Bd. 202, 2001. Dazu ferner die Internetseite „Recht und Sprache“ von Ralph Christensen [http://www.recht-und-sprache.de/index.htm].
[40] „Wir wollen nicht, dass die Gerichte etwas grundlegend anders machen. Sie sollen lediglich das, was sie bisher getan haben, mit klarerem Bewußtsein tun.“ (Ralph Christensen/Hans Kudlich, Theorie richterlichen Begründens, Berlin 2001, S. 24). „Absicht des Positivismus war es, die Jurisprudenz möglichst weit zu verwissenschaftlichen und eine rationale Dogmatik zu liefern. … Die Strukturierende Methodik fällt nicht hinter den dogmatischen Standard an Technizität zurück, den der Positivismus anstrebte.“ (Müller/Christensen, Juristische Methodik, 10. Aufl., S. 292 Rn. 299).
[41]Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts, Bd. III Kap. 29 VI; Bd. IV Kap. 31 VII. 3) = S. 180 ff. Fikentscher unterschied drei Rechtsanwendungslehren, die klassische Lehre, die die Rechtsanwendung als Subsumtion des konkreten Falles unter eine allgemeine Norm versteht, die Theorie normfreien Entscheidens (die er der Freirechtsschule zuschrieb) und die Gleichsetzungslehren (Bd. III, 1976, 736 ff.).
[42]Karl Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, 1953, 2. Aufl. 1968. Dazu Fikentscher S. 750 f. Das „Hin- und Herwandern des Blicks zwischen Obersatz und Lebenssachverhalt“ wird in der Regel nur zitiert um zu zeigen, dass der Sachverhalt der Ausgangspunkt einer Forderung ist, sich im Lichte einer Rechtsnorm verändern kann, weil bisher unbeachtete Umstände relevant werden, während andere ihre Bedeutung verlieren. Engischs berühmte Formel war aber auch schon von ihrem Erfinder zweiseitig gemeint. Es verändert sich aus dem Blickwinkel einer Norm nicht bloß der relevante Sachverhalt, sondern umgekehrt kann der Sachverhalt auch inhaltlich auf die Norm zurückwirken.
[43]Josef Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 1956. Dazu Fikentscher S. 688.
[44]Arthur Kaufmann, Analogie und „Natur der Sache“. Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus, Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 22. April 1964, Karlsruhe 1965. Dazu Fikentscher Bd. III, S. 751 f.
[45]„Hermeneutische Verdichtung“ führt zur Fallnorm, „wenn der hermeneutische Zirkel nur noch einmal zwischen Norm und Sachverhalt ‚aufsteigt und (Bd. IV S. 201) absteigt‘ und keine weitere positiv zu beantwortende Rückfrage mehr erfolgt, ob der Sachverhalt auch die richtige Norm zu seiner Beurteilung gewährt. Das Kriterium der Fallnorm ist, mit anderen Worten, die letztmögliche Konkretion des Normativen angesichts der Sachverhaltsbestandteile.“ (Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts, Bd. III Kap. 29 VI = S. 736ff, Bd. IV Kap. 31 VII. 3) = S. 180 ff., 199ff.) Fikentscher definiert: „Fallnorm ist diejenige Regel des objektiven Rechts, die einem lösungsbedürftigen Sachverhalt eine ihn regelnde Rechtsfolge zuordnet. Die Fallnorm ist der Rechtssatz im technischen Sinne.“ (Bd. IV, S. 202), oder S. 382: „Da fast jeder Fall vom anderen abweicht, sind Fallnormen sehr weit in den faktischen Bereich, in den zu subsumierenden Sachverhalt vorgeschoben. Trotzdem sind Norm und Sachverhalt nicht das gleiche. Die Fallnorm, so fallzugeschnitten wie auch immer, ist doch Norm und daher allgemein, und somit vom Fall zu unterscheiden.“
[46] So ausdrücklich Müller/Christensen, Juristische Methodik, 10. Aufl. 2009, Rn. 14. Irritierend sind die Ausführungen bei Rn. 182, wo davon die Rede ist, dass die Bedeutung unbestimmter Normtexte doch bestimmbar sei. Die Begriffspaar „unbestimmt, aber bestimmbar“ ist aus dem Zessionsrecht geläufig und bedeutet dort, dass sich die zunächst unbestimmt erscheinende Bezeichnung der abgetretenen Forderung aus dem Umständen bestimmen lässt.
[47]Ralph Christensen, Sprache und Normativität, S. 138.
[48] Thomas Vesting, Rechtstheorie, 2007, Rn. 53 spricht von einer „kaum sichtbaren Mikrovariation einer an sich stabil gedachten Regel“, verwirft aber dennoch das Anwendungsmodell, das er mit dem Subsumtionsmodell gleichsetzt.
[49]Solcher Minimalismus zeigt sich in einer doppelten Selbstbeschränkung. Er vermeidet, bei der Entscheidung eines Falles darüber hinaus weitere Fälle lösen zu wollen. Und er vermeidet, die Begründung der Entscheidung auf allgemeine Theorien und Prinzipien zu stützen (Cass R. Sunstein, One Case at a Time: Judicial Minimalism at the Supreme Court, 1999).
[50] Einen Überblick bietet Sonja Buckel/Ralph Christensen/Andreas Fischer-Lescano (Hg.), Neue Theorien des Rechts, 2006 (2. Aufl. 2010).
[51] Zitat nach Niklas Luhmann, Organisation und Entscheidung, 2000, 142; ferner ders., Die Paradoxie des Entscheidens, VerwArch 84, 1993, 287-310; ders., Das Recht der Gesellschaft, 1993, 308; ders., Die Rückgabe des zwöften Kamels, Zeitschrift für Rechtssoziologie 21 , 2000, 3-60, 6. Dazu kritisch Klaus F. Röhl/Hans C. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, 105f.
[52] Z. B. Karl-Heinz Ladeur/Ino Augsberg, Auslegungsparadoxien, Rechtstheorie 36, 2005, 143-184; Vesting, Rechtstheorie, 2007 Rn. 224ff.
[53] Sie wird von Vesting angemahnt, aber nicht geliefert (Rechtstheorie 2007, Rn. 184). Einen Versuch in diese Richtung hat Thomas M. J. Möllers unternommen, indem er „sekundären Rechtsquellen“ und „Soft Law“ als neue Kategorien vorschlägt. Die wichtigste sekundäre Rechtsquelle sollen Präjudizien und Verwaltungsvorschriften bilden. Als Beispiel für Soft Law wird der Deutsche Corporate Governance Kodex genannt. (Thomas M. J. Möllers, Sekundäre Rechtsquellen. Eine Skizze zur Vermutungswirkung und zum Vertrauensschutz bei Urteilen, Verwaltungsvorschriften und privater Normsetzung, in: Jobst-Hubertus Bauer (Hg.), Festschrift Herbert Buchner, 2009, 649-665).
[54] Vgl. pars pro toto die Darstellung einer Autorin, die auch als Rechtsoziologin ausgewiesen ist: Dorothea Jansen, Theoriekonzepte in der Analyse sozialer Netzwerke, 2007. Im Internet verfügbar ist ein »Network Analysis and Law Tutorial« von Daniel Martin Katz und Michael Bommarito [ULR: http://computationallegalstudies.com/network-analysis-and-law-tutorial/].
[55] Wie kein anderer hat Karl Heinz Ladeur den Netzwerkbegriff in die juristische Diskussion hineingetragen; vgl. dazu Ino Augsberg/Tobias Gostomzyk/Lars Viellechner/Karl-Heinz Ladeur, Denken in Netzwerken, Zur Rechts- und Gesellschaftstheorie Karl-Heinz Ladeurs, 2009. Im Internet verfügbar das Sonderheft des German Law Journal 2009, Nr. 4: Law in the Network Society: A Celebration of the Work of Karl-Heinz Ladeur.
[56] Zur Verwendung als Metapher Alexandra Kemmerer, The Normative Knot 2.0: Metaphorological Explorations in the Net of Networks, German Law Journal 10, 439-461.
[57] Mit diesem handfesten Thema befassen sich, ungeachtet aller postmodernen Rhetorik, wichtige Arbeiten Gunther Teubners: Netzwerk als Vertragsverbund: Virtuelle Unternehmen, Franchising, Just in Time in sozialwissenschaftlicher und juristischer Sicht, 2004; Coincidentia oppositorum: Das Recht der Netzwerke jenseits von Vertrag und Organisation, in: Marc Amstutz (Hg.), Die vernetzte Wirtschaft: Netzwerke als Rechtsproblem, Schulthess, Zürich 2004, 11-42.
[58] Daniel Martin Katz u. a., Reproduction of Hierarchy? A Social Network Analysis of the American Law Professoriate, Journal of Legal Education 61, 2011, 1-28.
[59] Daniel Martin Katz/Derek K. Stafford, Hustle and Flow: A Social Network Analysis of the American Federal Judiciary, Ohio State Law Journal 71, 2010, 457-507.
[60]Fritz Dolder/Mauro Buser, Zitieren geht über Studieren – Empirische Wanderungen im Grenzgebiet zwischen Rechtslehre und Rechtsprechung, in: Josef Estermann, Josef (Hg.), Interdisziplinäre Rechtsforschung zwischen Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung, Bern 2010, S. 193–210
[61] Michael James Bommarito/Daniel Martin Katz/Jon Zelner, Law as a Seamless Web? Comparison of Various Network Representations of the United States Supreme Court Corpus (1791-2005) 2009, SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1419525; James H. Fowler u. a., Network Analysis and the Law: Measuring the Legal Importance of Precedents at the U.S. Supreme Court, Political Analysis 15, 2007, 324-346; Thomas A. Smith, The Web of Law, 2005, SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=642863.
[62] Ausdruck von Karl-Heinz Ladeur, erstmals wohl in »Das Umweltrecht der Wissensgesellschaft«, 1995, S. 37 u. ö.
[63] „Wenn man den geforderten Nachweis führen will, kommt man in den unendlichen Regress. Kein Weg zur Erfassung sprachlicher Bedeutung ist unfehlbar. Die Behauptung der Regel bedarf ihrerseits der Rechtfertigung durch den Nachweis einer korrekten Anwendung einer dafür wiederum zuständigen Regel. Statt dass sich also hier eine Grenze schließt, öffnen sich unabsehbare Horizonte.“ (Ralph Christensen, Sprache und Normativität oder wie man eine Fiktion wirklich macht, in: Julian Krüper u. a. (Hg.), An den Grenzen der Rechtsdogmatik, 2010, S. 128-138, S. 129).
[64] Z. B. durch den Sprachwissenschaftler Dietrich Busse, auf den sich die Müller-Schule vielfach stützt: Dietrich Busse, Zum Regelcharakter von Normtextbedeutungen und Rechtsnormen, Rechtstheorie 19, 1988, 305-322.
[65] Zum engeren Kreis gehören Dietrich Busse, Ralph Christenen, Hans Kudlich, Michael Solokowski und Bernd Jean d‘Heur.
[66]Müller/Christensen, Juristische Methodik, 10. Aufl. 2009, 542ff (Rn. 531 u. 533).
[67] Über die Koinzidenz von Begriffsrealismus und Begriffsidealismus Klaus F. Röhl/Hans C. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl 2008, 42.
[68]Ulfrid Neumann, Juristische Methodenlehre und Theorie der juristischen Argumentation, Rechtstheorie 32 , 2001, 239-255, S. 252f. Zur Kritik der Gleichsetzungslehren Fikentscher, S. 752f.
[69] Stanley Eugene Fish, Is There a Text in This Class?, The Authority of Interpretive Communities, Cambridge Mass. 1980; ders., Doing What Comes Naturally. Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies, Oxford 1989.
[70] Z. B. Ralph Christensen, Sprache und Normativität oder wie man eine Fiktion wirklich macht, in: Julian Krüper u. a. (Hg.), An den Grenzen der Rechtsdogmatik, 2010, S. 128-138, S. 130; Martin Morlok, Neue Erkenntnisse und Entwicklungen aus sprach- und rechtswissenschaftlicher Sicht, in: Bernhard Ehrenzeller u. a. (Hg.), Präjudiz und Sprache, 2008, S. 67 ff., 67 f.
[71] Die Arbeiten Robert Brandoms sind für die Methodenlehre besonders von Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze, 2004, rezipiert worden. Dazu wiederum kritisch Hans Kudlich/Ralph Christensen, Wortlautgrenze: Spekulativ oder pragmatisch?, Zugleich Besprechung von Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 93, 2007, 128-142.
[72] Zur Kritik des fundamentalen Antifundamentalismus Susan Haack, Manifesto of a Passionate Moderate, Unfashionable Essays, Chicago 1998, und Alan Musgrave, Weltliche Predigten, Essays über Wissenschaft und Philosophie, 2011.
[73]Mark Kelman, A Guide to Critical Legal Studies, 1987; Roberto M. Unger, The Critical Legal Studies Movement, 1986; Roberto M. Unger, The Critical Legal Studies Movement, Harvard Law Review, 96, 1983, 561-675, sowie die Beiträge in dem Sonderheft “Critical Legal Studies Symposium”, Stanford Law Review 36, 1984, 1-674 (darin besonders die gute Einführung und Übersicht von Alan C. Hutchinson/Patrick J. Monahan, Law, Politics, and the Critical Legal Scholars: The Unfolding Drama of American Legal Thought, S. 199-245); Peter Fitzpatrick/Alan Hunt (Hg.), Critical Legal Studies, 1987 (= Journal of Law and Society, 1987, 1-197). Vgl. dazu aus deutscher Sicht Günter Frankenberg, Partisanen der Rechtskritik: Critical Legal Studies etc., in: Sonja Buckel u. a. (Hg.), Neue Theorien des Rechts, Bd. 2744, 2006, S. 97-116; Christian Joerges/David M. Trubek (Hg.), Critical Legal Thought, An American-German Debate, 1989 (neu veröffentlicht mit einer Einführung von Christian Joerges, David M. Trubek und Peer Zumbansen als Band 12 Nr. 1 des German Law Journal [http://www.germanlawjournal.com/pdfs/FullIssues/Vol_12_No_01.pdf]; Ekkehard Klausa/Klaus F. Röhl/Ralf Rogowski/Hubert Rottleuthner, Rezension eines Denkansatzes: Die Conference on Critical Legal Studies, ZfRSoz 1, 1980, 85-125.
[74] Als Beleg wird gewöhnlich Duncan Kennedy, Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology, Journal of Legal Education 36, 1986, 518-562, zitiert.
[75]Otto Kirchheimer, Politische Justiz, Verwendung juristischer Verfahrensmöglichkeiten zu politischen Zwecken, Frankfurt a.M 1981 (Political Justice, 1961); Rudolf Wassermann, Der politische Richter, 1972.
[76] Jan Schröder verortet die Anhänger der subjektiven Theorie eher im linken Lager, weil dort „die Frage, ob es unzweifelhafte Rechtswerte oder auch nur übereinstimmende Gerechtigkeitsvorstellungen in der Gesellschaft“ gebe, „wegen des partei- und klassenspezifischen Charakters von Rechtsüberzeugungen“ eher verneint werde, so dass „die freie richterliche Entscheidung immer in dem Verdacht steht, kein allgemeines, sondern nur ein persönliches Werturteil des Richters zur Geltung zu bringen.“ (Jan Schröder, Rechtsbegriff und Auslegungsgrundsätze im frühen 20. Jahrhundert, Anmerkungen zum Streit zwischen „objektiver“ und „subjektiver“ Interpretationstheorie, in: Jan Schröder: Rechtswissenschaft in der Neuzeit, 2010, 585-598, S. 597 f.).
[77]Lawrence Baum, The Puzzle of Judicial Behavior, Ann Arbor 1997; Manfred Weiss, Die Theorie der richterlichen Entscheidungstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika, 1971.
[78]Joachim Arntz/Hans-Peter Haferkamp/Margit Szöllösi-Janze, Justiz im Nationalsozialismus, Positionen und Perspektiven, 2006; Redaktion der Kritischen Justiz (Hg.) Die juristische Aufarbeitung des Unrechtsstaats, 1998; Bernhard Blanke (Hg.), Der Unrechts-Staat, 2. Aufl., 1983; Wolfgang Grunsky, Gesetzesauslegung durch die Zivilgerichte im Dritten Reich, Kritische Justiz , 1969, 146-162; Regina Ogorek, „Rassenschande“ und juristische Methode. Die argumentative Grammatik des Reichsgerichts bei der Anwendung des Blutschutzgesetzes von 1935, in: Regina Ogorek, Abhandlungen und Rezensionen, Frankfurt am Main 2008, S. 287-310; Rainer Schröder, „… aber im Zivilrecht sind die Richter standhaft geblieben!", Die Urteile des OLG Celle aus dem Dritten Reich, 1988; Gerhard Werle, Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, 1989; ders., „Das Gesetz ist der Wille und Plan des Führers“ – Reichsgericht und Blutschutzgesetz, NJW 1995, 1267-1269.