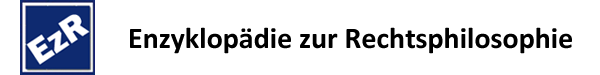Rhetorik
Erstveröffentlichung: 04. Februar 2013
- Einführung. Rhetorik: ein rechtsphilosophisch obsoletes Thema?
- Definitionen
- Zur Geschichte: Anfänge. Die klassische Rhetorik
1. Anfänge. Sophisten – 2. Antisophist Platon – 3. Isokrates – 4./5. Aristoteles – 6. Hellenismus – 7. Cicero – 8. Quintilian – 9. Mittelalter – 10. Barock, Aufklärung – 11. Rhetorik & Recht – 12. 19. Jahrhundert
- Das Instrumentarium der klassischen Rhetorik
1. Noch immer dominierende Klassiker – 2. Fünf Bausteine der Redelehre. Die Inventio – 3. Die drei Redegattungen – 4. Einzelfall und allgemeine Streitfrage – 5. Die Statusfrage – 6./7. Aufbau und Teile der Rede – 8. Vertretbarkeitsgrade der Fälle – 9. Die Beweismittel (Übersicht) – 10. Ethos und Pathos – 11. Rhetorische Schlussverfahren (Logos) – 12. Die Topik – 13./14. Stilkunde
- Wiederkehr der Rhetorik als Rhetorische Rechtstheorie
1. „Neue Rhetorik“ – 2. Rhetorische Rechtstheorie: Hauptwerke – 3. Stand nach sechs Jahrzehnten
- Rhetorik in der aktuellen Methodenlehre
1. „Schlüsselqualifikation“ – 2. Zwei Lehrbücher – 3. Logos der herrschenden Methodik – 4. Autoritätsbeweis – 5. Juristensprache
- Bibliographie
I. Einführung. Rhetorik: ein rechtsphilosophisch obsoletes Thema?
1
„Ich muss gestehen: dass ... die Lesung der besten Rede eines römischen Volksredners ... jederzeit mit dem unangenehmen Gefühl der Missbilligung einer hinterlistigen Kunst vermengt war... Rednerkunst (ars oratoria) ist, als Kunst, sich der Schwächen der Menschen zu seinen Absichten zu bedienen (diese mögen immer so gut gemeint, oder auch wirklich gut sein, als sie wollen), gar keiner Achtung würdig.“ – Kants Verdikt (in einer Sternchen-Fußnote zu § 53 der „Kritik der Urteilskraft“) kann als Todesurteil erscheinen, das vor allem die deutschsprachige Jurisprudenz prompt vollstreckt hat. Sie hat im frühen 19. Jahrhundert den Wechsel von der rhetorisch betriebenen Rechtssuche zur Rechtsdogmatik vollzogen und stützt seither Selbstverständnis und Richtigkeitsanspruch auf ihre strikt dogmatische Arbeitsweise (EzR, Rechtsdogmatik im Zivilrecht I 1 und 6). Dabei eingesetzte Methoden gelten als wissenschaftliche Alternative zu einer Kunstfertigkeit, die zur Rechtserkenntnis untauglich sei. Doch die Validität des herkömmlichen Methodenkanons, wie er exemplarisch in der „Methodenlehre“ von Larenz (6. Auflage 1991), fortgeschrieben durch Canaris (1995) dokumentiert ist, wurde immer wieder in Frage gestellt. Unterschiedliche Konzepte zur juristischen Argumentation stellen seit den 1970er Jahren dem Ideal deduktiver Ableitung juristischer Erkenntnisse dialogische oder aporetische Arbeitsweisen gegenüber, und die „Rhetorische Rechtstheorie“ wirbt bereits 20 Jahre länger, inzwischen mit einigem Erfolg, für die Rehabilitierung der Rhetorik in der Jurisprudenz.
II. Definitionen
2
1. Rhetorik (griech. rhetoriké; lat. rhetorica) ist dem Namen wie der Sache nach aus der antiken, griechisch-römischen Kultur rezipiert. Das aktuelle Wörterbuch (Duden 1999) übersetzt das Lehnwort „Rhetorik“ in „Redekunst“ und definiert diese als „Lehre von der wirkungsvollen Gestaltung der Rede“. Ausführlicher umschreiben Lexika den Begriff: Er umfasst die gesamte „Theorie und Praxis menschlicher Beredsamkeit in allen öffentlichen und privaten Angelegenheiten, sei es in mündlicher, schriftlicher oder durch technische Medien (Film, Funk, Fernsehen) vermittelter Form“ (Brockhaus Enzyklopädie 2006). Als „wissenschaftliche Disziplin“ handelt Rhetorik von einer Kommunikation, die „wirkungsorientiert, also auf die Überzeugung des Adressaten hin ausgerichtet ist (persuasive Kommunikation)“. Diese Lexikonstelle streift oberflächlich den Grundkonflikt, der seit der Antike in konträren Definitionen zu finden ist. Persuasives Agieren ist, wenn man das Attribut wörtlich nimmt (persuadere = überreden), auf Überredung eines Kommunikationspartners angelegt. Im Gegensatz zum Redeziel „Überzeugung“ ist „Überredung“ überwiegend negativ bewertet.
3
2. Den Terminus rhetoriké hat Platon im frühen 4. Jh. v. Chr. geprägt und damit uneinheitliche Benennungen ein und desselben Sachverhalts beseitigt (Kalivoda/Zinsmaier 2005, 1423). Aristoteles verwendet rhetorikè téchne, um eine der Logik („Dialektik“) gleichwertige wissenschaftliche Disziplin zu benennen (Aristoteles, Rhetorik I, 1, 1). Als im 2. Jh. v. Chr. die griechische Vorlage von den Römern übernommen, bald auch latinisiert wird, bleibt der Name rhetorica oder rhetorice stehen, verbunden mit der knappen Definition: ars bene dicendi (Kunst, gut zu sprechen). Quintilian, der Ende des 1. Jh. in einem Lehrbuch den höchsten erreichten Standard seines Faches zusammenfasst, trennt zwei Dimensionen des Rhetorikbegriffs: Zum einen ist Rhetorik bene dicendi scientia, die Wissenschaft vom guten Sprechen, das auf Überzeugung, nicht auf Überredung gerichtet sei (Quintilian II, 15, 38 mit 15, 3 ff.,). Insoweit erforscht Rhetorik die allgemeinen Bedingungen eines wirkungsvollen Sprachgebrauchs, stellt Regelmäßigkeiten fest und Regeln auf. Zum anderen ist sie ars, Kunst, da sie Regeln befolgt, und gehört zu den artes in agendo positae, den praktischen, auf Handeln gerichteten Kunstfertigkeiten (Quintilian II, 18, 1-5). „Ars“ steht in den antiken Texten allgemein für eine aus „festen Regeln und Vorschriften“ abgeleitete Arbeitsweise (Isidor von Sevilla, Etymologiae I, I, 1, Möller 2008, S. 20). Die deutschsprachige Literatur verwendet seit dem 16. Jh. die Bezeichnungen „Redekunst“, „Beredsamkeit“ und „Wohlredenheit“ (Sulzer 1794, S.41).
4
3. Aktuell bietet juristische Rhetorik diese Definition an: Rhetorik ist die Technik der sprachlichen Verständigung mit dem Ziel, Einverständnis herzustellen (Gast 2006a, Rz. 3 ff.; 2006b, S. 31 f.). Genannt sind der Weg („Verständigung“) zum Einverständnis und die verwendeten („sprachlichen“) Mittel. Die Zielsetzung „Einverständnis“ verwirft die für rationales Kommunizieren unangemessene „Überredung“; zugleich ersetzt sie die innere Tatsache „Überzeugung“ durch ein manifestes Merkmal. Einverständnis (Zustimmung, Konsens) äußert sich unmittelbar oder durch ein Verhalten, die Motive dafür sind gleichgültig.
III. Zur Geschichte: Anfänge. Die klassische Rhetorik
5
1. Aus dem 18. Jh. v. Chr. stammt ein altägyptischer Lehrtext zur Rhetorik: Ein armer, doch redegewandter Mann setzt mit neun Klagereden sein Recht gegen einen tückischen Gutsverwalter und gegen parteiische Richter durch (Ermann 1923, S. 157 ff.; Gast 2006a, Rz. 504 ff.). Früheste Zeugnisse für praktische Beredsamkeit der Griechen gibt es bei Homer (8. Jh. v. Chr.); so etwa in den Reden, die den gekränkten Achill zur Rückkehr auf den Kampfplatz bewegen sollen (Ilias 9, 225 ff.; Gast 2006a, Rz. 520 ff.). Dass Athen seit dem 5. Jh. v. Chr. zur Hochburg von Rhetorik und Philosophie heranreift, verdankt die Stadt, soweit es um Rhetorik geht, Rednern aus dem griechischen Kolonialgebiet Sizilien (Fuhrmann 2011, S. 17). Der berühmteste unter ihnen ist Gorgias, der sich 427 v. Chr. in Athen niederlässt und dort die erste Rednerschule eröffnet. Er gehört zu den Sophisten, die als Aufklärer das fragwürdig gewordene mythische Weltbild durch Welterklärung in den Grenzen der Vernunft ersetzen wollen; als Redner erntet er Bewunderung für den präzisen, schlüssigen Aufbau seiner Argumentation und für seinen virtuosen Umgang mit der Sprache (Fuhrmann 2011, S. 19 ff.). Dem stehen Anfeindungen wegen seines philosophischen Nihilismus (Capelle 2008, S. 282 ff.), der ihm erlaubt, nahezu jeden Standpunkt mit gleichem Nachdruck zu vertreten, ebenso gegenüber wie die Ablehnung seiner rhythmisch und lautlich dominierten, „schmuckreichen“ Redeweise. Platon stilisiert Gorgias als Feindbild, um Rhetorik überhaupt in Verruf zu bringen (die eigene, oft unter Beweis gestellte, ausgenommen). Ein anderer Sophist, Protagoras (481 bis 411 v. Chr.), rühmt sich, dass er einer schlechteren Sache zum Sieg über eine bessere verhelfen könne; was Aristoteles, der kühl die logischen und moralischen Fehler rhetorischer Ansätze analysiert, als „Lüge“ brandmarken wird (Rhetorik II, 24, 10). Das historische Verdienst der Sophisten in Athen bleibt gleichwohl, dass sie öffentliches Reden in einer Demokratie, zumal bei politischen und juristischen Streitigkeiten, auf eine professionelle Basis gestellt haben. Zu ihrem Unglück sind nur wenige ihrer Texte im Original erhalten, und ihr geschichtliches Bild wurde vorwiegend durch Berichte und Verrisse der Kritiker geprägt. Von Gorgias liegen zwei vollständige, für den Unterricht geschriebene Reden vor, deren eine im Widerspruch zur herrschenden Meinung die Unschuld Helenas am Trojanischen Krieg zu begründen versucht (Lobpreis der Helena, Buchheim 2012, S. 3 ff.). Antiphon aus Athen, 411 v. Chr. als Putschist hingerichtet, hinterließ Musterreden für Anklage und Verteidigung im selben Fall (Tetralogiae 2, Caizzi 1969, S. 107 ff., 145 ff.); aber das beweist nicht, dass er in einer Sache als Redenschreiber für beide Parteien gearbeitet habe.
6
2. Im 4. Jh. v. Chr. beherrschen drei Philosophen- bzw. Rednerschulen das intellektuelle Feld in Athen. Sie werden geleitet von Platon, seinem sophistischen Antipoden Isokrates, sowie von Aristoteles. – Platon (427 bis 347 v. Chr.) wird im selben Jahr in Athen geboren, in dem Gorgias seine Lehrtätigkeit aufnimmt. Er schließt sich als junger Mann nicht den Sophisten an, sondern wird Schüler des Sokrates (gestorben 399), dessen gnadenlos bohrendes Fragen gegen eilfertige, vorgefasste oder unvertretbare Meinungen (genannt Mäeutik: „Hebammenkunst“) er als unbedingtes Suchen nach der alleinigen Wahrheit begreift. Platon eröffnet um 386 v. Chr. seine philosophische Akademie und zieht gegen die sophistische Konkurrenz zu Felde, zunächst auf das Gröbste im Dialog „Gorgias“ (Platon, Werke 1957 ff.). Dort reißt Sokrates, im (fingierten) Streitgespräch mit drei Sophisten, einen der Gegner zu dem prahlerischen Geständnis hin, Redner hätten die Macht, zu „töten wie die Tyrannen, wen sie wollen, und (sie) berauben des Vermögens und verweisen aus der Stadt, wen ihnen gut dünkt“ (Platon, Gorgias 466 c). Dergleichen gelinge ihnen, erklärt Sokrates, wo sie die Wortgewalt missbrauchen, um dem gemeinen Volk nach dem Munde zu reden (Gorgias 463 b ff.). Gut ein Jahrzehnt später, im Dialog „Phaidros“, relativiert Platon (wieder gestützt auf die Autorität Sokrates’) sein Urteil: Es sei nicht gegen die wahre, hohe Kunst des Redens und Schreibens gerichtet. Die Kritik an den Sophisten jedoch bleibt unerbittlich. Ein guter Redner könne nur sein, wer die Wahrheit erkenne und ihr folge: „Denn Tag und Nacht nicht unterscheiden zu können im Gerechten und Ungerechten, Bösen und Guten, das ist ... das Allerschimpflichste, und wenn auch das ganze Volk es lobte“ (Phaidros 277 d/e). Dass die Wahrheit erkennbar sei, davon geht Platon aus; der Weg zur Erkenntnis sei die dialektische Methode, nämlich die auf ein Ganzes bezogene Zergliederung, Analyse und Synthese (265 d - 266 b), erste Bedingung aber bleibe die Einsicht in das Wesen der Seele (270 c - 272 c, mit 246 a ff.). Der Auftrag des Redners sei es, die Wahrheit zu verbreiten; ihn legitimiert geradezu, dass die Wahrheit, um wirken zu können, den Vermittler braucht. Und schließlich mit Blick auf Zuhörer/Leser gesprochen: Die wahre Rede habe der „Seelenleitung“ zu dienen, im öffentlichen wie im privaten Leben (261 a, 270 c ff.). So begriffen, ist Rhetorik eine Zusatzqualifikation des Philosophen im Dienste der Wahrheit. Sophisten aber würden, da sie auf das „Scheinen“ statt auf das Wesen der Sache setzten, nur Trugbilder liefern (Platon, Sophistes 232 b ff.); wobei ihnen die Schwierigkeit, Schein und Sein zu unterscheiden, hilfreich sein wird (Sophistes 236 d ff.).
7
3. Nicht Platons (elitäre) Akademie ist zu Lebzeiten ihres Gründers die bevorzugte Bildungseinrichtung in Athen. Isokrates (436 bis 338 v. Chr.), ein Schüler Gorgias’, gründet um 390 v. Chr. die erfolgreichste attische Rednerschule, die er bis ins hohe Alter nach konstanten Grundsätzen leitet (Fuhrmann 2011, S. 24 ff.). Von ihm sind, neben Briefen und Fragmenten, 21 Reden überliefert (Isokrates 2003 und 1993/97); einige stellen seine Rhetorik programmatisch vor. Auch Isokrates hat einen philosophischen Ausgangspunkt (den der platonische Wahrheitsrigorismus nicht als philosophisch anerkennt): den Standpunkt des Skeptikers. Ohne, wie sein Lehrer, Nihilist zu sein, hält er es für unmöglich, menschliches Handeln aus „wahren“ Prämissen zwingend abzuleiten. Der Ausweg in den Grenzen der Vernunft besteht darin, Erfahrungen und Wahrscheinlichkeit zum Maßstab zu nehmen und die Meinungen der anderen ins Kalkül einzubeziehen. Erfolgreich handeln könne nur, wer „die Umstände gut zu gebrauchen weiß, wie sie sich Tag für Tag einstellen, und der eine den rechten Zeitpunkt treffende Meinung hat, eine Meinung, die in aller Regel zum Vorteil führt“ (Isokrates, Panathenaikus = Rede 12, 30; 2003 Vol. III, S. 7, 15). Dieses Streben nach Vorteil ist nicht die „Herrenmoral“ des Sophisten Kallikles, wonach Unrechtleiden schlechter sei als Unrechttun und dem Stärkeren von Natur aus mehr gebühre als dem Schwächeren (Platon, Gorgias 483 a ff.). Isokrates setzt auf moralische (Neben-)Wirkungen des individuellen Ehrgeizes: Wer Lob und Ansehen erringen möchte, werde so reden, dass er eine großzügige, anständige Gesinnung an den Tag lege und unverkennbar die Verpflichtung auf das Gemeinwohl ernst nehme. In dem Redefragment „Gegen die Sophisten“ (um 390 v. Chr.) distanziert Isokrates sich von den sophistischen Konkurrenten; nicht nur von maßloser Wortgewalt, auch von falschen pädagogischen Erwartungen: Der gute Redner werde nicht im Unterricht gemacht; wichtiger seien Begabung und Praxis, ergänzt durch das Vorbild des Lehrers. Die gewöhnlichen Elemente einer Rede zu lehren und zu lernen, sei leicht; zur Rednerkunst aber gehöre, das gelernte Wissen je nach Situation und nach der Lage des Einzelfalls angemessen einzusetzen (Isokrates, Contra Sophistas = Rede 13; 2003 Vol. III, S. 64 ff.). In der 354 v. Chr. verfassten „Antidosis“-Rede bekräftigt der Fünfundachtzigjährige mit beharrlichem Optimismus die drei Säulen seines Bildungsprogramms: Bei einem wissbegierigen Menschen wird sich „die Fähigkeit, gut zu reden und gut zu denken gleichzeitig einstellen“; der Vorteil, nach dem er strebt, ist nicht, „was von Unverständigen dafür gehalten wird“; glaubwürdig ist er dadurch, dass er „die Tugend nicht vernachlässigt“ (Isokrates, De Permutatione = Rede 15, 275-278; 2003 Vol. III, S. 134 f.).
8
4. Aristoteles aus Stageira (384 bis 322 v. Chr.) kommt siebzehnjährig nach Athen, um an Platons Akademie zu studieren, wird später dort Lehrer, verlässt nach Platons Tod jedoch die Stadt und wirkt u.a. am Makedonischen Hof als Erzieher Alexanders III (später „der Große“). Nach seiner Rückkehr ins nunmehr (seit 338 v. Chr.) von Makedonien beherrschte Athen errichtet er eine eigene Schule; seine Schüler heißen Peripatetiker, weil der Unterricht in einer Wandelhalle (Peripatos) stattfindet. Seine Sicht der Rhetorik hat Aristoteles ab etwa 335 v. Chr. niedergeschrieben. Um wenige Jahre älter ist allerdings ein Lehrbuch der Rhetorik, das als einziges aus dem Kreis der Sophisten vollständig erhalten blieb. Als Verfasser wurde der Redelehrer Anaximenes aus Lampsakos enttarnt, ebenfalls ein Lehrer Alexanders III; ein gefälschter Widmungsbrief „Aristoteles an Alexander“ hatte zunächst dazu geführt, dass das Werk dem vermeintlichen Briefabsender zugeschrieben wurde (Anaximenes 2000, Gohlke 1959). Anaximenes, „der am besten bekannte Durchschnitts-Rhetoriker der griechischen Klassik“ (Fuhrmann 2011, S. 29), hat den wohl gängigsten Lehrstoff nach üblichem Muster damaliger Lernhilfen und Nachschlagewerke gegliedert: Vorgestellt sind (sieben statt der sonst üblichen drei) Arten der Rede je nach Redeanlass, die gebräuchlichen Beweismittel (z.B. der Wahrscheinlichkeitsschluss) und Stilmittel, schließlich die einzelnen Redeteile in Verbindung mit jeweils einsetzbaren Argumenten. Im Gegensatz zu solchen Gebrauchsanweisungen ist Aristoteles’ „Rhetorik“ einerseits geprägt vom wissenschaftlichen Interesse des Philosophen, der umfassend erkennen will, wie Natur, Mensch und Gesellschaft funktionieren; zugleich aber sollen die gewonnenen Erkenntnisse der Praxis dienen, hier also der Ausbildung und Tätigkeit qualifizierter Rhetoren. Eine gewisse lebenskluge Kompromissbereitschaft gegenüber dem praktizierten Status quo trennt Aristoteles von Platon (Fuhrmann 2011, S. 33), der das Thema vorwiegend mit polemisch gewürzter Abneigung behandelte.
9
5. Gegenstand der Wissenschaft ist die Rhetorik für Aristoteles in zweierlei Hinsicht. Zum einen beim Erkennen der Methoden, die ein Redner anwenden darf, um seine Adressaten zu überzeugen; insoweit arbeitet der Rhetorik-Theoretiker erkenntnistheoretisch, denn er sucht und findet („kritisiert“, um hier Kants Terminus zu verwenden) „Überzeugungsmittel“, die „auf die Sache zielen“ (Aristoteles, Rhetorik I, 1, 1 ff.). Von ihnen zu unterscheiden sind „Verdächtigung, Mitleid und dergleichen Affekte der Seele“, die auf eine Person, z.B. den Richter zielen. Im wissenschaftlichen Feld bewegt sich sodann der Redner, dessen Aufgabe es nicht ist, „zu überreden, sondern zu untersuchen, was an jeder Sache Glaubwürdiges vorhanden ist“ (Rhetorik I, 1, 14). Doch auf Sachlichkeit allein kann der Redner nicht bauen; neben den überzeugungskräftigen Beweisen nennt Aristoteles drei Gründe, weshalb Zuhörer ihm „Glauben schenken: Einsicht, Tugend und Wohlwollen“. Wie es dem Redner gelingt, als einsichtig und rechtschaffen zu erscheinen, sagt ihm die Tugendlehre (Ethik); Wohlwollen wird gewonnen oder verspielt durch Affekte (Rhetorik II, 1, 5 ff.). Rhetorisch relevante Affekte und wie sie zu erzeugen seien, behandelt Aristoteles ebenso ausführlich, wie er eine Psychologie des Zuhörers entwickelt. In ihr stellt er den Charakter abhängig vom Lebensalter und den Lebensumständen, zumal vom sozialen Status eines Menschen dar (Rhetorik II, 2 ff. und II, 12 ff.). Auf die Suche nach neuen, bisher vernachlässigten Einsichten begibt Aristoteles sich auch in den Kapiteln über die Sprache, ausgehend von dem Grundgedanken jeder Rhetorik: „Es genügt nicht, das zu wissen, was man sagen soll, sondern notwendig auch, wie man dies sagen soll“ (Rhetorik III, 1, 2). Vollkommenheit erreicht der sprachliche Ausdruck, wo er „angemessen“ ist (Rhetorik III, 2, 1). Aufs Ganze gesehen, ist die „Rhetorik“ des Aristoteles kein umfassendes systematisches Lehrbuch (wie Quintilian es vorlegen wird, dazu unten 8.), vielmehr eine „Gedächtnisstütze“ des Autors zum Stand der eigenen Forschungen und für den Lehrbetrieb (Fuhrmann 2011, S. 33).
10
6. Nach dem Ende der griechischen Demokratie, in der anschließenden Epoche des Hellenismus, verändert sich das Wirkungsfeld der Rhetorik. Bisher im Wesentlichen auf öffentliches Reden ausgerichtet, wird sie nun zum Gegenstand bürgerlicher Allgemeinbildung und sorgt für einen hohen Standard der Argumentation und des Stils in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation überhaupt (Fuhrmann 2011, S. 38 f.). Das Griechische, als Weltsprache über den Mittelmeerraum verbreitet, ist auch die Sprache der Rhetorik in Theorie und Ausbildung. In der aufstrebenden Metropole Rom sind griechische Lehrmeister so erfolgreich, dass ein Senatsbeschluss im Jahr 161 v. Chr. dem Prätor empfiehlt, die fremden Philosophen und Rhetoren zu überwachen und, sobald „dies dem Staate förderlich sei“, aus der Stadt zu verweisen (Sueton, De rhetoribus I ‚ Fuhrmann 2011, S. 45. f.). Folge der konservativen Angst vor Überfremdung wird allerdings nicht die Zurückdrängung der Rhetorik sein, sondern, ab der Wende vom 2. zum 1. Jh. v. Chr., ihre Latinisierung. Die rhetorisch geschliffene (statt bloß naturwüchsige) politische Rede erlebt in den Institutionen der römischen Republik eine Renaissance (Fuhrmann 2011, S. 44 f.). Das älteste erhaltene Rhetoriklehrbuch in lateinischer Sprache ist die um 85 v. Chr. entstandene „Rhetorica ad Herennium“, vom unbekannten Verfasser einem Empfänger Herennius gewidmet (Auctor ad Herennium 1998). Cicero hat in so enger Anlehnung hieran sein Jugendwerk „De inventione“ verfasst, dass ihm lange Zeit auch die Autorschaft an der „Rhetorica“ zugeschrieben wurde. Die aufkommende lateinische Literatur informiert zugleich über die Entwicklung der Rhetorik seit Aristoteles’ Tod. Nur durch spätere Werke ist z.B. Hermagoras aus Temnos (2. Jh. vor Chr.) und seine für die Gerichtsrede wichtige Statuslehre (unten IV.5.) bekannt.
11
7. Die klassische römische Rhetorik ist mit zwei alles überragenden Namen verbunden: Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v. Chr.) und Marcus Fabius Quintilianus (um 35 bis 100 n. Chr.). Beide sind zugleich die tragenden Säulen der Wirkungsgeschichte von Rhetorik bis heute. – Cicero hatte an der Akademie in Athen studiert, sein Lehrer Philon aus Larissa hatte Platons Bann gebrochen und erstmals Rhetorik ins Lehrprogramm aufgenommen. Zeitlebens wird Cicero die Rhetorik als philosophische Disziplin begreifen: Ohne Beredsamkeit keine menschliche Kultur; den Redner bewahren Weisheit und Verantwortungsgefühl vor einem Missbrauch seiner Kunst, die Gesellschaft werde geschützt durch den Widerstand der Anständigen (Fuhrmann 2011, S. 51). Rhetorische Meisterschaft, verbunden mit nicht risikolosem Engagement gegen krasses Unrecht, beweist Cicero bereits bei seinem ersten großen Auftritt. Im Jahr 80 v. Chr. übernimmt er die Verteidigung des Sextus Roscius, dessen Vater nach Ende des Bürgerkriegs durch falsche Anschuldigung um allen Besitz gebracht und dann ermordet wurde; der Sohn wird, um auch ihn zu beseitigen, des Vatermordes angeklagt. Ciceros Verteidigungsrede (Reden I, 1993; Analyse bei Gast, 2006a, Rz. 589 ff.) führt zum Freispruch, eröffnet eine glänzende Rednerlaufbahn und eine Sammlung von Reden, die dank stilistischer Meisterschaft zum Inbegriff für klassisches Latein aufsteigen werden. – Schon vor dem Fall Roscius plant Cicero ein umfassendes Werk über Grundlagen und Werkzeuge der Rhetorik. Die Ausführung bleibt Fragment und hat den Titel „De inventione“ („Über die Auffindung des Stoffes“) erhalten, weil darin wesentliche Arbeitsschritte zur Vorbereitung einer Rede dargestellt sind. Das philosophisch-rhetorische Hauptwerk Ciceros, „De oratore“ („Vom Redner“), wird 55 v. Chr. vollendet und gilt als „die bedeutendste Darstellung der Rhetorik, welche die Antike hinterlassen hat“ (Fuhrmann 2011, S. 52). Es besteht aus drei Büchern, in denen jeweils nach einer Vorrede des Autors berühmte römische Redner bei einer fiktiven Veranstaltung des Jahres 91 v. Chr. auftreten; einer von ihnen hat als Hauptredner über ein Teilgebiet der Rhetorik zu referieren und seine Meinung gegen Kritik zu verteidigen. Das 1. Buch handelt von der umfassenden Bildung, über die der vollkommene Redner ebenso verfügen müsse wie über ein gehöriges Maß an Begabung; doch auch ein Empiriker kommt darin zu Wort, der als Spezialist für das Machbare den Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit verteidigt. Die Bücher 2 und 3 widmen sich den fünf officia oratoris, das heißt den notwendigen Bausteinen der Redelehre (dazu unten IV.2). Ergänzend entsteht im Jahr 46 v. Chr. der Dialog „Brutus“, der eine Geschichte der Rhetorik bietet, und ungefähr zeitgleich „Orator“, eine Monografie über den Redestil. Die kleine Schrift „Topica“ („Die Kunst, richtig zu argumentieren“), verfasst während einer Seereise im Juli 44 v. Chr., schließt Ciceros literarisches Schaffen als Rhetoriklehrer ab. Der Redner Cicero aber wird bald danach Opfer seines letzten Redezyklus: Mit seinen „Philippischen Reden“ bekämpft er den Konsul Marcus Antonius, wird 43 v. Chr. geächtet und ermordet.
12
8. Hat Cicero mit „De oratore“ eine nach Vollkommenheit strebende Darstellung der Rhetorik hinterlassen, so verdanken wir Quintilian die rund 150 Jahre jüngere, optimal vollständige Präsentation. Quintilian, um 35 n. Chr. im spanischen Calagurris geboren, studiert in Rom und kehrt zunächst als Redelehrer in die Provinz zurück. Neros Nachfolger Galba beruft ihn im Jahr 70 nach Rom, er wird dort der erste staatlich besoldete Professor für Rhetorik (Seel 1987, S. 19, 75). Gegen Ende seines Lebens schreibt er sein Lehrbuch, adressiert an einen Lehrer der Beredsamkeit (Fuhrmann, 2011, S. 70; Rahn 1995, S. XXI). Die „12 Bücher zur Ausbildung des Redners“ (Rahn 1995) bieten den gesamten Lehrstoff der klassischen Rhetorik, verbunden mit zahlreichen Hinweisen zur Praxis der Stoffvermittlung. Das 2. Buch behandelt den Rhetorikunterricht: z.B. das richtige Anfangsalter der Schüler; Verhaltensregeln für die Lehrer-Schüler-Beziehung; die Übungen für Anfänger, mit Empfehlungen zur Begleitlektüre. Maßstäbe, die Quintilian an Charakter und Verhalten des Lehrers anlegt, finden ihre Entsprechung in Anforderungen an das Ethos des Redners. Seit Isokrates kreist die Theorie der Rhetorik um die Frage, wie der Missbrauch formaler „persuasiver“ Methoden verhindert werden könne. Bei Quintilian erreicht die Tendenz, den nicht-technischen Anteil an der Qualifikation des Redners aufzuwerten, einen Höhepunkt. Nur der vir bonus, der Ehrenmann, könne die Rolle des guten Redners ausfüllen (Quintilian XII, 1, 1).
13
9. Quintilians Nachfolger sind Kleinmeister, die das rhetorische Erbe verwalten, gelegentlich auch Verfeinerungen hinzufügen. Unter dem Titel „Rhetores Latini minores“ (Halm 1964) ist gesammelt, was von ihren Schriften erhalten blieb. Wie die klassische Rhetorik an der Schwelle zum Mittelalter eingeschätzt wird, bezeugt Isidor, Bischof von Sevilla und Enzyklopädist: Sie stelle sich „in solcher Fülle und so vielfältig“ dar, „dass der Leser zwar in der Lage ist, sie zu bewundern, nicht aber, sie zu begreifen“ (Etymologiae II, II 1, Möller 2008, S. 85). Isidor (um 560 bis 636) hat in den zwanzig Bänden seiner „Etymologiae“ neben der christlichen Lehre das für ihn noch erreichbare antike Wissen in der gedrängten und verkürzenden Form eines Lexikons zusammengetragen. Einen Schwerpunkt machen darin die sieben „freien Künste“ (artes liberales) aus; ein Fächerkanon, an dessen Spitze neben Grammatik und Logik („Dialektik“) die Rhetorik steht („Trivium“) und der bis Ende des 18. Jh. Grundstock jeglicher Schulbildung ist (Ueding 1992, Stichworte „artes liberales“ und „Artistenfakultät“). In der nachantiken Bildungsgeschichte wechseln Phasen höchster Wertschätzung für die Rhetorik mit solchen der Verdrängung und Verteufelung bis heute ab. Das erkenntnistheoretische Ideal der hochmittelalterlichen Scholastik fordert, dass Ergebnisse aus gesicherten Prämissen analytisch abgeleitet werden. Zur Prämisse führe die via inventionis, der Weg des Entdeckens; bei der Prämisse beginne die via iudicii, der Weg des richtigen Urteilens. Das Urteil (als Kategorie der Logik) ist vernunftbestimmt (judicium ... est recta determinatio rationis) und führt fragliche Gegenstände („Thesen“) auf das jeweilige Prinzip zurück, dem sie als etwas „Prinzipiiertes“ schon zugehören (resolvit principiata in principia) (Thomas v. Aquin, Summa theologiae I, 79, 8; II, 57, 6; Ignotus Auctor 1980, 655 c). Gleichzeitig allerdings blüht eine Kultur des Streitgesprächs (disputatio), die im Hochschulbetrieb praktiziert, jedoch auch in Streitschriften von Autoren wie Thomas v. Aquin gepflegt wird, in beiden Fällen unter Einsatz aller verfügbaren rhetorischen Mittel und mit dem Ziel, Zustimmung der Adressaten (Zuhörer, Leser) zu gewinnen (Pieper 1986, S. 109 ff.).
14
10. Die ganze Vielfalt des rhetorischen Instrumentariums steht erst wieder bereit, nachdem zu Beginn des 15. Jh. verschollene Texte von Cicero, vor allem eine lückenlose Abschrift von „De oratore“ (Lodi bei Mailand 1421) und ebenso vollständig Quintilians „De institutione oratoria“ (St. Gallen 1416) gefunden wurden. Entdeckungen wie diese tragen bei zu einem vom Humanismus betriebenen Paradigmenwechsel: Gegenüber strenger sapientia mit ihrer unausweichlichen Logik setzt sich eine offenere, freiere prudentia als lebenspraktische Klugheit durch. In Fragen richtigen Verhaltens löst Rhetorik die Philosophie ab (G. Schröder 1997, S. 11 ff., 22 ff.). „Die Geltung, das Image, das man bei den anderen hat, (ist) das eigentlich Bedeutsame und Entscheidende“ (Schröder 1997, S. 22), und Geltungswünsche werden zum Maßstab, an dem ein Mensch sein Auftreten in der Gesellschaft ausrichtet. Die Prudentia-Literatur des 16. bis 18. Jh. konkretisiert dieses Programm in einer Flut von Ratgebern. Der Hofmann der Spätrenaissance erhält einen Leitfaden im „Cortegiano“ des Grafen B. Castiglione (1528), dessen Konzeption darin besteht, „die strategischen Vorgaben der antiken Rhetorik in aktualisierter Form einem nicht-akademischen Publikum zugänglich zu machen“ (Hinz 1997, S. 125 ff.). Die literarischen Lebenshilfen orientieren sich zwar am höfischen Verhalten, das jedoch eine die Lebenskreise überschreitende Faszination ausübt, so dass auch die vita civilis der Bürgerlichen von dort Vorbilder bezieht (Barner 1970, S. 138 ff.). Andere Anleitungswerke richten sich im absoluten Fürstenstaat mit alles reglementierendem Kanzleiwesen an den „Politikus“, d. h. den zumeist bürgerlichen Hofbeamten und bringen ihm Rhetorik als Instrument der bürokratischen Kommunikation nahe (Barner 1970, S. 167 ff., 176 ff.). Eine nicht geringe Rolle spielt hierbei der Briefstil: die ars (bene) dicendi abgewandelt zur ars dictandi (Barner 1970, S. 129, 156). Die Aufklärung als zunehmend relevante Geistesströmung ist immerhin das 18. Jh. hindurch damit beschäftigt, das rhetorische Existenzmodell aufzulösen und das Ideal vernunftbestimmten Handelns und Sprechens dagegen zu setzen. Ein geläuterter Rest des rhetorischen Arsenals bleibt gleichwohl anerkannt. Sogar Kant, der für „Beredsamkeit“ (ars oratoria) nichts als Verachtung übrig hat, unterscheidet davon die „bloße Wohlredenheit (Eloquenz und Stil)“ als nicht persuasiv, sondern „absichtsfrei“ eingesetzte Methode des kunstvollen Ausdrucks (Kant, Kritik der Urteilskraft, B 216 f.).
15
11. In die Geschichte der Rhetorik eingebettet ist das bis zum 19. Jh. untrennbare (dann nominell abgebrochene) Zusammenspiel von Rhetorik einerseits, Rechtspraxis und Jurisprudenz andererseits. Die klassische griechische Rechtskultur ohne Juristen ist eine Synthese aus Philosophie und Rhetorik; Philosophen entwickeln die Inhalte des Gerechtigkeitsbegriffs, Rhetoriklehrer tragen die Methoden der Rechtsfindung, den lógos dikanikós bei (Glau 1996, S. 1 ff.). In Rom konkurrieren Redner und Juristen miteinander um die Auftrittsmöglichkeiten als Anwälte. Für Cicero, freilich nicht für jeden seiner Zeitgenossen, ist selbstverständlich, dass ein Redner, der eine Prozessvertretung übernehme, juristisches Verständnis und die erforderlichen Rechtskenntnisse besitze (De oratore I, 166 ff.; ebenso Quintilian XII, 3). Der juristische Ignorant trete peinlicherweise zu oft vor Gericht auf, verdiene aber nicht, Redner genannt zu werden. Ciceros alter ego in „De oratore“, Crassus, zieht sich den Vorwurf zu, für ihn sei „ein Rechtsgelehrter nichts weiter als ein vorsichtiger und scharfsinniger Gesetzeskrämer, ein Ausrufer bei Gericht, einer, der Formeln herunterleiert“ (De oratore I, 236). Die Gewichte werden sich in der Folgezeit zugunsten der zunehmend rhetorisch geschulten Juristen verschieben. Einer der Gründe ist die (freilich langsam fortschreitende) Objektivierung des Rechts. Meinungen renommierter Rechtsgelehrter, die ein Redner je nach Interesse als exemplarisch zitieren („Autoritätsbeweis“) oder als abwegig verwerfen konnte, wurden in Ostrom bereits im Jahr 534 innerhalb des Corpus Juris zu Gesetzen; ab dem 12. Jh. sorgt im Westen die „Rezeption“ für die Verbreitung des wiederentdeckten römischen Rechts, das zunächst von Gelehrten an den oberitalienischen Rechtsschulen zur ratio scripta („geschriebenen Vernunft“) erklärt wird und schließlich als „gemeines Recht“ auch im Hl. Römischen Reich subsidiär gilt. Begünstigt werden die Juristen zum anderen durch einen Paradigmenwechsel des Prozessrechts, nämlich den im 4. Jh. einsetzenden Übergang vom mündlichen zum schriftlichen Verfahren. Der juristisch tätige Rhetor verliert seine Bühne und muss in die Schreibstube überwechseln. Der Idealtypus des omnikompetenten Rhetors/Orators, einst von Cicero verkörpert, reduziert sich auf den Theoretiker und Lehrer für Allgemeine Rhetorik, also für Grundlagen und Methoden der Beredsamkeit. Bei der Suche nach Möglichkeiten, aktuelle Rechtsfälle mit Hilfe römischer Rechtssätze zu lösen, probieren im 12. Jh. Juristen eigene Techniken der Argumentation aus (Hohmann, Rhetorik Jahrbuch 1996, S. 35 ff. und 1998, 791 ff.), um dann jedoch auf eine rhetorische Kernmethode einzuschwenken: die (ciceronische) Topik (Otte 1974 sowie 1998, S. 17, 19 ff). Seit dem 16. Jh. wird juristische Topik zum blühenden Teilgebiet innerhalb der juristischen Fachliteratur. Das wohl erfolgreichste unter zahlreichen Lehrbüchern sind die „Loci argumentorum legales“ des Niederländers Nicolaus Everardus, erstmals 1516 und bis 1662 insgesamt 28-mal gedruckt (Otte 1998, S. 20). Die von Everardus dargestellten 131 loci (griechisch topoi) sind Fundstellen für Argumente; man darf dazu auch sagen: „Stichworte, mit denen sich Argumente leicht assoziieren lassen“ (Otte 1998, S. 21). Argumente nämlich, die ihrerseits eine bestimmte Auslegung und Anwendung eines gegebenen Rechtssatzes einleuchtend machen. Wie der rhetorisch arbeitende Jurist sich einen praktisch unerschöpflichen Quell von loci aneignen kann, sagt Valentin Wilhelm Forster in seinem „Interpres“ (1613): Entsprechend umfassend gebildet, werde er Argumente aus allen Wissenschaften (historica, arithmetica, geometrica, physio-medica, ethico-politica) gewinnen. Ciceros Ideal des gebildeten Redners ist damit übertragen auf den Juristen. Zwar kann der deutsche Enzyklopädist J.G. Sulzer einer langen Aufzählung gedruckter französischer Gerichtsreden aus dem 17. und 18 Jh. nur die lakonische Bemerkung für den deutschsprachigen Raum gegenüberstellen: „Gerichtliche Beredsamkeit haben wir nicht“ (Sulzer 1794, S. 40). Jedoch wurde zur selben Zeit Rhetorik in großem Umfang auf wissenschaftlicher Ebene schriftlich ausgeübt: durch eine Flut von Gutachten, die juristische Fakultäten auf Bestellung für Prozessparteien lieferten (Falk 2006). – Im Schatten üppig wuchernder Topoi- bzw. Loci-Kataloge breitet sich im 18. Jahrhundert die Tendenz aus, „der Rhetorik im Recht zu entkommen und es auf eine logisch-wissenschaftliche Basis zu stellen“ (Hohmann 1998, 802). Die nun entstehende Hermeneutik will mit Hilfe eines überschaubaren Methodenkanons zudem eine großzügig-opportune Handhabung von Rechtssätzen verhindern und deren wahre Bedeutung ermitteln und durchsetzen. Dieses Programm löst im Übergang vom 18. zum 19. Jh. die barocke Topik ab (Hohmann 1998, 810; Fuhrmann, Rhetorik Jahrbuch 1989, S. 43 ff.; Fuhrmann 1983; H. Schanze 1974).
16
12. Mit dem methodologisch gleichsam offiziellen Ende der juristischen Topik und also der juristischen Rhetorik geht, im Zuge der napoleonischen Reformen, die (Wieder-) Einführung öffentlicher, mündlicher Gerichtsverfahren einher. Damit ist eine Situation geschaffen, in der jedenfalls die Gerichtsrede wieder aufblühen kann (vorsichtiger gesagt: könnte), freilich nicht mit ihrem einstigen rechtsschöpferischen Rang. Für das Plädoyer vor Gericht erscheinen im 19. Jh., nach englischem und französischem Vorbild, bald auch deutsche Lehrbücher (K.S. Zachariä, „Anleitung zur gerichtlichen Beredsamkeit“, 1810; C.J.A. Mittermaier, Anleitung zur Vertheidigungs-Kunst im Criminal-Prozesse, 1814, 4. Aufl. 1845; O.L.B. Wolff, „Lehr- und Handbuch der gerichtlichen Beredsamkeit“, 1850). Schließlich fordert H. Ortloff, „Die gerichtliche Redekunst“, in scharfer Abkehr von französischer (noch immer ciceronischer) Gerichtsrhetorik die schlichte, nüchterne Rede im „Geist des germanischen Volkscharakters“ (1887, S. 11). Als Vorbilder an Klarheit und Schlichtheit des Ausdrucks empfiehlt schließlich die „Deutsche Redelehre“ des Bamberger Gymnasialprofessors Hans Probst – die deutschen Klassiker (1905, S. 107 ff.)
IV. Das Instrumentarium der klassischen Rhetorik
17
1. Rhetorik ist ein System aus sprachlichen Mitteln, die ein Mensch redend oder schreibend einsetzt, um einer bestimmten Meinung Geltung zu verschaffen. Ausgeformt wurde es in den ersten 500 Jahren seiner dokumentierten Geschichte, von Gorgias bis Quintilian. Als Ende des 18. Jh. der Rhetoriklehrer J. G. Sulzer zum Stand der „schönen Künste“ Bilanz zieht, stellt er zur „Redekunst“ fest: „Die Neuern haben die Theorie dieser Kunst ohngefähr da gelassen, wo die Alten stille gestanden.“ Er kenne keine neueren Schriften, die er „einem, der den Cicero und Quintilian studirt hat, zum ferneren Studium der Theorie empfehlen könnte“ (Sulzer 1794, S. 45). Entsprechend ist die seit den 1950er Jahren formulierte „Neue Rhetorik“ vor allem eines: der Versuch einer Renaissance (Fey 1979). Die folgende Skizze führt deshalb nicht durch ein geistesgeschichtliches Museum, sie zeigt Grundlagen der aktuellen juristischen Rhetorik.
18
2. Die Rhetorik hat immer verwendet, was man heute „Checklisten“ nennt. Eine solche Liste stellt die fünf officia oratoris vor, als Bausteine der Redelehre, Gliederungsschema für Lehrbücher und als Abfolge der Arbeitsgänge beim Erstellen der Rede. Quintilian zählt sie entsprechend der Tradition auf. Sie heißen inventio: Erfinden bzw. Auffinden des Redestoffes; dispositio: Gliederung des Stoffes, Aufbau der Rede; elocutio: Stilisierung, die Wahl der richtigen Stilmittel; memoria: Auswendiglernen für den freien Vortrag; pronuntiatio sive actio: Durchführung, Vortrag (Quintilian III, 3, 1). – Inventio, „das Ersinnen (excogitatio) wahrer oder wahrscheinlicher Tatsachen, die den Fall glaubwürdig machen sollten“ (Cicero, De inventione I, 9), geschieht nicht nur bei Beginn der Herstellung einer Rede, sondern begleitet die Arbeit mit Verbesserungen und Harmonisierung der Aussagen, bis der Redetext fertig dasteht.
19
3. Die „Rede an sich“ gibt es nicht, sie handelt immer von einem Gegenstand, hat ein Thema. Auf Aristoteles geht die Unterscheidung dreier „Redegattungen“ zurück: die Rede vor der Volksversammlung, „beratende Rede“ genannt (bei den lateinischen Autoren genus deliberativum); die Rede vor dem Richter, „Gerichtsrede“ (genus iudiciale); die „Prunkrede“, die entweder Lob („Grabrede“) oder Tadel spendet (genus demonstrativum) (Aristoteles, Rhetorik I, 3, 1-3; Cicero, De inventione I, 7 sowie De oratore II, 41 ff.). Quintilian verteidigt diese Dreiteilung gegen alle Versuche, stärker zu differenzieren und damit die Übersicht zu verwirren; würde jeder Redezweck („klagen, trösten, besänftigen, anfeuern“, etc.) eine eigene Gattung begründen, wären diese kaum zu zählen (Quintilian III, 4, 2 ff.). Bei der Dreizahl ist es in der Folgezeit geblieben.
20
4. Ein Grundlagenstreit, mit dem vor allem Cicero sich eine Zeitlang abquält, betrifft den Umfang des Redestoffs: Darf ein Redner über alles reden (wie Gorgias gemeint hatte), oder nur über Einzelfälle? Zwischen dem konkreten Fall (causa) und der grundsätzlichen, allgemeinen Streitfrage (questio) sei eine strikte Grenze zu ziehen, Rhetorik und Redner seien nur im ersten Bereich angesiedelt (De inventione I, 8). Allgemeine Themen sind hiernach Sache der Philosophie. Später fordert Cicero, am deutlichsten in „Orator“, dass „der Redner – nicht der gewöhnliche, sondern der vollkommene – den Streitfall, wann immer er es kann, von den gegebenen Personen und Zeitumständen loslösen (soll) ... (weil) das, was vom Ganzen bewiesen ist, auch für den Teil als bewiesen gelten muss“ (Orator 45 f.). Die hierzu passende Terminologie unterscheidet nunmehr zwischen einer Frage, die begrenzt ist durch die Tatsachen des Einzelfalls (quaestio finita), und der ohne solche Konkretisierung gestellten unbegrenzten Frage (quaestio infinita) (Cicero, De oratore III, 107, 120 ff.; Quintilian III, 5, 5). Schon um beide Arten des Fragens richtig voneinander zu trennen, benötige der Redner allerdings philosophische Schulung (Cicero, Orator 16).
21
5. Zur Kunst des Redners gehört es, den Gegenstand seiner Rede von vornherein präzise zu bestimmen. Exemplarisch: Jeder Rechtsstreit hat „einen Punkt, über den der Richterspruch gefällt werden soll“, und deshalb „wird dasjenige der Status des ganzen Falles sein, wovon sowohl der Redner weiß, dass er es vor allem verfechten, wie auch der Richter, dass er es am stärksten beachten muss“ (Quintilian III, 6, 9). Die Lehre vom status (griech. stasis), zum Schema ausgearbeitet durch Hermagoras aus Temnos, überliefert in der durch Cicero (De oratore II, 104 ff; Orator 45) und Quintilian festgeschriebenen Fassung, kreist den Fallkern am Leitfaden dreier Fragen
22/p>
(1) Die Frage an sit: ob etwas sei, bestimmt den status coniecturalis, „Vermutungsstatus“. Hier geht es darum, ob und auf welche Weise, mit welchem Ablauf und welchen Beteiligten etwas geschehen sei (Quintilian VII, 2, bei 2, 7 und 18). Der Rechtsfall wird überhaupt begründet durch „das erste Zusammenprallen der Streitpunkte, hervorgegangen aus der Zurückweisung einer Beschuldigung, z.B. auf folgende Art: ‚Du hast es getan.’ – ‚Ich habe es nicht getan.’“ (Cicero, De inventione I, 10).
23
(2) Die Frage quid sit: was es sei, führt in den status finitivus, „Definitionsstatus“. Wer nicht leugnen kann, dass er sich auf eine bestimmte Weise verhalten habe, wird bestreiten, dass er hierdurch die ihm zur Last gelegte Tat begangen habe (Quintilian VII, 3,1). Nun geht es um die rechtliche Erheblichkeit eines Verhaltens, also um den einschlägigen Rechtsbegriff. Quintilian nennt dazu ein „allbekanntes“ Beispiel: Ein Angeklagter hat aus dem Tempel eine Goldmünze mitgenommen; er sagt, er habe sie auf dem Boden gefunden. Sein Verteidiger muss „Diebstahl“ so eng fassen, dass „Finden“ nicht darunter subsumierbar ist. Gelingt es nicht, die entsprechend enge Definition zu begründen (in klassischer Terminologie: „zu beweisen“), kann noch immer bestritten werden, dass dieser Diebstahl den schlimmeren Tatbestand „Tempelraub“ erfülle (Quintilian VII, 3, 22).
24
(3) Die Frage quale sit: wie es sei, betrifft den status qualitatis, „Beschaffenheitsstatus“. Gemeint sind die rechtlichen Modalitäten der festgestellten und auf den Begriff gebrachten Tat. Streiten kann man z.B. um ihre Rechtfertigung, ihre „Verkleinerung“ oder ihre Entschuldigung (Quintilian III, 6, 81 und VII, 4, 3); „verkleinert“ würde die Tat durch mildernde Umstände (VII, 4, 15). – Allerdings kann ein Rechtsstreit sich überhaupt darauf beschränken, wie ein Gesetz oder eine Urkunde auszulegen sei; er sei durch den Beschaffenheitsstatus hinreichend bestimmt (Quintilian VII, 5, 1 ff.). – Quintilian hält das dreiteilige Schema der Falllösung für so ausgereift, dass er weiteren, zur Debatte stehenden status-Formen eine Absage erteilt (Quintilian III, 6, 13 ff. Zu Gegenmeinungen Wesel, 1967).
25
6. Der Redner hat die von ihm herbeigeschaffte Stofffülle in eine Anordnung zu bringen, in der er alles, worauf es (ihm) ankommt, wirksam vortragen kann. Die Rhetorik gibt ihm dafür einen erprobten Bauplan an die Hand. Aristoteles allerdings begnügt sich mit einer Zweiteilung, weil er alle drei Redegattungen damit erfassen will: „Man muss nämlich den Sachverhalt, um den es sich handelt, darlegen (próthesis) und den Beweis zu dem Gesagten antreten (pístis)“ (Aristoteles, Rhetorik III, 13, 1). Hinweise zu Einleitung und Schluss der Rede gibt er gleichwohl (Rhetorik III, 14 und 19). Der frühe Cicero kommt auf sechs obligatorische Redeteile: Einleitung (exordium), Darlegung des Sachverhalts (narratio), Einteilung des Stoffes (partitio), Bekräftigung (confirmatio), Widerlegung (reprehensio) und Schluss (conclusio) (Cicero, De inventione I, 19). Diese Gliederung ist durch die als exemplarisch angesetzte Gerichtsrede bestimmt. In „De oratore“ breitet Cicero das gleiche Schema aus, ohne seiner früheren Terminologie zu folgen (De oratore II, 315, 326, 331, 332). Quintilian schließlich, ebenfalls auf das Muster genus iudiciale fixiert, stellt fest: Die Teile der Gerichtsrede „sind nach Meinung der meisten Autoritäten fünf: Einleitung (prooemium), Erzählung (narratio), Beweisführung (probatio), Widerlegung (refutatio), Schlusswort (peroratio)“ (Quintilian III, 9, 1). Isidor von Sevilla kürzt dann auf vier Teile, indem er die Partien, die dem Beweis gewidmet sind, unter argumentatio zusammenfasst (Isidor, Etymologiae II, VII 1, Möller 2008, S. 89). Hinter den Differenzen bei Cicero und Quintilian stehen keine Unterschiede im inhaltlichen Konzept.
7. Zu den Redeteilen im einzelnen:
26
(1) Die Einleitung (wobei Quintilian das griechische Fremdwort „Proömium“ dem lateinischen exordium vorzieht). Sie soll „das Gemüt des Zuhörers“ (anima auditoris) auf das Kommende vorbereiten (Cicero, De inventione 19; De oratore II, 315 ff.). Dreierlei will jeder Redner erreichen, nämlich, dass gerade ihm das Auditorium „wohlwollend, gespannt und belehrbar“ (benevolum, attendum, docilem) zuhöre (Cicero, De inventione I, 20; Quintilian IV, 1, 5). Eine Geneigtheit, die während der ganzen Rede andauern soll; um sie hervorzurufen, müsse der Anfang „genau, scharfsinnig, reich an Gedanken und angemessen in der sprachlichen Form sein, vor allem aber sich ausschließlich auf den jeweiligen Fall beziehen“ (Cicero, De oratore II, 315). Anknüpfungspunkte findet der Redner bei Personen und Ereignissen des Falles, Erwartungen und Vorurteilen des Publikums, Meinungen und Werthaltungen der Richter sowie in Gesetzestexten.
27
(2) Die Erzählung des Sachverhalts. Dargestellt werden Tatsachen, aufbereitet als Rechtsfall, also vor dem Hintergrund von Definitions- und Beschaffenheitsstatus ebenso wie mit Rücksicht auf die Beweislage. In jedem Fall sei die Erzählung kurz, klar, glaubwürdig (Cicero: brevis, aperta, probabilis; Quintilian: lucidus, brevis, veri similis) (Cicero, De inventione I, 28 f.; Quintilian IV, 2, 31, 36, 52).
28
(3) Die Beweisführung. Ciceros zusätzlichen Gliederungspunkt partitio, nämlich die Ankündigung des Beweisziels und Darlegung des Beweisgangs, bezieht Quintilian in die Beweisführung als deren Auftakt mit ein (Quintilian III, 9, 2; IV, 4 und IV, 5). Hier nun geht es um die Stützung und Bekräftigung des erzählten Sachverhalts (Cicero, De inventione I, 33 f.; De oratore II, 331; Quintilian IV, 3, 1). Die Erzählung arbeitet in erster Linie mit Tatsachenbehauptungen; was davon weder evident, noch unstreitig ist, muss der Redner nun glaubhaft machen. In diesem Zusammenhang kann sich die Notwendigkeit ergeben, auch die Benennungen aus dem Definitionsstatus (oben 5.(2)) als „richtig“ zu beweisen. – Einzelheiten zu den Beweismitteln unten 9.-12.
29
(4) Die Widerlegung. Sie muss „entkräften, was von der Gegenseite behauptet worden ist“ (Quintilian V, 13, 1), wobei ein notwendiger Zusammenhang bestehe zwischen Bekräftigung der eigenen und Entkräftung der gegnerischen Behauptungen (Cicero, De oratore II, 331). Drei Wege der Gegenwehr sind eröffnet: zu leugnen; Vorwürfe zu widerlegen; möglichst viel von der Beweislast abzuwälzen (aut negandum aut defendendum aut transferendum) (Quintilian V, 13, 4). In der Rolle des (An-)Klägers kann ein Redner in Versuchung geraten, mögliche Aussagen des Gegners im Vorgriff widerlegen zu wollen; eine Praxis, die Quintilian als zu riskant ablehnt. Es sei denn, dass wir gegnerische Dinge „mit Gewissheit ankündigen können, weil außer ihnen nichts in Frage kommt“ (Quintilian V, 13, 46 und 49). Die Chance zur späteren Abwehr besteht im Anschluss an die beiden Hauptreden, in der altercatio (Wechselrede): hier „kommt es zum erbittertsten Kampfe, und nirgends wird mehr mit der blanken Waffe gefochten“ (Quintilian VI, 4, 1-8). Diesen Kampf (natürlich mit Worten) fechten oftmals eigens darauf trainierte Gehilfen des Anwalts aus, der „Schwarm der Grauröcke“ (pullata turba). – Die sichtbare Auseinandersetzung ist aber nur die Spitze eines rhetorischen Eisbergs; Quintilian verliert den Kontrahenten zu keiner Zeit aus den Augen: „Ich suchte nicht weniger die Lage der Gegenpartei zu durchdenken als meine eigene. Und als erstes suchte ich ... festzustellen, was jede Partei erreichen wollte, sodann womit“ (Quintilian VII, 1, 5 und 6 ff.).
30
(5) Das Schlusswort. Die Rede soll „mit einem besonderen Höhepunkt schließen, indem man den Richter entweder entflammt oder besänftigt“ (Cicero, De oratore II, 332). Quintilian zielt darauf ab, Tatsachen mit „Gefühlswirkungen“ zu verbinden (Quintilian VI, 1, 1). Da er jedoch auf das Ethos des Redners bedacht ist, will er durch Emotionen (adfectibus) nur wirken, „falls auf anderem Wege wahre, gerechte und gemeinnützige Ziele sich nicht erreichen lassen“ (Quintilian VI, 1, 7).
31
8. Die Arbeit des Redners wird erleichtert, wenn er für typische Fallgestaltungen jeweils angemessene rhetorische Hilfen erhalten kann. Eine solche Typologie ist seit Auctor ad Herennium vorhanden (Auctor I, 5); Cicero hat sie subtil ausgestaltet (De inventione I, 20 ff.). In ihr sind fünf Fallgattungen aufgelistet, und zwar abgestuft nach dem Grad der Schwierigkeit, die es bereitet, eine Sache (zumal vor Gericht) zu vertreten. Die Sache kann gut, weniger gut oder ausgesprochen schlecht vertretbar sein. Die fünf Gattungen sind erfasst unter dem Namen genera causarum (dieselbe Bezeichnung wird für die drei Redegattungen verwendet, oben 3.), gängig übersetzt mit „Vertretbarkeitsgrade“ (Lausberg 2007, § 64, S. 56 ff.; Gast 2009, 1115 ff.). Quintilian zählt auf: Ein Fall ist ehrenhaft (honestum), niedrig (humile), zweifelhaft oder zweideutig (dubium vel anceps), überraschend (admirabile) oder dunkel (obscurum genus). Von sich aus fügt er den Falltyp „schimpflich“ (turpe genus) hinzu (Quintilian IV, 1, 40 f.). Abgehandelt werden die Vertretbarkeitsgrade meist in Verbindung mit dem Proömium: der Redner soll jeden schlechten Eindruck von Beginn an vermeiden oder bei erster Gelegenheit aus der Welt schaffen.
32
Im einzelnen:
(1) Der ehrenhafte Fall. Die Sache entspricht dem Rechtsempfinden der Zuhörer; sie hat dadurch schon „von sich aus genügend Gewinnbringendes“, im Unterschied zu Fällen, denen „man nachhelfen“ muss (Quintilian IV, 1, 41). Begünstigt vom positiven Vorverständnis ist die eine Prozesspartei, die Gegenseite von vornherein im Nachteil: für sie ist die Sache „überraschend“, wenn nicht gar „schimpflich“. Ein Redner kann jedoch seinen Vorsprung verspielen, indem er unbescheiden oder allzu selbstsicher auftritt (Quintilian IV, 1, 55).
33
(2) Der Fall ist „niedrig“, nämlich belanglos, geringfügig, die Richter empfinden die Sache als Belästigung, das Publikum als langweilig. Hiergegen richtet sich der Versuch, einen ungewöhnlichen Hintergrund, ein plausibles Motiv für den Rechtsstreit darzulegen. So könnte Interesse geweckt werden.
34
(3) Der zweideutige oder zweifelhafte Fall. Gemeint ist Verschiedenes. Entweder ist der Status des Falles strittig; dann muss man mit dem strittigen Punkt selbst einleiten. Oder die Sache enthält „teils Schimpflichkeit, teils Ehrenhaftigkeit“, so dass der Zuhörer zwischen Abstoßung und Wohlwollen schwankt; hier „soll man Wohlwollen zu gewinnen suchen, damit der Fall in die ehrenhafte Art hinübergetragen scheint“ (Cicero, De inventione I, 21). Allgemein formuliert: „Von dem, was störend wirkt, sollen wir unsere Zuflucht nehmen zu dem, was günstig ist“ (Quintilian IV, 1, 44).
35
(4) Der überraschende Fall. Gemeint ist eine den Zuhörern „entfremdete“ (alienatus) Streitsache; die Distanzierung kann bis zur Feindseligkeit reichen (Cicero, De inventione I, 20, 21). Der Redner vertritt eine Partei, die sich dem „allgemeinen Wert- und Wahrheitsempfinden“ zuwider, z.B. heuchlerisch, maßlos egoistisch, rücksichtslos verhalten hat (Quintilian IV, 1, 44). Cicero empfiehlt ihm das Mittel der „Einschmeichelung“ (insinuatio); dabei wird versucht, die für den Gegner vorhandene Zuneigung der Zuhörer abzubauen (De inventione I, 21, 24). Zu riskant sei das Werben um Wohlwollen bei feindseligen Zuhörern. Auch Quintilian (IV, 1, 44) rät hier, wo Sympathie nicht zu gewinnen sei, jedenfalls den Hass zu mindern.
36
(5) Der dunkle Fall. Er ist in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht schwer durchschaubar. Hier hilft nur, Neugierde zu wecken und die Fäden zu entwirren (Cicero, De inventione I, 21; Quintilian IV, 1, 41).
37
(6) Der Fall ist „schimpflich“. Er flößt Abscheu gegen die eine, Mitleid mit der anderen Seite ein (Quintilian IV, 1, 42), oder zumindest Wohlwollen für diese. Wegen der Schwere der Fälle will Quintilian hieraus eine eigene Gattung bilden; üblicherweise wird sie als besonders krasse Form dem „überraschenden“ Genus zugerechnet. Cicero wendet die von ihm empfohlene „Einschmeichelung“ bei einer causa turpis, der Verteidigung des angeblichen Vatermörders Sextus Roscius (oben III.7.), erfolgreich an: Von Beginn an wird, zunehmend überzeugend, die Gegenseite der Tat beschuldigt.
38
9. Die Vorliebe für Systematisierung setzt sich fort bei den Beweismitteln. Beweismittel, auch Mittel der Glaubhaftmachung oder Überzeugungsmittel genannt, ist (vom Erfolg her betrachtet) alles, was eine Tatsachenbehauptung als wahr oder zumindest als wahrscheinlich bzw. glaubwürdig ausweist, und ebenso, was das Urteil über die Tatsachen einleuchtend macht. Aristoteles nimmt hierzu eine Zweiteilung vor (die allerdings nichts mit der modernen erkenntnistheoretischen Trennung zwischen empirischen Aussagen und Werturteilen zu tun hat): Überzeugungsmittel sind entweder vorhanden, werden also nicht erst durch Rhetorik hergestellt (átechnoi písteis), oder sie können „durch methodische Anleitung und durch uns selbst geschaffen werden“ (éntechnoi písteis) (Aristoteles, Rhetorik I, 2, 2). Cicero (De oratore II, 116) und Quintilian (V, 1, 1) führen die Unterscheidung fort: sie habe „fast allgemeine Anerkennung erworben“.
39
(1) Fünf „atechnische“ Beweismittel, die „eigentümlich zur Gerichtsrede gehören“, nennt Aristoteles: „Gesetze, Zeugen, Verträge, Folter, Eide“ (Rhetorik I, 15, 1). Cicero erweitert diese Liste des genus inartificiale probationum: hierher gehöre alles, was „nicht vom Redner herausgefunden, sondern ihm vorgelegt wird“, also z.B. auch frühere richterliche Entscheidungen oder Rechtsgutachten (De oratore II, 116). Eindringlich warnt Quintilian vor einem offenbar nicht seltenen Missverständnis: Zwar ist dies alles „an sich“ vorhanden, gleichwohl könne man, „Mittel der Kunst einsetzen, um die Kraft solcher Dinge zu schwächen und zu brechen“ (Quintilian V, 1, 2). Oder im Gegenteil, um Potenzial des Vorhandenen zu entfalten: Gerichtsurteile (praeiudicia), die zu ähnlichen Fällen ergangen sind, taugen als Beispiele (exempla) und mithin als Stoff für „rhetorische Induktion“ (V, 11, 1 f.), das heißt „Übertragung“. Zeugenaussagen sind zum einen lenkbar durch Fragen, provozieren zum anderen einen Streit um die Glaubwürdigkeit des Zeugen (V, 7, 8). Gesetze und Urkunden schließlich präsentieren sich nur als Texte; der Redner hat sie auszulegen, die Auslegung prüft „Wortlaut und Absicht“ der Regelung und löst Widersprüche zwischen verschiedenen Regelungen auf (VII, 5, 5 f., VII, 6 und VII, 7). Die in der Aufzählung enthaltene Folter war für Quintilian (V, 4) eher ein Drohmittel, wo es auf unbedingte Wahrheit ankomme, doch überhaupt von zweifelhaftem Beweiswert.
40
(2) Der überschaubaren Sammlung vorgegebener Beweismittel steht eine Fülle dessen gegenüber, was die Rhetorik den Redner „innerhalb seiner Kunst“ zu suchen, zu (er)finden und anzuwenden lehrt. Aristoteles schafft eine erste (lückenhafte) Übersicht, indem er hierzu drei Gruppen bildet: Beweisführung aus dem Ethos, die „im Charakter des Redners“ begründet liegt; Glaubhaftmachung mit Hilfe des Pathos, das Hörer „in eine gewisse Stimmung versetzt“; schließlich Beweise durch den Logos, nämlich durch strikt angewendete, vor allem jedoch durch rhetorisch modifizierte logische Schlussverfahren (Rhetorik I, 2, 3 und 8). Cicero und Quintilian tragen auch diese Klassifizierung weiter; das Feld der „innertechnischen“ Beweismittel heißt bei ihnen genus artificiale probationum.
41
10. Die Beweismittel Ethos und Pathos:
(1) Warum das Ethos (übersetzbar mit „Charakter“, „Sinnesart“, „Sittlichkeit“) beweiskräftig sei, erklärt Aristoteles so: „Den Tugendhaften glauben wir lieber und schneller“; deshalb stütze „der sittliche Lebenswandel des Redners“ seine Glaubwürdigkeit (Rhetorik I, 2, 4). Charakterbildende Faktoren sind jedoch auch die „Art“ eines Menschen (z.B. Mann oder Greis) sowie die „Lebensweise“ (z.B. als Bauer oder im Kontrast dazu als Redenschreiber); wer seine Worte entsprechend den eigenen Lebensumständen wähle, sei glaubwürdiger als jemand, der (modern gesprochen) aus der Rolle falle (Rhetorik III, 7, 6 f.). Während Aristoteles bei solchen Empfehlungen den in eigener Sache auftretenden Redner im Blick hat, kommt es bei Cicero auf das Ethos mehrerer Prozessbeteiligter an: auf Eigenschaften der Partei und ihres Anwalts, aber auch, für die Suche nach Angriffspunkten, auf Ethos-Mängel der Gegenseite (Cicero, De oratore II, 182 ff.). Quintilian schließlich entwickelt einen anspruchsvollen Ehrencodex für Redner, der Legitimationsgrundlage ihrer Arbeit sein soll (Quintilian XII, 1 und 2; Sprute 1991, S. 281 ff.; Seel 1987, S. 74 ff., 88).
42
(2) Pathos soll den Redner unterstützen, indem es die Zuhörer „in Affekt versetzt“ (Aristoteles, Rhetorik I, 2, 5); Affekte sind „Regungen des Gemüts“ (wie Zorn, Mitleid, „gerechter Unwille“ etc.), die einen Menschen bei seinen Entscheidungen beeinflussen (Rhetorik II, 1, 8 f. und II, 2 bis 11). Die Lehre von den Affekten macht einen Kernbereich in Aristoteles’ Rhetorik aus (oben III. 5.). Nicht weniger Bedeutung misst Cicero diesem Gegenstück zur Redeweise des Ethos (De oratore II, 185) bei; er zeigt, mit wie viel Fingerspitzengefühl der Redner ans Werk gehen muss, um die Richterbank wie gewünscht zu disponieren (De oratore II, 186 ff.). Quintilian fasst Ethos (im für ihn engeren Sinn) als Beweismittel und Pathos als Handhabung der Affekte in einem Kapitel über Einteilung und Erregung von „Gefühlswirkungen“ zusammen (VI, 2). Wie unterschiedlich die beiden Instrumente einsetzbar sind, hatte Cicero anschaulich beschrieben: Das erste „ist angenehm und anziehend, dazu geschaffen, Wohlwollen zu erringen“; das andere „heftig, feurig, leidenschaftlich: es vermag dem Gegner alles aus der Hand zu schlagen“ (Orator 128). Dabei aber ist der Umgang gerade mit dem Pathos stets auch eine Frage der „Angemessenheit“, des Leitbegriffs für Stilisierung und Vortrag der Rede (unten 13.).
43
11. „Logos“ ist das Kennwort, unter dem die Rhetorik seit Aristoteles Anknüpfungen bei der „Dialektik“ (Logik) sucht, um logische Schlussverfahren in Dienst zu nehmen, ohne dass die Flexibilität praxisorientierter Prudentia darunter leiden müsste. Aristoteles übersetzt den Syllogismus und die Induktion in „rhetorische Schlüsse“.
44
(1) Der Syllogismus ist eine Verknüpfung aus Obersatz (ScP, Subjekt S enthält Prädikat P), Untersatz (XcS) und Schlusssatz (Also XcP). Sind jeweils zwei dieser Sätze gegeben, so folgt daraus zwingend der dritte. Der logisch-formale Mechanismus arbeitet inhaltlich beweiskräftig, wenn darin eingesetzte empirische Aussagen verifiziert und verwendete Werturteile unbestritten sind (dazu unten VI.3.(1)). Aristoteles nennt die rhetorische Parallele zum logischen Prozedieren „Enthymem“ (Rhetorik I, 2, 8). Da der Redner bei weitem nicht nur „notwendige“ (gesicherte) Voraussetzungen vorfinde, aus denen das angestrebte Ergebnis abzuleiten wäre, müsse er sich mit Schlüssen „aus der Wahrscheinlichkeit“ begnügen (Aristoteles, Rhetorik I, 2, 14 f.; II, 22 und 23; Wörner 1982, S. 73 ff.; Rapp, Kraus, van Zantwijk 2011). Prämissen, die wahrscheinlich oder glaubhaft sind, geben über die Bahn des Syllogismus etwas von ihrer Qualität weiter. Zugute kommt dem Redner, dass er sich an ein Stringenz vermittelndes Denkmuster hält. – Cicero behandelt die Schlussfolgerung unter dem Namen ratiocinatio (De inventione I, 67 ff.; Quintilian V, 10, 6). Der Schluss aus Ober- und Untersatz („Vordersätze“) kann auf dreierlei Weisen gezogen werden: durch erläuternde „Darstellung“, durch „einfache Schlussfolgerung“ (per simplicem conclusionem), also syllogistisch, oder durch „Zusammenfassung“ am Ende eines Beweises (Cicero, De inventione I, 44 f.). Die Beweisführung sei grundsätzlich fünfteilig, da bei den Vordersätzen der dazugehörige Beweis anzufügen sei; Ausnahme: ein solcher Satz stellt etwas unbestreitbar Notwendiges (nicht Widerlegbares) fest (De inventione I, 59 ff.). In der Schlussform sind, je nach Beweiswert der Prämissen, zwingende oder bloß glaubwürdige Ergebnisse erreichbar (De inventione I, 43 f.). Vom vollkommenen Redner erwartet Cicero, dass er auch das ganze Feld der dialektischen Methoden, also zwingenden Schlüsse beherrsche (Orator 115); ihm empfiehlt er, die Beweisführung mit einem umfassenden Syllogismus abzuschließen (Orator 137). – Für Quintilian (V, 10, 1-8) gehören logische wie rhetorische Schlüsse ganz selbstverständlich zu den „Beweisgründen“. Dabei erwähnt er leicht amüsiert terminologische Streitigkeiten: „Manche haben das Enthymem als rhetorischen Schluss bezeichnet, andere als einen unvollständigen Schluss (imperfectum syllogismum), weil dabei die Sätze nicht deutlich abgesetzt und auch nicht vollständig verwendet werden, was man ja freilich auch nicht unbedingt vom Redner verlangt“ (V, 10, 3).
45
(2) Zweite Parallele zu einer logischen Schlussweise ist die „rhetorische Induktion“ (Aristoteles, Rhetorik I, 2, 8; II, 20, 1 und 9). Ausgangspunkt ist ein „Paradigma“ – von den lateinischen Autoren exemplum – genanntes Beispiel, das jedoch nicht verallgemeinert wird, sondern als Modell zur Lösung eines aktuellen Falls dienen soll: ein Schluss von etwas Ähnlichem auf etwas Ähnliches (Rhetorik I, 2, 19). Der Adressat der Rede wird „irgendeine zweifelhafte Sache wegen der Ähnlichkeit zu den Dingen, denen er zustimmt, gutheißen“ (Cicero, De inventione I, 51). Die Ähnlichkeit zwischen zwei Ereignissen lässt sich aber nicht kurzerhand nutzen wie eine gegebene Formel. Cicero erklärt, dass durch Auswahl passender und anerkennungsfähiger Elemente eine Ähnlichkeit herzustellen sei (De inventione I, 54). Umgekehrt wird der Gegner „seine Zuflucht in irgendeinem ungleichen Punkt des Falles suchen“ (Quintilian V, 2, 3 und V, 11). Beispiel kann auch „ein ähnliches Recht“ sein; die Analogie sei keine eigenständige Art des Schließens (Quintilian V, 11, 32 ff.). – Von der Arbeit mit Beispielen ist der Indizienbeweis zu unterscheiden. Bei ihm, als Interpretation von „Anzeichen“, geht es um das Verhältnis zwischen Besonderem und Allgemeinem (Aristoteles, Rhetorik I, 2, 16). Indizien werden dem Redner „mit dem Fall selbst zugebracht“, er muss ihre Bedeutung erkennen (Quintilian V, 9, 1). Entweder sind sie „notwendiger Natur“: etwas, das zwangsläufig geschieht (eine Frau „gibt Milch“, also hat sie geboren) (Aristoteles, Rhetorik, I, 2, 17 f., Quintilian V, 9, 3 ff.). Oder das Anzeichen ist nicht zwingend, seine Deutung widerlegbar („er atmete rasch, also hatte er Fieber“), es taugt nicht als Beweismittel (Aristoteles, Rhetorik, I, 2, 18). Mehrere nicht zwingende Anzeichen können jedoch durch ihr darstellbares Zusammenwirken am Ende „die verdächtigen Umstände gewiss erscheinen“ lassen (Quintilian, V, 9, 8 ff.).
46
12. Das für die Praxis wichtigste Hilfsmittel bei der Beweisführung ist die Topik. Die Rolle, wenn nicht gar Lebensform des Rhetors verlangt, dass er ständig Begründungen sucht, die einer von ihm vertretenen Meinung zu Anerkennung und Erfolg verhelfen. Es genügt nicht, die Denkschritte des Logos oder die Kunst des angemessenen Pathos zu beherrschen, wenn die Inhalte der Rede ihre Sache schlecht treffen. Den Weg zu überzeugenden Beweisen, starken Argumenten weist die Topik.
47
(1) Die Topik beginnt – noch nicht unter diesem Namen, den Aristoteles ihr geben wird – als Sammlung von Lebensregeln (gnómai, Einzahl gnóme), auf die ein Redner sich für Beweiszwecke berufen kann (Anaximenes, Ars Rhetorika 38 und 48; Gast 2009, 1119). Aristoteles kennzeichnet die Gnome, in den Übersetzungen „Sentenz“ genannt, als allgemeine Aussage darüber, „was beim Handeln zu wählen oder zu meiden ist“ (Rhetorik II, 21, 2). Sie ist entweder bei den Zuhörern bekannt und akzeptiert (éndoxos); oder sie überrascht (parádoxos), lässt sich jedoch kurz und bündig begründen (Anaximenes, Ars Rhetorika 49 f.). Beide Arten sind im Enthymem als Prämissen verwendbar (Aristoteles, Rhetorik II, 20, 1). Die Sentenzen zählen zu den tópoi (Einzahl tópos, der Ort); im Fundus der Topik machen sie nur einen kleinen Anteil aus. Für Aristoteles sind Topoi „allgemeine Gesichtspunkte in Bezug auf Recht, Natur, Politik und vieles andere“; wir besitzen „über jede Art des Nützlichen und Notwendigen die allgemeinen Gesichtspunkte zur Ermöglichung der Beweisführung“ (Rhetorik I, 2, 21; II, 22, 16). Hiernach kann ein Topos zwar selbst etwas beweisen, wie etwa die Sentenz, vor allem aber soll er bei der Erschließung beweiskräftiger Sätze maßgeblich mitwirken. Einige hundert Topoi hatte Aristoteles in seiner früheren Schrift „Ta Topika“ zusammengetragen, ohne „Topos“ ausdrücklich zu definieren; sein Interesse war dort durch die grundsätzliche Fragestellung bestimmt, wie man „aus wahrscheinlichen Sätzen zu Schlussfolgerungen gelangen kann“ (Topika I, 1). In seiner „Rhetorik“ findet man unterschiedliche Materialsammlungen, teils mit methodologisch-formalen, teils mit inhaltlichen (ethischen, anthropologischen) Topoi; manche davon sind für alle drei Redegattungen (oben 3.) anwendbar, andere nur für eine Gattung. – Die lateinische Rhetorik übernimmt den Namen „Topica“, übersetzt topos wörtlich mit locus und nennt den Beweis argumentum. Cicero definiert die Topik als Verfahren, um Argumente „ohne jeden Irrweg planmäßig“ zu finden (Topica 2). Das Auffinden verborgener Dinge sei leicht, „wenn die Stelle (locus) gezeigt und bezeichnet ist“, wo sie sich verbergen; Argumente suche man also dort, wo sie „ihre Sitze (sedes)“ haben. Das Ziel der Anstrengung, das Argument, ist „ein Mittel, das einer strittigen Sache Glaubwürdigkeit verschafft“ (Cicero, Topica 7 f.). Die gleiche Beschreibung der Topik bietet Quintilian (V, 20, 10). Außerdem definiert er „Argument“ anschaulich durch Zweck und Verwendungsweise: Ein Argument ist „eine vernünftige Überlegung, die der Beweisführung Beweiskraft liefert, wodurch etwas durch etwas anderes erschlossen und etwas Zweifelhaftes durch etwas Unzweifelhaftes in seiner Gewissheit bestärkt wird“ (V, 10, 11).
48
(2) Umfangreiche, systematisch geordnete Topoi/Loci-Listen geben Cicero (Topica 11, passim) und Quintilian (V, 10, 20-99) an die Hand. – Zunächst erkunde der Redner Stellen „in dem Gegenstande selbst (in eo ipso), um den es geht“ (Cicero, Topica 8). Allem voran sind die in einen Fall verwickelten Personen Beweisquelle: Abstammung, Alter, Erziehung und Ausbildung, soziale Stellung, „Wesensart“, Beruf, Biografie etc. liefern argumenta a persona (Quintilian V, 10, 23 ff.); ebenso wirkt das Ethos (oben 10 (1)). Doch wie so viele Fakten sind auch diese Loci ambivalent: der Gegner kontert nach Möglichkeit mit Angriffen auf die Person, argumenta ad personam. – Nicht nur Eigenschaften, auch Tätigkeiten sind mit Personen verbunden; man gewinnt also Beweise „aus den Gründen geschehener oder auch künftiger Handlungen“ sowie aus Ort und Zeit (Quintilian V, 10, 32 ff., 36 ff., 42 ff.). – Der Streitstoff lenkt den Blick auf „Sachverhalte, die in einer gewissen Beziehung zum Gegenstand der Untersuchung stehen“ (Cicero, Topica 10 f.). So sorgt der Gesichtspunkt „Ähnlichkeit“ (argumentum a simile) für den Brückenschlag zu einem Beispiel (exemplum) oder für einen Analogieschluss (oben 11 (2); Cicero, Topica 41 f., 50 f.; Quintilian V, 10, 73 ff.). „Dem vorigen im höchsten Grade entgegengesetzt“ ist der Gesichtspunkt „Unterschied“ (differentia); wer Ähnliches findet, wird mit ebensolcher Denkanstrengung Unähnliches entdecken (Cicero, Topica 46; Quintilian V, 11, 13). Von hier ist es nur ein Schritt zum Umkehrschluss (argumentum e contrario) (Cicero, Topica 47). Die Arbeit mit Vergleichen kann aber noch ergiebiger sein: „Beisatz- oder Vergleichsbeweise (adposita vel comparativa) nennt man diejenigen, die Kleineres aus Größerem (minora ex maioribus), Größeres aus Kleinerem (maiora ex minoribus), Gleiches aus Gleichem (paria ex paribus) erweisen“ (Quintilian V, 10, 87 ff.; Cicero, Topica 68). – Ist der Streitstoff ausgeschöpft, wird der Redner Loci „von außen her (extrinsecus) heranziehen“ (Cicero, Topika 8). Empfohlen wird ihm, sich an alles zu halten, was „Autorität“ besitzt, also zum argumentum ex auctoritate führt (Cicero, Topica 24 und 72 f.; Quintilian I, 6, 42). – Jede Liste der Topoi/Loci hat ihr von Quintilian beklagtes Paradox: „einerseits zuviel zu lehren und andererseits doch nicht das Ganze“ (V, 10, 100). Gefordert bleibt daher immer die Kreativität des Redners für eigenständiges Suchen und Finden von Beweisen. Gleiches gilt für die Urteilskraft, die je nach Art der Untersuchung (Einzelfall oder allgemeine Streitfrage) oder nach Redesituation Missgriffe beim Auswählen der Beweismittel vermeidet (Cicero, Topica 79 ff.).
48
(3) Sind mit Hilfe der Topik Beweise angehäuft, bleibt das Problem ihrer optimalen Verwendung (Quintilian V, 12). Der Redner muss Gespür entwickeln, um die Qualität (Stärke oder Schwäche) eines Arguments zu erkennen, und den Mut, auf geringwertige oder gar zweischneidige Argumente zu verzichten (Cicero, De oratore 308 f.). Für die wirksame Reihenfolge innerhalb eines Argumentationsstranges gilt die Regel: An den Anfang gehört das wirksamste oder jedenfalls eines der stärksten Überzeugungsmittel; was „von mäßiger Bedeutung ist, wird man auf den sich drängenden Haufen in der Mitte werfen“; der Schluss bringt, abrundend und/oder zusammenfassend, abermals starke Argumente (Cicero, De oratore 314).
49
13. Dritter Baustein der Redelehre nach Inventio und Dispositio ist die Elocutio (oben 2.), die Lehre vom sprachlichen Ausdruck. Dass sie gleichberechtigt neben dem Auffinden, der Anordnung und dem Beweis von Aussagen zum Fundament der Rhetorik gehört, ist selbstverständlich: nicht, weil es um Sprachgebrauch überhaupt geht, sondern weil das Erscheinungsbild einer Sache auch davon abhängt, wie über sie gesprochen wird (Aristoteles, Rhetorik III, 1, 2). Der Redestil trägt dazu bei, die Sache „im rechten Licht“ erscheinen zu lassen; wobei die Pluralität von Sichtweisen philosophische (erkenntnistheoretische) Prämisse der Rhetorik ist. Die klassischen Lehrbücher widmen den Stilfragen breiten Raum. Aristoteles spricht im dritten Buch seiner „Rhetorik“ nahezu alle Gesichtspunkte der Stilistik an, die seine römischen Nachfolger systematisch ausbauen werden. Cicero erörtert im dritten Buch „De oratore“ den richtigen Wortgebrauch und schiebt mit „Orator“ eine Monografie zum Stil des Redners und der Rede nach. Quintilians Darstellung der Stilmittel (Buch VIII bis XI, 2 und XII, 10) ist umfangreicher als jene der Beweismittel. – Ziel ist die „Vollkommenheit des sprachlichen Ausdrucks“: er sei „deutlich“ und „weder niedrig noch über die Maßen erhaben, sondern angemessen“ (Aristoteles, Rhetorik III, 2, 1). Angemessen ist eine Formulierung, wenn sie „Affekt und Charakter ausdrückt und in der rechten Relation zu dem zugrunde liegenden Sachverhalt steht“; mit „Charakter“ ist die „rechte Relation“ zu bekannten Lebensumständen des Redners gemeint (Aristoteles, Rhetorik III, 7, 1 und 7). Die Forderung nach Angemessenheit (griechisch prépon, lateinisch aptum, decorum, proprietas) zieht sich als roter Faden durch die rhetorische Stilkunde. Cicero verwirft rednerisches Auseinanderreißen von Sache (res) und Wortbedeutung (verbum) (De oratore III, 19). Im „Orator“ bestimmt er die ganze Reichweite des Stilbegriffs: „Der Stil des Sprechens zeigt sich am Vortrag und am Sprachgebrauch (in agendo et in eloquendo)“; der Vortrag ist „körperliche Beredsamkeit“, insofern er auf Stimme und Bewegung sowie auf dem Erscheinungsbild des Redners beruht (Orator 54 f., 60 f.).Quintilian hält die Elocutio für den schwierigsten Teil in Theorie und Praxis der Rede (VIII, Vorrede, 13).
50
14. Aus dem Vorrat der Stilmittel – das sind Tropen (Formen der „Wortersetzung“, z.B. Metaphern), rhetorische Figuren („Satzumbau“), Rhythmus und sonstiger Wortschmuck (ornatus) – kann ein Redner sich je nach Wunsch und Fähigkeiten bedienen. Welcher Gebrauch den „vollkommenen“ Redestil ausmache, führt Cicero im „Orator“ anhand dreier Redearten (genera dicendi) bzw. dreier Rednertypen vor (Orator 20 f., 76 ff.). Typus 1 ist der „hochtönende“ Redner (grandiloqui), der mit dem „wuchtigen Bau seiner Sätze und der Würde seiner Worte“ wirken will. Typus 2 verkörpern „jene im Ausdruck schlichten und genauen Redner“, die allseitig informieren und alles einleuchtend darstellen. Typus 3 ist „eine in der Mitte zwischen diesen eingeschobene, gewissermaßen ausgeglichene Art“. – Auf ein rhetorisches Minimum setzt Typus 2, genannt der „attische“ Redner; er pflegt die Kunst der Kunstlosigkeit (Orator 76). Seine Rede ist frei von Rhythmus, schmucklos, an Metaphern enthält sie allenfalls die üblichen, der Ausdruck ist klar und deutlich und Angemessenheit geht allem anderen vor; nur „ein Salzkorn Humor“ erlaubt sich der Purist (Orator 77-79, 81, 85, 87). Auch der Redner des „mittleren Stils“ (Variante 3) lässt die Rede „ruhig und gelassen dahingleiten“, verschmäht jedoch schmückende Tropen und Figuren nicht, neigt zu gelehrter Breite; auf dem Forum wird er „von den Rednern des einfachen Stils verachtet, von denen des hohen abgelehnt“ (Orator 92-96). Schließlich der Redner des hohen Stils, wortreich, wortgewaltig, und hemmungslos im Gebrauch der Schmuckmittel: Cicero gesteht, dass er selbst in großen Staatssachen so aufgetreten sei, doch niemanden achten könne, der einzig die Großartigkeit beherrsche (Orator 97-102). Mitunter gelte es, die „Stile zu mischen und abzuwechseln“ (Orator 103). Wie Demosthenes es tat, den Cicero als vollkommenen Redner herausstellt, wobei er sich in seiner Selbstwahrnehmung beschreibt: ein Redner, „der auf dem Forum und in Zivilprozessen so spricht, dass er beweist, unterhält, beeinflusst (ut probet, ut delectet, ut flecat). Beweisen ist Sache der Notwendigkeit, ... Beeinflussen aber bedeutet den Sieg“ (Orator 23, 69).
V. Wiederkehr der Rhetorik als Rhetorische Rechtstheorie
51
1. Seit den 1950er Jahren gewinnt die Rhetorik in den Geisteswissenschaften wieder an Boden. Ein starker Impuls hierzu ging aus von der in Brüssel wissenschaftlich beheimateten „Nouvelle Rhétorique“ (Perelman / Olbrechts-Tyteca, 1958; 3. Auflage 1976). Für die Philosophie, deren „sprachliches Wesen“ oft und wider alle Realität geleugnet werde, stellt Th. W. Adorno fest: „Rhetorik vertritt in Philosophie, was anders als in der Sprache nicht gedacht werden kann“ (Adorno 1966, S. 63 f.); inzwischen ist dies dort kein Außenseiterstandpunkt mehr (dazu Rhetorik Jahrbuch 1999). Perelman betont auch die enge Verbindung zwischen Rhetorik und Jurisprudenz (Perelman 1979 und 1980).
52
2. „Rhetorische Rechtstheorie“ steht für den von Th. Viehweg inspirierten, seit den 1960er Jahren vorangetriebenen Versuch, Rechtspraxis, Rechtslehre („Dogmatik“), Rechtsphilosophie und zu allererst die juristische Methodik auf ihre rhetorische Basis zurückzuführen (Schlieffen 2007, 197 f.); womit weniger die historische Rekonstruktion gemeint ist, als vielmehr eine Restitution in der angestammten Wirklichkeit.
53
(1) Die als Programmschrift wirkende Abhandlung „Topik und Jurisprudenz“ (1953; 1974) nennt drei Säulen, auf die Viehweg sein systemkritisches Konzept stützt. Es geht aus vom Gegensatz zwischen „Problemdenken“ und „Systemdenken“ (Viehweg 1974, S. 31-34). Schlüsselkategorie für rhetorisch orientiertes Rechtsverständnis ist „das Problem“, zu definieren als „Frage, die anscheinend mehr als eine Antwort zulässt“. Vorausgesetzt ist dabei so viel einschlägiges Vorverständnis für eine Situation, dass etwas an ihr fragwürdig scheint und eine Antwort verlangt. Für die Suche nach der Lösung sei „das Problem selbst als vorgegeben und stets führend anzunehmen“ (1974, S. 32). Wollte man nun die Lösung einem System mit feststehenden Begriffen und Ableitungszusammenhängen übertragen, so wäre vorentschieden, ob das Problem überhaupt als solches aufgefasst und zur Lösung angenommen würde, oder ob es als Scheinproblem abzuweisen wäre (1974, S. 33) – während das dem Recht immanente non-liquet-Verbot (Ballweg 1970, S. 109) solche Arbeitsverweigerung ausschließt. Voraussetzungen, unter denen eine Antwort gewährleistet ist, kommen mit Viehwegs zweitem Schlüsselbegriff zur Sprache; sie werden, statt durch ein logisch-szientifisch strukturiertes System, von einer wirklichkeitsorientierten Jurisprudenz erfüllt (Viehweg 1974, S. 87 ff.). Deren hauptsächliches Arbeitsmittel ist, zum dritten, die Topik (1974, S. 88 ff.). Sie stellt „Gesichtspunkte“ (Aristoteles, oben IV.12.(1)) bereit, von denen ausgehend ein Problem diskursiv, unter Abwägung zwischen gegeneinander stehenden Argumenten, gelöst werden kann. Viehweg legt Wert darauf, dass Topik als Feld rhetorischer Beweisführung nicht etwa „unsystematisch“ im Sinn von beliebig bis chaotisch sei. Bei der juristischen Arbeit ist „systematische Einheit im Rechtsbereich im großen und ganzen antizipiert“ (1974, S. 87), d. h. sowohl vorausgesetzt als auch angestrebt (1974, S. 34). Eine Art latentes System also; oder fassbarer beschrieben: Es handelt sich um den Rahmen, aus dem der professionell agierende Jurist, von Judiz gelenkt, nicht herausfallen will.
54
(2) Die Merkmale von Jurisprudenz (und Prudenz überhaupt) hat O. Ballweg im Kontext moderner Handlungstheorien untersucht. Wesentlich für Prudentien ist, dass sie „mittels außer Frage gestellter Meinungsgefüge (Dogmatiken) in unterschiedlichen Situationen, unter veränderlichen Perspektiven und wechselnden sozialen Bedingungen, in beweglichen Wertbereichen die Entscheidbarkeit von Problemen gewährleisten“ (Ballweg 1970, S. 72). Die wechselseitigen Beziehungen zwischen den „Teilsystemen“ soziale Wirklichkeit, Rechtswirklichkeit, juristische Praxis und Rechtslehre setzen, um stabil und flexibel zu sein, eine „Offenheit“ voraus, wie die Topik sie garantiere, ohne dem Dezisionismus Spielraum zu eröffnen (Ballweg 1970, S. 100-132). Damit ist implizit gesagt, dass ein solches Ziel bei geschlossenem axiomatisiertem Deduktivsystem (S. 117) erst durch Inkonsequenz erreicht werde. G. Struck hat in seiner Untersuchung zur Topik (1971, S. 64-70) Beispiele und sogar Strategien solcher Inkonsequenz vorgeführt.
55
(3) Zur Topik hat Struck eine „Studie“ erstellt, die nicht auf die klassische Rhetorik zurückgreift (von dort aber Vorverständnis mitbringt), sondern auf Material aus Rechtspraxis und Methodenlehre vorwiegend der 1960er Jahre. Aus diesem Stoff, zumal aus dem darin manifestierten Sprachgebrauch, entwickelt der Autor Definition und Strukturmerkmale der Topoi. Ein Topos ist hiernach ein „Standardargument“ (Struck 1971, S. 18 f., 20) und gekennzeichnet durch folgende Eigenschaften: Er ist überzeugend (wohl, weil er einen Schimmer von Vernünftigkeit und Gerechtigkeit ausstrahlt); dies umso mehr, je abstrakter er formuliert ist (S. 38 f.). Er besitzt durch Wirkungsgeschichte belegtes und noch immer andauerndes „Durchsetzungsvermögen“ (S. 39 ff.). Er hat so viel Vagheit, dass es möglich bleibt, Ausnahmen und Abweichungen von seiner Maxime zu begründen (S. 46 f.). Ihn zeichnet argumentative Brauchbarkeit aus, dank welcher er „den Durchgriff durch den Schleier tendenziöser Begriffsbildungen erlaubt“ (S. 58). Im Verhältnis der Topoi zueinander gibt es keine Hierarchien, wohl aber „gegenseitige Durchdringung“ (S. 55). Als Ertrag des kritisch-analytischen Teils seiner Studie bietet Struck einen Leitfaden (kein Schema) zur Problemstellung und Problemlösung bei der Fallbearbeitung an (S. 76-103).
56
(4) Schon früh geht das Interesse der Rhetorischen Rechtstheorie an der Nutzbarkeit und den Gebrauchsweisen von Sprache weiter und tiefer, als es der klassischen Elocutio genügte (oben IV. 13.). Herangezogen wird dabei die moderne Semiotik, die ein Modell zur Analyse des Sprachmaterials (Syntaktik und Semantik), der Sprechgewohnheiten und der Sprechsituationen (Pragmatik) liefert. W. Schreckenberger, „Juristische Semiotik“ (1978), hat durch semiotische Analysen zu Art. 1 und 2 Grundgesetz sowie zu Argumentationen des Bundesverfassungsgerichts Beispiele topologischer Verfassungsanwendung entdeckt. Syntaktische Mängel und semantische Widersprüche in extrem abstrakt formulierten Rechtsgrundlagen (Schreckenberger 1978, z.B. S. 97 f., 105, 131 f.) führen dazu, dass auf der pragmatischen Ebene die (hermeneutisch nicht erreichbare) Falllösung mit Hilfe eines breit gefächerten „Topoirepertoires“ (S. 317 ff., 365 ff.) erfolgt; eine Arbeitsweise, die in den richterlichen Begründungen zwar nicht benannt, aber praktiziert wird. – Semiotische Pragmatik, die bei der jeweiligen Situation der Sprachverwendung anknüpft und Entscheidungswirklichkeit analysiert, wird dargestellt von H. Rodingen (1977). – Th.-M. Seibert hat, als wissenschaftlich reflektierender Semiotiker und Berufsrichter, in „Aktenanalyse“, 1981, und „Zeichen, Prozesse“, 1996, Prolegomena oder, um im Metier zu bleiben, Topoi für ein virtuelles Lehrbuch „Semiotik des Rechts“ gesammelt (1996, S. 7).
57
(5) Die Protagonisten der Rhetorischen Rechtstheorie begreifen ihre wissenschaftliche Arbeit primär als juristische Grundlagenforschung, darüber hinaus jeweils verschieden ausgeprägt als methodologische Angebote an Rechtsdogmatik und Praxis. Ähnlich unterschiedlich ist das Verhältnis zur klassischen Rhetorik; manchem gilt sie als nicht zu verlassende Basis, während andere weniger auf eine Renaissance als vielmehr auf Modernisierung eingestellt sind. In den Forschungen von K. Sobota, nunmehr Gräfin von Schlieffen, liefern klassische Kategorien den Maßstab für Untersuchungen zur juristischen Methodenlehre und Rechtspraxis. Ausgangspunkt ist das Raster, das die aristotelische Trias „Ethos, Logos, Pathos“ zur Verfügung stellt (Sobota, Rhetorik Jahrbuch 1996, S. 120 ff.). Ein Leitbegriff in Selbstverständnis und Fachstil der Juristen, „Sachlichkeit“, zerfällt bei rhetorischer Analyse in eine Palette von Logos- und Pathosmomenten (Sobota 1990). Aus dem Gebiet des Logos stammt zumal der Syllogismus, der sich im fachlichen Gebrauch zu den Varianten des Enthymems auflöst (Sobota 1990, S. 47-80 und 91-100; Schlieffen, Rechtstheorie 2011, S. 601 ff.). Zum Pathos darf man die Versuche zählen, aus erkenntnistheoretisch längst unhaltbaren Ontologien (exemplarisch: Naturrechtslehren) gleichsam eine Rückversicherung im „Wesen“ des Rechts herzuleiten (Sobota 1990, S. 123-143). Vom rhetorischen Reichtum aktueller Rechtspraxis künden Gerichtsentscheidungen als Fundgruben für Tropen, Figuren und andere Stilmittel affektiver Kommunikation (Schlieffen 2006, S. 49-62, und 2005, S. 405-448; Sobota, Rhetorik Jahrbuch 1996, S. 122 ff.). Nicht überraschend ist hierbei das immer wieder bestätigte reziproke Verhältnis zwischen Logos und Pathos: Je mehr Logos, nämlich plausible Argumentation zur Sache, um so weniger Pathos; und umgekehrt.
58
3. Im Jahr 1982 erschien ein Sammelband „Rhetorische Rechtstheorie“ (Ballweg / Seibert 1982), der einen thematisch breit gefächerten Diskussionsstand belegt und 18 Angehörige oder Freunde der „Mainzer Schule“ (dazu Schlieffen 2007, 198, 201) vorstellt. Im methodologischen Diskurs der Rechtswissenschaft war „Rhetorik“ inzwischen zum Reizwort aufgestiegen und die Rhetorische Rechtstheorie in der Position des Feindbildes etabliert. Die Polemik gegen Viehwegs Schule und Rhetorik überhaupt (dargestellt bei Weirauch 2005, S. 21 ff.) kann an Platons Umgang mit den Sophisten erinnern, und auch an Ciceros Bemerkung mit Blick auf „Gorgias“, bei diesem Buch bewundere er Platon „am meisten darin, dass er, während er die Redner verspottete, selbst der bedeutendste Redner zu sein schien“ (De oratore I, 47). Weil zum Wissenschaftsbetrieb auch Machtverhältnisse gehören, erwies sich zumindest für zwei Generationen der „Mainzer Schule“ die eigene Wissenschaft als „Karrieregift“ (Schlieffen 2006, S. 43). – Die Lage hat sich dahin verändert, dass man von einer gewissen Koexistenz zwischen den Parteien sprechen kann, die Ballweg in seinem als Alternative zu lesenden Buchtitel „Rechtswissenschaft und Jurisprudenz“ einander gegenüberstellte. Allerdings ist „Hauptströmung“ noch jene, die sich von der Rhetorik abgrenzt, wenn nicht distanziert. (Zu „Haupt- und Gegenströmungen“ in der juristischen Methodik Krawietz 2011.) Zwar findet sich in wohl jeder juristischen Methodik heute der Gemeinplatz von der „Begründung durch Argumentation“; aber ein durchaus platonischer Glaube, es seien die logischen und hermeneutischen Elemente, die den juristischen Arbeitsweisen eine Gewähr für richtige Inhalte geben würden, behauptet sich weithin gegen die „bloß formale“, im Grunde also „beliebige“ Topik. – Viehweg und Ballweg haben Implikationen und Aspekte der Rhetorischen Rechtstheorie in vielen Beiträgen weiterentwickelt (Viehweg, Kleine Schriften 1995; Ballweg 2009).
VI. Rhetorik in der aktuellen juristischen Methodenlehre
59
1. Auf den Status quo gesehen, hat die Rhetorik ihren Anteil an der Methodenlehre, und zwar in der Juristenausbildung wie in der präsenten Methodenliteratur; auf nicht so offenkundige Weise besteht er auch am herrschenden Methodenkanon (unten 3.). – Zum Jurastudium gehört seit dem 1. Juli 2003 kraft Gesetzes (Deutsches Richtergesetz und Ausbildungs-/Prüfungsordnungen der Bundesländer) der Erwerb von „Schlüsselqualifikationen“, wozu die Rhetorik zählt. In der Studienrealität sind Schulungs- und Übungsplattformen wie der „Debating Club“ und der „Moot Court“ anzutreffen. (Über Rhetorik als Schlüsselqualifikation: Schlieffen, in: Römermann / Paulus 2003, S. 192 ff.; Soudry 2006; Brinktrine / Schneider 2008; Ponschab / Schweizer 2008. Zum Moot Court: Griebel / Sabanogullari 2011. Zur Bedeutung von Erfahrungen mit Rhetorik und Moot Court für die Lösung von Klausurfällen: Falk / Schneider 2012, S. VI f.) – Die Geschichte neuer Lehrbücher mit dem (Haupt-)Titel „Juristische Rhetorik“ eröffnet 1978 F. Haft (8. Auflage 2009); ihm folgt 1988 W. Gast (4. Auflage 2006). Zum Nutzen solcher Werke: Grasnick 1990, 483 ff.; Hilgendorf 1993, S. 23 ff. und 1995, S. 40 ff.; Simon 2008, S. 15 ff. – Den beiden „fast ausschließlich analytisch-theoretisch“ zugeschnittenen Lehrbüchern stellt T. Walter eine praktische „Kleine Rhetorikschule“ (2009) zur Seite. Eine Übersicht zum Meinungsspektrum in der juristischen Rhetorik gibt C. Weirauch 2005. – Zur Umsetzung des klassischen Musters „Gerichtsrede“: Th.-M. Seibert 2004.
60
2. Die beiden genannten Lehrbücher zur „Juristischen Rhetorik“ sind einig in dem Ziel, die Arbeit der Falllösung transparenter zu machen, als die dabei gewöhnlich zitierten Methoden (des 19. Jahrhunderts; Haft 2009, S. 10) es tun. Den jeweils eigenen Ausgangspunkt nehmen sie jedoch in unterschiedlichen Segmenten des rhetorischen Logos.
61
(1) Haft sucht eine Methode, die „der ursprünglichen Fallbezogenheit des Rechts gerecht (wird)“ (2009, S. 13); er findet sie, ohne ausdrücklichen Rückgriff, in der rhetorischen Induktion, also im Schluss von Ähnlichem auf Ähnliches (oben IV.11.(2)) Eine „Vergleichsfalltechnik“ hilft, den jeweils problematischen Fall zu entscheiden (S. 89). Dies geschieht allerdings nicht kurzerhand mit Blick auf den nächstliegenden Präzedenzfall, sondern durch eine „bewusst geübte Extremfalltechnik“. Der Problemfall steht in einem Spannungsfeld, worin er „eindeutigen Fällen“ zunehmender wie abnehmender Nähe zu ihm konfrontiert ist; die Entscheidung fällt „nach Maßgabe der größeren Fallähnlichkeit“ (S.89). Möglich ist diese Operation nur vor dem Hintergrund eines begrifflichen Gerüsts, das einerseits Erscheinungen des Problemfalls erfassen lässt, andererseits das gesamte Vergleichsmaterial durchzieht. Erster Schritt ist deshalb die Herausarbeitung falleigener „Strukturen“ (S. 41 ff.), die mit Hilfe von Definitionen (S. 63 ff.) auf Begriffe gebracht werden („Begriffsentfaltungslehre“, S. 69 ff.). Das Material stammt aus einschlägiger Rechtsprechung und Rechtsdogmatik; es wurde seinerseits und wird nun aktuell problembezogen aufbereitet durch Argumentieren (S. 93 ff.). Der Entfaltung von Begriffen schließt sich die „Begriffsverwendung“ (S. 87 ff., Ablaufschema S. 92 f.) an, also die letzten entscheidenden Schritte zur Lösung des Problemfalls. Beteiligte Gesetze sind weder Ausgangspunkt der Falllösung, noch ist ihr definitiver Sinn durch Auslegung erschließbar (S. 9 f., 159 ff.); der Gesetzestext ist vielmehr Projektionsfläche für vertretbares Wortverständnis.
62
(2) Gast hält am Prinzip der Subsumtion („die Unterordnung eines Besonderen unter ein Allgemeines“) fest; er begreift sie als „zentralen Topos der Jurisprudenz“ (2012, S. 186 f.). Doch nicht ihre logische Spielart ist gemeint, sondern, nach aristotelischem Vorbild, eine rhetorische Variante. Das logische Muster ist rhetorisch aufgelöst in ein Kommunikationsmodell aus sechs Elementen (2006a, Rz. 58-94; 2006b, S. 32-41). – Dies sind: 1. der Rhetor und 2. sein Adressat, die notwendig aufeinander bezogenen Akteure. Der Rhetor wirbt (z.B. als Fachautor) für eine Meinung, strebt (als Prozessvertreter) eine bestimmte Entscheidung an. Er sucht das Einverständnis des (oder mit dem) Adressaten, weil dieser als Autorität eine Meinung gut oder schlecht heißen kann oder für die Entscheidung zuständig ist. Der Rhetor ist sachverständig, mit jener Perspektive auf die Sache, die er beim Adressaten voraussetzt; anfängliche Divergenzen muss er zu überwinden versuchen. Adressat kann ein einzelner sein, eine Gruppe (Kollegialgericht) oder die ganze Fachgemeinschaft. – Sodann 3. eine These, und 4. Prämissen zur Sache, um die es Rechtsstreit gibt. These ist, was der Rhetor durchzusetzen versucht und so darstellt, dass es plausibel („des Beifalls fähig“) den Adressaten erreicht. Dieser ist gleichsam Hüter der Prämissen; aus der Fülle seiner Sachkenntnisse und Sachvorstellungen wird angesprochen, was der These entgegenkommt, doch möglicherweise auch, was sich ihr widersetzt. Prämisseninhalte können durch individuelles Vorverständnis eingefärbt sein, bestehen aber aus dem Rechtsstoff, den „man“ von Berufs wegen zu berücksichtigen hat. These ist jene Dimension im Vortrag des Rhetors, die nicht von vornherein im Einverständnis steht. Prämisse ist, was im Einverständnis steht; fehlende Prämissen muss der Rhetor argumentierend „begründen“, das heißt herstellen. – 5. die Subsumtion. Sie ist das Verfahren, um für eine These Einverständnis anzustreben. Strittiges sucht Anschluss an, Einpassung in eine fraglose Meinung, um aus ihr Anerkennung zu beziehen. Die Mittel, die der Rhetor dazu einsetzt, findet er im Fundus der Methodenlehre, hier also: der juristischen Rhetorik. Einverständnis bedeutet nicht, dass der Adressat überzeugt sein müsste; es genügt, dass er sich aus pragmatischen Gründen für eine Lösung entscheidet (der Richter denkt prozessökonomisch und urteilt gemäß herrschender Meinung, die er für falsch hält). – 6. die rhetorische Situation. Überall kann ein Rhetor auftreten, nur nicht im leeren Raum. Er agiert eingebunden in mitwirkende Umstände. Welchen Rollenerwartungen sind die Beteiligten ausgesetzt? Was „sich gehört“, was „zu beachten“ ist, wirkt ebenso mit wie typische berufliche Zwänge, etwa: Justiz als Bürokratie und das Gericht als Lebenswelt des Personals (2006a, Rz. 472 ff.) Die Situation erzeugt Doppelrollen: Der Richter ist Adressat des Rechtsanwalts, aber (vorsorglich) Rhetor gegenüber der nächsten Instanz.
63
3. Unter dem Namen „Logos“ hat die Rhetorik ihre aus der Logik entnommenen oder inspirierten Beweisverfahren versammelt (oben IV.11.). Vieles davon ist jedoch auch im herrschenden Methodenkanon (den „Hauptströmungen“ der juristischen Methodik; Krawietz 2011) enthalten.
64
(1) Als sicherster Beweis gilt in jeder Methodologie der logische Schluss; wobei juristisch die „traditionelle“ Logik verwendet wird, also alle Figuren und Modi des Syllogismus (Schneider / Schnapp 2006, S. 115 ff.; Gast 2006a, Rz. 909-1039; Larenz 1991, S. 271 ff.). Beweisbar ist mit ihrer Hilfe aber nur ein einziges, formales Moment, nämlich dass Sätze folgerichtig (ohne formalen Widerspruch) miteinander verbunden sind. Für die beteiligten Sätze sind einige formale Eigenschaften vorgeschrieben (Aufbau als Urteil: ScP; eindeutig definierte Ausdrücke; festgelegte Wertigkeit: positiv oder negativ; festgelegte Quantität: singuläre, universale oder partikuläre Aussage). Die inhaltliche Seite – also das, worauf es rechtlich ankommt – ist der Logik gleichgültig. Über Inhalte und ihren erkenntnistheoretischen Status (empirisch wahr bzw. sachlich richtig, oder falsch oder unbewiesen) wird außerlogisch entschieden. Darum kann die logische Conclusio sachlich unvertretbar und mit Argumenten widerlegbar sein.
65
(2) Vom Enthymem redet bisher nur die Rhetorik, neuerdings auch die nichtrhetorische Rechtstheorie (Beiträge in: Schlieffen (Hg.), Rechtstheorie 2011; D. Simon 2011). Unter diese Bezeichnung fallen alle Beweisversuche, die zwar nach Form und/oder Redeweise als logischer Schluss auftreten, jedoch nicht die formalen Bedingungen hierfür erfüllen. Die logische Hülle leiht ihnen eine gewisse Eindringlichkeit und kann die Plausibilität steigern, solange nicht der präsentierte Inhalt zu fern vom Sachverständnis des Adressaten liegt. Insofern gilt der Primat des Inhaltlichen ebenso wie gegenüber richtigen Schlüssen. Tatsächlich machen Enthymeme ein verbreitetes „Modell juridischen Begründens“ aus (Schlieffen 2011, S. 601 ff.).
66
(3) Der Umkehrschluss, rhetorisch argumentum e contrario (oben IV.12.(2)) gehört zu den logisch beweiskräftigen Schlussformen der herrschenden Methodenlehre (Schneider / Schnapp 2006, S. 155 ff.). Er setzt jedoch eine bestimmte Struktur des umzukehrenden Satzes voraus. Sind dort Tatbestand und Rechtsfolge durch Äquivalenz verbunden („immer und nur wenn T, dann R“), so gilt: Nicht T, also nicht R. Gleiche Stringenz ergibt sich bei der Replikation („nur wenn T, dann R“). Die Mehrzahl der Rechtssätze ist dagegen als Implikation angelegt („immer wenn T, dann R“): noch ein Angebot an den Rhetor, ein Enthymem zu versuchen. Nach Larenz (1991, S. 391) entscheidet darüber, ob ein Umkehrschluss erlaubt sei, ohnehin immer die „ratio legis“.
67
(4) Die Analogie, argumentum a simile, der Schluss von Ähnlichem auf Ähnliches, ist eine rhetorische Induktion, die nicht formal beweiskräftig, nur durch die Auswahl der Ähnlichkeitsmomente begründbar ist (oben IV.11.(2)). Wiederum ein oft genutztes rhetorisches Beweismittel im Methodenkanon (Larenz 1991, S. 381 ff.) der „Hauptströmung“. – Die leidige Konkurrenz zwischen Umkehrschluss und Analogie lässt sich nicht prinzipiell, nur fallweise durch Topoi (gleichgültig, ob so benannt oder nicht) lösen.
68
(5) Zum Arsenal des Logos darf man den Vierer-Kanon der Gesetzesauslegung rechnen, da er nach herrschender Meinung den wahren Inhalt des Gesetzes erschließe. Die Auslegung nach Wortlaut, Zusammenhang, Geschichte und Zweck scheint mit logikähnlicher Stringenz zum richtigen Ergebnis zu führen (Larenz 1991, S. 312 ff.) Die klassische Rhetorik bietet keinen methodologischen Vorläufer hierzu an, doch die Wortbedeutung (etymologia; Cicero übersetzt: veriloquium, „Wahraussage“) wird als ergiebiger Topos empfohlen (Cicero, Topica 35), und Quintilian unterscheidet zwischen Auslegung nach Wortlaut und nach Absicht (aut in scripto aut in voluntate). Der Vierer-Kanon allerdings hat eine unüberwindliche Schwäche: Durch ihn ist folgerichtig, ohne Denk- oder Methodenfehler, zu jeder Auslegung auch das Gegenteil begründbar. Am Demonstrationsfall lässt sich zeigen, wie schon durch minimale Variationen im Begründungsablauf das Resultat A so gut wie Non-A erreicht wird (Gast 2006a, Rz. 678-702). In der Praxis demonstriert jeder Rechtsstreit, in dem zwei Instanzen zu unterschiedlichen Auslegungsergebnissen gelangen, die Ambivalenz der Methode (Gast 2012, S. 188 ff). Dass am Ende ein Ergebnis verbindlich feststeht und gern als „das richtige“ bezeichnet wird, dafür sorgt nicht der Vierer-Kanon, sondern das Prozessrecht. Der Kanon hält vier Topoi bereit und dazu ein übersichtliches Darstellungsschema für die Argumentation. Er ist in so hohem Maß anerkannt, dass man ihn zur rhetorischen Grundausstattung des Juristen zählen und seinen Einsatz als rhetorisch notwendig empfehlen muss.
69
(6) Ein Fazit zu dieser Übersicht: Was den dargestellten Methoden herkömmlich als „Richtigkeitsgewähr“ zugeschrieben wird, erweist sich in der methodenkritischen Analyse als Kraft der Plausibilität, die den jeweils verwendeten Sachaussagen innewohnt. Das ist auch verständlich, da Jurisprudenz seit jeher rechtliche Inhalte höher einschätzt als die zur Inhaltsvermittlung dienenden Formen.
70
4. Zwischen Logos und Pathos schwanken Charakter und Gebrauch eines Topos, der zum rhetorischen Urgestein gehört: der Autoritätsbeweis, argumentum ex auctoritate (oben IV.12.(2)). Allgemein wird unterschieden zwischen individueller qualitativer Autorität einer namentlich zu nennenden Person und anonymer quantitativer Autorität, genannt „herrschende Meinung“, „herrschende Lehre“, „ständige Rechtsprechung“ (Gast 2006a, Rz. 382, 424- 446). Struck (1971, S. 89 ff.) hat wohl alles zusammengestellt, und es ist nicht wenig, was gegen diesen Beweistopos spricht. Ballweg hingegen plädiert für die „Aussageautorität der gelehrten Dogmatiker bei der Auswahl neuer Doktrinen und ihrer Kanonisierung als ‚herrschende Lehre’“. Der Grund: Der Entscheidungszwang in der Praxis droht die „Werthaltigkeit“ des Rechts zu verdrängen, zugunsten einfacher Handhabbarkeit (Ballweg 1970, S. 112 f. und 1982, S. 48 f.). Haft (2009, S. 118 f.) hat Regeln für „faire Autoritätsverwendung“ aufgestellt.
71
5. Recht und Jurisprudenz sind in einem Grad sprachgebunden und sprachabhängig, dass eine fachspezifische Stilkunde (Elocutio; oben IV.13) unvermeidlich ist. Zumal es sich beim „Juristischen“ nicht um eine logisch strukturierte, möglichst interpretationsfreie Wissenschaftssprache handelt, sondern um eine fachsprachlich angereicherte Alltagssprache (Schreckenberger 1978, S. 41 ff., 76 f., 114 ff. und öfter; Ballweg 1982, S. 57 ff.). Der fachliche Sprachanteil wird im Studium vermittelt (dazu Seibert 1977), ist reich an spezifischen Metaphern (Gast 2006a, Rz. 1156-1176) und dient als Ausweis für Zugehörigkeit zur Berufsgruppe, zugleich als Indiz für Sachbeherrschung. Neben milieubildenden Wirkungen hat die Juristen- oder Rechtssprache eine rhetorische Funktion: Sie soll dazu beitragen, den Geltungsanspruch des Rechts durchzusetzen. Zur juristisch-rhetorischen Stilistik (Lerch (Hg.) 2005; Schlieffen 2005, S. 405-448; Gast 2006a, Rz. 1229-1259) einige Beispiele: Rechtstexte pflegen den Nominalstil; das Substantiv verdinglicht (ontologisiert), lässt als vorgegeben erscheinen, was nur in Meinungen existiert. Auffällig ist sodann der Gebrauch des Passiv; die Passivform entlastet, weist nicht auf ein handelndes, gar verantwortliches Subjekt hin, sondern auf Zwangsläufigkeit. Während Nominalstil und Passiv jedoch die Autorität einer Sache vorschieben, sind massenhaft gebrauchte, autoritäre Floskeln nur sachleere Versatzstücke: ... zu berücksichtigen ist... mit Nachdruck ist darauf hinzuweisen, dass... keiner weiteren Begründung bedarf... unerträglich wäre..., usw. Der Stil („Emphase“) verrät jedenfalls in schriftlichen Begründungen, dass einem Rhetor zur Sache zu wenig eingefallen ist.
VII. Bibliographie
Adorno, Th. W., Negative Dialektik, Frankfurt a.M. 1966.
Anaximenes, Ars Rhetorica, quae vulgo fertur „Aristoteles ad Alexandrum“, ed. M. Fuhrmann, 2. Auflage, Lipsiae 2000.
Rhetorik an Alexander, in: Aristoteles, Die Lehrschriften, übertragen von P. Gohlke, Bd.3.3, Paderborn 1959.
Antiphon: Antiphontis Tetralogiae, herausgegeben und (ins Italienische) übersetzt von F. D. Caizzi, Milano 1969.
Aristoteles, Rhetorik, übersetzt und erläutert von F.G. Sieveke, 5. Auflage, München 1995.
Aristoteles, Topik, übersetzt und erläutert von T. Wagner und Ch. Rapp, Stuttgart 2004.
Auctor ad Herennium (oder: Rhetorica ad Herennium), Lateinisch/Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Th. Nüßlein, 2. Auflage, München (u.a.) 1998.
Ballweg, O., Rechtswissenschaft und Jurisprudenz, Basel 1970.
Ballweg, O., Analytische Rhetorik, Rhetorik, Recht und Philosophie, herausgegeben von K. Gräfin von Schlieffen, Frankfurt a.M. (u.a.) 2009.
Ballweg, O. / Seibert, Th. M. (Hg.), Rhetorische Rechtstheorie, Freiburg 1982.
Barner, W., Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen, Tübingen 1970.
Brinktrine, R. / Schneider, H., Juristische Schlüsselqualifikationen. Einsatzbereiche, Examensrelevanz, Examenstraining, Berlin und Heidelberg, 2008.
Capelle, W., Die Vorsokratiker, 9. Auflage, Stuttgart 2008.
M. Tullius Cicero, De inventione. Über die Auffindung des Stoffes, Lateinisch/Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Th. Nüßlein, Düsseldorf/Zürich, 1998.
M. Tullius Cicero, De oratore. Über den Redner, Lateinisch/Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Th. Nüßlein, Düsseldorf, 2007.
M. Tullius Cicero, Brutus, Lateinisch/Deutsch, herausgegeben und übersetzt von B. Kytzler, 4. Auflage, München 1990.
M. Tullius Cicero, Orator, Lateinisch/Deutsch, herausgegeben und übersetzt von B. Kytzler, Darmstadt, 3. Auflage 1988.
M. Tullius Cicero, Topica. Die Kunst, richtig zu argumentieren, Lateinisch/Deutsch, herausgegeben und übersetzt von K. Bayer, München 1993.
M. Tullius Cicero, Rede für Sextus Roscius, in: Politische Reden I, Lateinisch/Deutsch, herausgegeben, übersetzt und erläutert von M. Fuhrmann, München 1993.
Ermann, A., Die Literatur der Ägypter. Erzählungen und Lehrbücher aus dem 3. und 2. Jahrtausend v. Chr., 1923.
Everardus, Loci argumentorum legales, Ausgabe Lyon 1564.
Falk, U., Consilia, Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 2006.
Falk, U. / Schneider, B., Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht II. Ein Fall- und Repetitionsbuch für Fortgeschrittene, Heidelberg 2012.
Fey, G., Das Antike an der modernen Rhetorik, Stuttgart 1979.
Fuhrmann, M., Rhetorik und Öffentlichkeit. Über die Ursachen des Verfalls der Rhetorik im ausgehenden 18. Jahrhundert, Konstanzer Universitätsreden 147, Konstanz 1963.
Fuhrmann, M., Die Tradition der Rhetorik-Verachtung und das deutsche Bild vom ‚Advokaten’ Cicero, in: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, herausgegeben von J. Dyk, W. Jens, G. Ueding, Band 8: Rhetorik heute II, Hg. G. Ueding, Tübingen 1989 S. 43-55.
Fuhrmann, M., Die antike Rhetorik, 6. Auflage, Mannheim 2011.
Forster, V.W., Interpres, sive De interpretatione iuris libri duo, Wittenberg 1613.
Gast, W., 2006a: Juristische Rhetorik, 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Heidelberg 2006.
Gast, W., 2006b: Die sechs Elemente der juristischen Rhetorik. Das Modell rhetorischer Kommunikation bei der Rechtsanwendung, in: R. Soudry, Rhetorik. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Heidelberg 2006, S. 30-41.
Gast, W., Historisches Wörterbuch der Rhetorik, herausgegeben von G. Ueding, 1992 ff., Bd. 9, 2009, Stichwort „Vertretbarkeitsgrade“.
Gast, W., Die Juristische Subsumtion als rhetorisches Verfahren. Überlegungen zur Rolle der Rhetorik in der juristischen Ausbildung, in: J. Knape, O. Kramer, Th. Schirren (Hg.): Rhetorik. Bildung - Ausbildung - Weiterbildung, Berlin 2012, S. 188-196.
Glau, K., Logos dikanikos. Zur Rhetorik der griechischen Gerichtsrede, in: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, herausgegeben von J. Dyk, W. Jens, G. Ueding, Band 15: Juristische Rhetorik, Hg. W. Gast, Tübingen 1996, S. 1-14.
Gorgias von Leontinoi, Reden, Fragmente und Testimonien, Griechisch/Deutsch, übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Th. Buchheim, Hamburg 2012.
Grasnick, W., Wozu Rechtsrhetorik? Versuch einer Aufklärung, in: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, Heft 11/1990, Heidelberg, S. 483-494.
Griebel, J. / Sabanogullari, L., Moot Courts. Eine Praxisanleitung für Teilnehmer und Veranstalter, Baden-Baden 2011.
Haft, F., Juristische Rhetorik, 8., unveränderte Auflage, Freiburg/München 2009.
Hilgendorf, E., Rechtsphilosophie im vereinigten Deutschland. Einige Anmerkungen zu neueren Arbeiten, in: Philosophische Rundschau, Heft 1-2/1993, Tübingen, S. 1-33.
Hilgendorf, E., Was leistet die ‚Juristische Rhetorik’?, in: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, herausgegeben von J. Dyk, W. Jens, G. Ueding, Band 14: Angewandte Rhetorik, Hg. W. Hilgendorff, Tübingen 1995, S. 40-47.
Hinz, M., Der institutor del principe. Zum Verhältnis von Rhetorik und Ethik in den italienischen Hofmannstraktaten, in: G. Schröder u.a., Anamorphosen der Rhetorik. Die Wahrheitsspiele der Renaissance, München 1997, S. 125 ff.
Hohmann, H., in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, herausgegeben von G. Ueding, 1992 ff., Bd. 4, 1998, Stichwort „Juristische Rhetorik“.
Hohmann, H., Classical Rhetorik and Roman Law, in: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, herausgegeben von J. Dyk, W. Jens, G. Ueding, Band 15: Juristische Rhetorik, Hg. W. Gast, Tübingen 1996, S. 15-41.
Ignotus Auctor, in: S. Thomae Aquinatis opera omnia. Index Thomisticus, Supplementum I-VII, Bd. 7, 1980.
Isidor von Sevilla, Etymologiae, herausgegeben von W. M. Lindsay, Oxford 1911, 9. Auflage 1991.
Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Lenelotte Möller, Wiesbaden 2008.
Isokrates, Opera Omnia, herausgegeben von B.G. Mandilaras, 3 Bde., Monacii/Lipsiae 2003.
Isokrates, Sämtliche Werke, übersetzt von C. Ley-Hutton, 2 Bde., Stuttgart 1993/1997.
Kalivoda, G., / Zinsmaier, Th., in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, herausgegeben von G. Ueding, 1992 ff., Bd. 7, 2005, Stichwort „Rhetorik“, Sp. 1423, A I: Etymologie, Wortfeld, Wortgeschichte.
Kant, I., Kritik der Urteilskraft, in: Werke in sechs Bänden, herausgegeben von W. Weischedel, Wiesbaden 1956 ff., Bd. 5, S. 233-620.
Krawietz, W., Haupt- und Gegenströmungen in der juristischen Methodik und ihre rechtstheoretischen Implikationen, in: K. Gräfin von Schlieffen (Hg.), Das Enthymem. Zur Rhetorik des juridischen Begründens, Sonderheft Rechtsrhetorik, Rechtstheorie Bd. 42, Berlin 2011, S. 457-494.
Kraus, M., Deduktion, Reduktion, Kontradiktion: Rhetorische Theorien des Enthymems, in: K. Gräfin von Schlieffen (Hg.), Das Enthymem. Zur Rhetorik des juridischen Begründens. Sonderheft Rechtsrhetorik, Rechtstheorie Bd. 42, Berlin 2011, S. 417-436.
Larenz, K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage, Berlin/Heidelberg 1991.
Larenz, K. / Canaris, C.W. Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Auflage Nachdruck, Berlin/Heidelberg 1995.
Lausberg, H., Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, Stuttgart, 3. Auflage 1990.
Lerch, K. (Hg.), Die Sprache des Rechts, Bd. 2, Berlin / New York 2005.
Mittermaier, C.J.A., Anleitung zur Vertheidigungs-Kunst im Criminal-Prozesse, Landshut 1814; 4. umgearbeitete Auflage, Regensburg 1845.
Ortloff, H., Die gerichtliche Redekunst, Berlin 1887.
Otte, G., Dialektik und Jurisprudenz. Untersuchung zur Methode der Glossatoren, Frankfurt a.M. 1971.
Otte, G., Theologische und juristische Topik im 16. Jh., in: J. Schröder (Hg.), Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und Philosophie vom 16. bis zum 18. Jh., Stuttgart 1998, S. 17 ff.
Perelman, Ch., Juristische Logik als Argumentationslehre, München 1979.
Perelman, Ch., Das Reich der Rhetorik, München 1980.
Perelman, Ch. / Olbrechts-Tyteca, L., Traité de l’argumentation, la nouvelle rhétorique, Paris 1958; 3. Auflage, Bruxelles 1976.
Perelman, Ch. / Olbrechts-Tyteca, L., Die neue Rhetorik, herausgegeben von J. Kopperschmidt, übersetzt von R. Varwig, 2 Bände, Stuttgart 2004.
Pieper, J., Thomas von Aquin, 3. Aufl., München 1986.
Platon, Sämtliche Werke, in der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher, herausgegeben von W.F. Otto, E. Grassi, G. Plamböck, 1957 ff.
Platon, Gorgias, Griechisch/Deutsch, übersetzt und herausgegeben von M. Erler, kommentiert und mit Nachwort von Th. Kobusch, Stuttgart 2011.
Ponschab, R. / Schweizer, A., Schlüsselqualifikationen. Kommunikation, Mediation, Rhetorik, Verhandlung, Vernehmung, Köln 2008.
Probst, H., Deutsche Redelehre, 1905 (Sammlung Göschen).
M. F. Quintilianus, Institutionis Oratoriae Libri XII / Ausbildung des Redners, 12 Bücher, Lateinisch/Deutsch, herausgegeben und übersetzt von H. Rahn, 2 Bände, 3. Auflage, Darmstadt 1995.
Rapp, Ch., Aristotelische Grundbegriffe in der Theorie der juridischen Argumentation, in: K. Gräfin von Schlieffen (Hg.), Das Enthymem. Zur Rhetorik des juridischen Begründens. Sonderheft Rechtsrhetorik, Rechtstheorie Bd. 42, Berlin 2011, S. 383 ff.
Rhetores Latini minores, herausgegeben von C. Halm, Leipzig 1863, Neudruck Frankfurt/M. 1964.
Rhetorik Jahrbuch 1999: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, herausgegeben von J. Dyk, W. Jens, G. Ueding, Band 18: Rhetorik und Philosophie, Hg. P.L. Oesterreich, Tübingen 1999.
Rodingen, H., Pragmatik der juristischen Argumentation. Was Gesetze anrichten und was rechtens ist, Freiburg 1977.
Schanze, H. (Hg.), Rhetorik. Beiträge zu ihrer Geschichte in Deutschland vom 16. bis 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1974.
Gräfin von Schlieffen, K., Rhetorik, in: V. Römermann / Ch. Paulus (Hg.), Schlüsselqualifikationen für Jurastudium, Examen und Beruf, München 2003, S. 192-229.
Gräfin von Schlieffen, K., Zur topisch-pathetischen Ordnung juristischen Denkens. Resultate empirischer Rhetorikforschung, in: K. Lerch (Hg.), Die Sprache des Rechts, Bd. 2, Berlin / New York 2005, S. 405-448.
Gräfin von Schlieffen, K., Rhetorische Analyse des Rechts: Risiken, Gewinn und neue Einsichten, in: R. Soudry, Rhetorik. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Heidelberg 2006, S. 42-64.
Gräfin von Schlieffen, K., Rhetorische Rechtstheorie, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, herausgegeben. von G. Ueding, 1992 ff., Bd. 8, Tübingen 2007, Sp.197 ff.
Gräfin von Schlieffen, K., Das Enthymem: Ein Modell juridischen Begründens, in: Schlieffen (Hg. ), Das Enthymem. Zur Rhetorik des juridischen Begründens, Sonderheft Rechtsrhetorik, Rechtstheorie Bd. 42, Berlin 2011, S. 601 passim.
Schreckenberger, W., Rhetorische Semiotik. Analyse von Texten des Grundgesetzes und von rhetorischen Grundstrukturen der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, Freiburg/München 1978.
Schröder, G. (Hg.), Anamorphosen der Rhetorik. Die Wahrheitsspiele der Renaissance, München 1997, S. 11 ff.
Seel, O., Quintilian oder die Kunst des Redens und Schweigens, München 1987.
Seibert, Th. M., Zur Fachsprache in der Juristenausbildung. Sprachkritische Analysen anhand ausgewählter Textbeispiele aus juristischen Lehr- und Lernbüchern, Berlin 1977.
Seibert, Th. M., Aktenanalysen. Zur Schriftform juristischer Deutungen, Tübingen 1981.
Seibert, Th. M., Zeichen, Prozesse. Grenzgänge zur Semiotik des Rechts, Berlin 1996.
Seibert, Th. M., Gerichtsrede. Wirklichkeit und Möglichkeit im forensischen Diskurs, Berlin 2004.
Simon, D., Schwarz und Weiß, in: B. Lahusen / D. Simon, Zufall, Abfall, Ausfall. Rezensionen und Betrachtungen zur rechtstheoretischen Gegenwartsliteratur, Frankfurt a.M. 2008, S. 15-29.
Simon, D., Alle Quixe sind Quaxe. Aristoteles und die juristische Argumentation, in: Juristenzeitung, Heft 14/ 2011, Tübingen, S. 697-703.
Sobota, K., Sachlichkeit, Rhetorische Kunst der Juristen, Frankfurt a.M. 1990.
Sobota, K., Argumente und stilistische Überzeugungsmittel in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Eine Rhetorik-Analyse auf empirischer Grundlage, in: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, herausgegeben von J. Dyk, W. Jens, G. Ueding, Band 15: Juristische Rhetorik, Hg. W. Gast, Tübingen 1996 S. 115-136.
Soudry, R., Rhetorik. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Heidelberg 2006.
Sprute, J., Ethos als Überzeugungsmittel in der aristotelischen Rhetorik, in: G. Ueding (Hg.), Rhetorik zwischen den Wissenschaften, Tübingen 1991, S. 281 ff.
Struck, G., Topische Jurisprudenz, Frankfurt/M. 1971.
Sulzer, J.G., Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Neue (2.) vermehrte Auflage 1792-94; Band 4, Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung 1794.
Ueding, G., in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, herausgegeben von G. Ueding, 1992 ff., Bd. 1, 1992, Stichworte „artes liberales“ und „Artistenfakultät“.
Ueding, G., / Steinbrink, B., Grundriss der Rhetorik. Geschichte, Technik, Methode, 3. Auflage, Stuttgart 1994.
Viehweg, Th., Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 1. Auflage 1953; 5. Auflage, München 1974.
Viehweg, Th., Rechtsphilosophie und Rhetorische Rechtstheorie. Gesammelte kleine Schriften, mit einer Einleitung herausgegeben von H. Garrn, Baden-Baden 1995.
Walter, T., Kleine Rhetorikschule für Juristen, München 2009.
Weirauch, C., Juristische Rhetorik, Berlin 2005.
Wesel, U., Rhetorische Statuslehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen, Köln (u.a.) 1967.
Wolff, O.L.B., Lehr- und Handbuch der gerichtlichen Beredsamkeit, Jena 1850.
Zachariä, K.S., Anleitung zur gerichtlichen Beredsamkeit, Heidelberg 1810.
van Zantwijk, T., Das Enthymem: Fragmentarische Ordnung und rhetorische Wahrscheinlichkeit, in: K. Gräfin von Schlieffen (Hg.), Das Enthymem. Zur Rhetorik des juridischen Begründens. Sonderheft Rechtsrhetorik, Rechtstheorie Bd. 42, Berlin 2011, S. 437 ff.