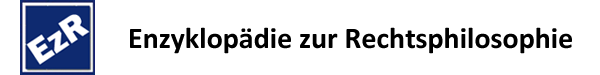Direkte Demokratie
Erstpublikation: 07.04.2011
- Einleitung
- Die Institutionen der direkten Demokratie
- Das Problem der Informationsverarbeitung
- Ergebnisse der direkten Demokratie
- Problemfelder der direkten Demokratie
- Abschließende Bemerkungen
- Bibliographie
- Verwandte Themen
I. Einleitung
1
Nach wie vor kennt die Schweiz die bei weitem am stärksten ausgebaute direkte Demokratie. Mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland, Israels und der Vereinigten Staaten haben seit dem 2. Weltkrieg jedoch alle westlichen demokratischen Länder zumindest ein gesamtstaatliches Referendum durchgeführt. Zudem wurden die Institutionen der direkten Demokratie seit 1990 in vielen Ländern neu eingeführt, wie z.B. in den Ländern des früheren ‚Ostblocks‘ (zur Situation in Zentral- und Osteuropa siehe z.B. A. Auer und M. Bützer 2001) oder verstärkt, wie z.B. in Italien. Auch in den Vereinigten Staaten sind die direkt-demokratischen Rechte in jüngerer Zeit in einigen Staaten neu eingeführt bzw. ausgebaut worden.
2
Auch in Deutschland stellen wir in den letzten Jahrzehnten einen verstärkten Ruf nach direkter Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger bei politischen Entscheidungen fest, dem zumindest teilweise auch Taten folgten. So gibt es heute in allen Bundesländern Möglichkeiten zu Volksbegehren und Volksentscheid, auch wenn die Hürden teilweise (zumindest im Vergleich zur Schweiz und zu vielen Bundesstaaten in den U.S.A.) noch recht hoch sind, weshalb von diesen Möglichkeiten zwar zunehmend, aber immer noch vergleichsweise wenig Gebrauch gemacht wird (siehe hierzu B. Kaufmann, R. Büchi und N. Braun 2006, S. 277 ff.). Die Situation in den neuen Bundesländern ist ausführlich beschrieben in P. Neumann 2009). Dagegen gibt es auf Bundesebene derzeit (noch) keine direkten Mitwirkungsmöglichkeiten; in der nach der deutschen Vereinigung eingesetzten ,Gemeinsamen Verfassungskommission‘, welche das Grundgesetz überarbeiten sollte, erhielten Vorschläge zur Einführung solcher Rechte zwar eine knappe Mehrheit, aber wegen des Widerstands der CDU/CSU nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Dabei wünscht sich heute eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger mehr direkte Volksrechte auch auf Bundesebene (Laut einer Forsa-Umfrage sind 68 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger (und sogar 65 Prozent der CDU/CSU-Anhänger) für Volksbegehren und Volksentscheide auf Bundesebene und nur 26 Prozent (bzw. 27 Prozent) dagegen. Siehe hierzu [Mehr Demokratie (02/08/10)]), und selbst Verfassungsrichter fordern Referenden bei Änderungen des Grundgesetzes (siehe hierzu z.B. (Prominente Befürworter von bundesweiten Volksabstimmungen (02/08/10)) sowie das Interview mit Gertrude Lübbe-Wolff in taz.de vom 19. Mai 2009). Und der der CSU angehörende frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber hat sogar auf Europäischer Ebene Volksabstimmungen über Verfassungsfragen gefordert (siehe z.B.: Stoiber wirbt für Volksabstimmung über die europäische Verfassung, Welt Online vom 31. Juli 2005), während der frühere Bundespräsident Horst Köhler nach seiner Wiederwahl im Jahr 2009 die Direktwahl des Bundespräsidenten wieder in die Diskussion gebracht hat. (siehe hierzu: Deutschland liebäugelt mit Volksentscheiden: Horst Köhler für einen Diskurs über die Direktwahl des Präsidenten, Neue Zürcher Zeitung Nr. 120 vom 27. Mai 2009, S. 2).
3
Bei den direkten Mitwirkungsmöglichkeiten ist zwischen direkten Wahlen von Regierungen und Sachabstimmungen zu unterscheiden. Direkte Wahlen von Regierungen gibt es in vielen Ländern und auf den unterschiedlichsten Ebenen, von der Direktwahl von Bürgermeistern bis zu jener von Staatspräsidenten. Auch ein direkt gewählter Präsident ist jedoch ein Repräsentant der Wählerschaft und trifft in ihrem Auftrag Entscheidungen, auf die sie keinen direkten Einfluss hat. Auch wenn in Deutschland immer wieder von Zeit zu Zeit das Thema der Direktwahl des Bundespräsidenten ins Spiel gebracht wird, geht es bei der ,direkten Demokratie‘ eigentlich um Sachentscheidungen, um die ,sachunmittelbare Demokratie‘, um einen Begriff von P. Neumann (2009) zu verwenden. Im Folgenden werden wir uns daher auch ausschließlich damit befassen.
4
Sieht man von sehr kleinen Gemeinwesen ab, ist es jedoch faktisch unmöglich, alle erforderlichen politischen Entscheidungen direkt zu treffen, wie dies im klassischen Beispiel der attischen Demokratie der Fall war, als die Vollbürger Athens auf dem Marktplatz (der ‚Agora‘) zusammenkamen, um über ihre Geschäfte zu diskutieren und zu entscheiden. Diese klassische Volksversammlung hat sich noch in den Landsgemeinden zweier schweizerischer Kantone, Appenzell Innerrhoden und Glarus, sowie in Gemeinden (z.B. in einigen amerikanischen Bundesstaaten und in der Schweiz) erhalten. Heute sind die Demokratien zumindest oberhalb der lokalen Ebene fast ausschließlich repräsentativ. Wenn wir von direkter Demokratie reden, dann verstehen wir darunter in aller Regel eine ,halbdirekte Demokratie‘, d.h. eine repräsentative Demokratie, in der jedoch bestimmte wichtige Entscheidungen (ausschließlich) durch das Volk getroffen werden.
5
Dabei sind vier verschiedene Arten direkter Sachentscheidungen zu unterscheiden:
6
Kontrollierende Referenden: Vom Parlament verabschiedete Gesetze, Verfassungsbestimmungen oder Ausgabenprojekte (,Finanzreferendum‘) müssen den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden, bevor sie rechtskräftig werden können. Solche Referenden können obligatorisch oder fakultativ sein; im letzteren Fall müssen sie dann durchgeführt werden, wenn eine bestimmte Anzahl von Stimmbürgern dies verlangt. Diese Referenden sollen ausschließen, dass die Regierenden Gesetze oder Ausgabenprojekte gegen den Willen der (Mehrheit der) Bürger beschließen können. Sie helfen, ein Kartell der Regierenden gegen die Bürger zu verhindern.
7
Gesetzes und Verfassungsinitiativen: Hier geht die Initiative vom Volk aus: Die Regierenden werden gezwungen, Gesetze zu beschließen und Maßnahmen zu ergreifen, die sie von sich aus nicht ergreifen würden. Solche Gesetze können z.B. dazu dienen, die Befugnisse von Regierung und Verwaltung oder Privilegien, welche sich die Parlamentarier selbst verschaffen, einzuschränken (Dies ist zu unterscheiden von der Volksinitiative nach deutschem Recht, die lediglich darin besteht, dass eine bestimmte Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern verlangen kann, dass das Parlament sich mit einer bestimmten Materie befasst (siehe hierzu P. Neumann 2009, S. 189 ff.).
8
Plebiszitäre Referenden (Plebiszit): Hier beschließen Regierung und/oder Parlament von sich aus, bestimmte Gesetzesvorlagen dem Volk zu unterbreiten, um für diese eine besondere Legitimation zu erhalten. (Der Begriff des Plebiszits (anstelle von ,Volksabstimmung‘) ist zumindest außerhalb Deutschlands eher negativ besetzt. Er wird daher im Folgenden auch nicht verwendet (zum Begriff des Plebiszits siehe P. Neumann 2009, S. 158 ff.).
9
Konsultative Referenden: Bei diesen befragen die Regierenden die Bevölkerung in einer wichtigen Angelegenheit um ihre Meinung, die letztlich aber nicht ausschlaggebend sein muss.
10
Wirksam zur Durchsetzung der individuellen Präferenzen sind vor allem die beiden ersten Formen. Sie stellen wirksame Mittel dar, die Regierung zu Rechtsnormen zu veranlassen, die den Wünschen der Wähler entsprechen. Wir werden uns hier auf sie begrenzen.
11
Im Folgenden sollen zunächst die Institutionen der direkten Demokratie beschrieben werden (Abschnitt II.). Da eines der Hauptargumente gegen die direkte Demokratie lautet, die Bürgerinnen und Bürger seien häufig oder auch generell nicht in der Lage, politische Probleme sachkundig zu entscheiden, wird zunächst auf das Problem der Informationsvermittlung und -verarbeitung eingegangen, wobei direkte und repräsentative Demokratie miteinander verglichen werden (Abschnitt III.). Ob politische Systeme mit direktdemokratischen Verfahren den Interessen der Bürgerinnen und Bürger eher dienlich sind als rein repräsentative Systeme, muss sich an den Ergebnissen zeigen. Daher werden im IV. Abschnitt empirische Arbeiten über die Ergebnisse der direkten Demokratie besprochen, wobei diese sich vor allem auf die Vereinigten Staaten und die Schweiz beziehen sowie vorwiegend die wirtschaftspolitische Dimension betrachten. Bei allen Vorteilen der direkten Demokratie darf jedoch nicht übersehen werden, dass mit ihr auch Probleme verbunden sind oder zumindest sein können. Auf einige davon wird im V. Abschnitt eingegangen. Den Abschluss bildet eine kritische Auseinandersetzung mit einigen Gegenargumenten sowie mit den Möglichkeiten, die sich für die direkte Demokratie aus den neuen Medien ergeben (Abschnitt VI.).
II. Die Institutionen der direkten Demokratie
12
Auch wenn die ersten Ansätze demokratischer Institutionen im alten Griechenland und selbst im germanischen Raum als Versammlungsdemokratien direkt-demokratische Strukturen aufwiesen und wenn solche Strukturen in lokalen Gemeinschaften über die Jahrhunderte hinweg immer wieder auftauchen, läuft die Entwicklung der Demokratie in der Neuzeit vorwiegend auf ein repräsentatives System hinaus; in England wie auch in der Französischen Revolution ging es zum einen um die Etablierung der Macht der Parlamente gegenüber den Herrschern und zweitens um die Ausdehnung des Wahlrechts auf die allgemeine Bevölkerung (zur Geschichte der Demokratie siehe z.B. J. Dunn 1992, speziell zur Entwicklung in der Schweiz Th. Curti 1882). Dies gilt im Wesentlichen auch für die Schweiz. Zwar gab es dort seit dem Mittelalter die Institution der Landsgemeinde in einigen Kantonen, doch die größeren Kantone kannten eher repräsentative Systeme. So gab es um 1840 zwar in sieben Kantonen eine Landsgemeinde und in sechs eine halbdirekte Demokratie, aber 11 Kantone hatten eine rein repräsentative Demokratie und Neuenburg war eine konstitutionelle Monarchie (Eine Landsgemeinde hatten AI, AR, GL, NW, OW, UR und SZ, halbdirekte Demokratien waren BL, GR, LU, SG, VS und ZG, während AG, BE, BS, FR, GE, SH, SO, TG, TI, VD und ZH repräsentative Demokratien hatte; siehe G. Andrey 1983, S. 267). Die Tagsatzung, das entscheidende eidgenössische Gremium der alten Schweiz, war ein repräsentatives Gremium, und auch die neue Bundesverfassung des Jahres 1848 hatte nur wenige Elemente der direkten Demokratie; die wichtigsten heute auf eidgenössischer Ebene bestehenden Volksrechte wurden erst später in die Verfassung aufgenommen. Erst dadurch wurde die Schweiz zu jenem Staat, der (nicht nur) auf nationaler Ebene weltweit die am stärksten ausgebauten direkten Volksrechte hat, sondern der heute in anderen Staaten vielerorts als Vorbild für den weiteren Ausbau dieser Rechte gilt.
13
Grundsätzlich gibt es für die direkte Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie zwei Möglichkeiten, die Initiative und das Referendum, wobei letzteres obligatorisch oder fakultativ sein kann. Im letzteren Fall muss eine bestimmte Zahl von Unterschriften gesammelt werden, damit eine Abstimmung durchgeführt wird. Zudem ist beim Referendum zu unterscheiden, worauf es sich bezieht: Auf die Verfassung (bzw. eine Verfassungsänderung), ein Gesetz (bzw. eine Gesetzesänderung), einen Staatsvertrag, eine geplante Ausgabe oder einen Verwaltungsakt. In Deutschland spricht man bezüglich der direkten Volksrechte von Volksbegehren und Volksentscheid, wobei sich beides in aller Regel auf die Initiative bezieht (Volksbegehren, die sich auf einen vorher gefassten Beschluss des Parlaments beziehen und damit ein Referendum auslösen, gibt es in Deutschland derzeit nur in der Hansestadt Hamburg).
14
Beim Referendum stehen folgende Instrumente zur Verfügung:
15
Das Verfassungsreferendum. Dieses Referendum ist in aller Regel obligatorisch: Jede Verfassungsänderung (und damit auch jene neue Verfassung) muss dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden.
16
Das Gesetzesreferendum. Hier müssen Gesetze bzw. Gesetzesänderungen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Dieses Referendum ist in aller Regel fakultativ.
17
Das Staatsvertragsreferendum. Staatsverträge, die bestimmte Kriterien erfüllen, sowie der Beitritt zu internationalen Organisationen gelangen zur Abstimmung. Dieses Referendum kann in Abhängigkeit vom Inhalt des Vertrags fakultativ oder obligatorisch sein.
18
Das Finanzreferendum. Projekte mit finanziellen Auswirkungen gelangen ab einer gewissen Größenordnung zur Abstimmung. Auch dieses kann fakultativ oder obligatorisch sein, wobei die Schranke für die Anwendung bei obligatorischen typischerweise höher ist als bei fakultativen Referenden. Zudem können die Schranken unterschiedlich sein, je nachdem ob es sich um einmalige oder (neue) laufende Ausgaben handelt.
19
Das Verwaltungsreferendum. Hier können oder müssen bestimmte Verwaltungsakte dem Volk zu Abstimmung vorgelegt werden.
20
Bei der Initiative gibt es folgende Varianten:
21
Die Verfassungsinitiative. Hier geht es darum, dass auf Vorschlag einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern einzelne Artikel der Verfassung geändert oder hinzugefügt werden sollen, über die dann abgestimmt wird. Im Extremfall kann es sich auch um eine ganze neue Verfassung handeln.
22
Die Gesetzesinitiative. Hier geht es darum, dass auf Vorschlag einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern einzelne Artikel eines Gesetzes geändert oder hinzugefügt werden oder auch ein ganz neues Gesetz beschlossen wird.
23
In Deutschland werden bei der Initiative mehrere Stufen unterschieden. Zunächst muss ein Antrag auf ein Volksbegehren gestellt werden. Hierfür müssen je nach Bundesland Unterschriften gesammelt werden oder es reicht, wenn einige wenige Bürgerinnen und Bürger diesen Antrag unterzeichnen. Kommen diese Unterschriften zusammen, geht das Volksbegehren an das jeweilige Parlament, welches sich damit befasst. Entscheidet das Parlament nicht im Sinne der Antragsteller, müssen wiederum Unterschriften gesammelt werden, damit ein Volksentscheid durchgeführt wird.
24
Ob ein fakultatives Referendum oder eine Initiative überhaupt zustande kommt, hängt wesentlich von der Zahl der erforderlichen Unterschriften ab, und wie viel Zeit zum Sammeln zur Verfügung steht. J.G. Matsusaka (1995) hat z.B. für die Vereinigten Staaten gezeigt, dass die dämpfenden Wirkungen der Initiative auf die öffentlichen Ausgaben stark zurückgehen, wenn die Unterschriften von mehr als 5 Prozent der Stimmberechtigten erforderlich sind, und dass ab 10 Prozent kein signifikanter Effekt mehr festgestellt werden kann. In der Schweiz sind auf Bundesebene bei der Initiative 100'000 und beim fakultativen Referendum 50'000 Unterschriften erforderlich. Dies sind bei derzeit ca. 5 Millionen Stimmberechtigen etwa zwei bzw. ein Prozent der Abstimmungsberechtigten. Dabei hat man bei der Initiative 18 Monate, beim Referendum 100 Tage Zeit zum Sammeln. In Deutschland sind je nach Bundesland die Unterschriften von zwischen ca. 4 Prozent (Brandenburg) und 20 Prozent (Hessen, Saarland) der Stimmberechtigten erforderlich, und die Zeit zum Sammeln der Unterschriften schwankt zwischen 14 Tagen (Hessen, Saarland) und 12 Monaten (Niedersachsen) (siehe B. Kaufmann, R. Büchi und N. Braun 2006, S. 278 f.; unter bestimmten Umständen ist die Zeit zum Sammeln der Unterschriften in Mecklenburg-Vorpommern sogar unbefristet.). Zudem wird unterschieden zwischen der freien Sammlung und der Amtseintragung; letztere ist in acht Bundesländern vorgeschrieben.
25
Der mögliche Erfolg eines Volksbegehrens hängt auch davon ab, ob ein Quorum erfüllt werden muss, damit die Entscheidung bindend ist. Dabei ist zwischen Entscheidungsquoren und Beteiligungsquoren zu unterscheiden. Die Idee hinter beiden ist, dass eine bestimmte Zahl der Abstimmungsberechtigten hinter dem Ergebnis stehen soll, damit das Ergebnis nicht als zufällig erscheint, sondern eine zusätzliche Legitimität erhält. In der Schweiz sowie in den Vereinigten Staaten gibt es keine derartigen Quoren, sie sind jedoch in vielen anderen Ländern üblich. Vorherrschend sind Beteiligungsquoren von 50 Prozent (siehe z.B. L. Anguiar-Conraria und P.C. Magalhães 2010, S. 70). Von den dort aufgeführten 14 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Referenden auf nationaler Ebene kennen, haben 12 ein Beteiligungsquorum, davon 11 in einer Höhe von 50 Prozent. Dagegen kennen nur 6 Länder Zustimmungsquoren; deren Höhe variiert zwischen 25 und 66.7 Prozent.). Tatsächlich aber wirkt sich ein Beteiligungsquorum in dieser Höhe wie ein Zustimmungsquorum aus, da sich die Gegner einer Vorlage aus strategischen Gründen nicht beteiligen werden: Stimmen 50 Prozent zu, ist die Vorlage in jedem Fall angenommen, weil damit auch das Beteiligungsquorum erreicht ist, stimmen aber weniger als 50 Prozent zu, dann erhöht jede abgegebene Nein-Stimme die Chance, dass das Beteiligungsquorum erreicht wird. Daher ist es für Gegner der Vorlage rational, sich nicht zu beteiligen. Dass dies relevant ist, zeigen zwei Beispiele. Am 18. April 1999 wurde in Italien über eine Änderung des Wahlrechts abgestimmt. Obwohl mit 91.7 Prozent die überwältigende Mehrheit der Abstimmenden für diese Änderung war, kam sie nicht zustande, da die Abstimmungsbeteiligung mit 49.6 Prozent knapp unter der vorgeschriebenen 50 Prozent-Marke lag. Bei der am 26. Juni 1926 in Deutschland durchgeführten Volksabstimmung über die entschädigungslose Enteignung der Fürsten stimmten 96.1 Prozent für und nur 3.9 Prozent gegen das Volksbegehren. Dennoch war es nicht erfolgreich, da mit einer Beteiligung von 39.2 Prozent das Quorum von 50 Prozent klar verfehlt wurde. Ohne dieses Quorum hätte es mindestens einer Beteiligung von 72.7 Prozent bedurft, um das Volksbegehren zu Fall zu bringen (siehe hierzu H.-P. Hufschlag 1999, S. 185: „Das Beteiligungsquorum des Art. 75 WRV erlangte damit die Wirkung eines praktisch unerreichbaren Zustimmungsquorums.“).
26
Wie bei parlamentarischen Entscheidungen können auch bei Volksabstimmungen qualifizierte Mehrheiten verlangt werden. Man könnte sich z.B. vorstellen, dass bei Verfassungsänderungen zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erreicht werden müssen. In föderalen Staaten ist es sinnvoll, bei Verfassungsfragen zwischen der Mehrheit der Bevölkerung und jener der Gliedstaaten zu unterscheiden. Hier verlangt z.B. die Schweiz das ,doppelte Mehr‘, das ,Volksmehr‘ und das ,Ständemehr‘: Volksmehr bedeutet, dass die Mehrheit der Abstimmenden zustimmen muss. Ständemehr bedeutet, dass in der Mehrheit der Kantone eine Mehrheit der Abstimmenden zustimmen muss. Und für die Europäische Union schlagen L.P. Feld und G. Kirchgässner (2004, S. 224) für die Annahme einer Verfassungsinitiative neben der einfachen Mehrheit der Abstimmenden eine qualifizierte, Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitgliedstaaten vor.
III. Das Problem der Informationsverarbeitung
(siehe hierzu auch G. Kirchgässner, L.P. Feld und M.R. Savioz (1999, Kapitel 3)
27
Es ist eine alte Erkenntnis der Politikwissenschaft, auf die schon Jean-Jaques Rousseau und Thomas Jefferson aufmerksam gemacht haben: Ein hoher Informationsstand der Bürgerinnen und Bürger ist eine Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit einer Demokratie. Damit sie die „richtigen“ Entscheidungen treffen können, d.h. jene Entscheidungen, welche ihren Präferenzen am ehesten entsprechen, müssen sie über die zur Entscheidung stehenden Alternativen gut informiert sein. Hierzu ist nicht nur die Kenntnis ihrer eigenen Präferenzen, sondern vor allem „Sachkenntnis“ erforderlich. Dies gilt in der repräsentativen Demokratie für die Wahl eines Abgeordneten oder einer Partei genauso wie in der direkten Demokratie für die Annahme oder Ablehnung einer bestimmten Vorlage.
28
Dem steht entgegen, dass die Wählerinnen und Wähler in einer Demokratie kaum Anreize haben, sich zu informieren. Sobald sich bei einer Wahl oder Abstimmung nicht nur ganz wenige Bürger beteiligen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Stimme den Ausschlag gibt, praktisch Null. Damit aber hat der/die einzelne Stimmbürger(in) in großen Gemeinden, auf Landes- (Kantons-) und erst recht auf Bundesebene mit seiner/ihrer Stimme keinerlei Einfluss auf das Gesamtergebnis. Daher stellt sich zunächst die Frage, weshalb sich ein rationales Individuum überhaupt an einer Wahl oder Abstimmung beteiligen sollte (siehe hierzu z.B. G. Kirchgässner 1990 sowie G. Brennan und L. Lomasky 1993). Aber selbst wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, sich beteiligt, gibt es für den Einzelnen keinen Grund, sich besonders zu informieren. Die Beschaffung und Verarbeitung von Information ist mit Kosten verbunden. Solche Kosten nehmen rationale Individuen nur dann auf sich, wenn sie sich davon einen Nutzen versprechen. Solange das eigene Handeln aber keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis hat, ist ein solcher Nutzen nicht erkennbar. Wie bereits A. Downs (1957, S. 233 ff.) festgestellt hat, ist der rationale Bürger daher ein „rationaler Ignorant“.
29
Wir befinden uns damit in einem Dilemma: Demokratie setzt für ihre Funktionsfähigkeit den informierten Bürger voraus, aber sie vermittelt keine (oder zumindest nur wenige) Anreize dafür, dass sich die Bürgerinnen und Bürger informieren. Soweit eine Lösung überhaupt gefunden werden kann, kann sie nur darin liegen, dass die Informationskosten für die Bürger soweit als möglich gesenkt werden. Nach A. Downs (1957, S. 93 ff.) ist dies eine wesentliche Funktion, welche Ideologien in der repräsentativen Demokratie haben. Auch mit Hilfe der modernen elektronischen Medien ist es unmöglich, im Rahmen einer Wahlkampagne den Bürgern alle wesentlichen Informationen über die von einer Regierung oder Partei geplanten Vorhaben zu vermitteln. Man versucht daher, die ‚ideologische‘ Position einer Partei oder eines Kandidaten den Wählern nahe zu bringen. Diese sollen wissen, „wofür ein(e) Kandidat(in) oder eine Partei im Allgemeinen steht“, und sie sollen sich darin wiederfinden können, ohne dass sie über alle Einzelheiten der geplanten Politik informiert sein müssen.
30
Selbstverständlich wird auch Sachinformation vermittelt. Schließlich benötigt man zur Vermittlung eines ideologischen Profils zumindest ein Minimum an Sachinformation. Aber auch diese Information wird ihre Abnehmer um so eher erreichen, je „kostengünstiger“ sie angeboten wird. Kostengünstig kann Information durch die Medien, insbesondere durch das Fernsehen angeboten werden. Wer am Abend eine Nachrichtensendung sieht, nimmt eine Menge politischer Informationen auf, ohne dass ihm/ihr dabei irgendwelche zusätzlichen Kosten entstehen. Schaffen es ein Politiker oder eine Partei, in diesen Nachrichten positiv erwähnt zu werden, so wird eine für ihn/sie positive Information den Bürgern vermittelt. Kann solche Information überdies im Rahmen einer Veranstaltung angeboten werden, die für sich genommen bereits Unterhaltungswert besitzt, wird es umso leichter sein, Sachinformationen zu vermitteln. Die Verbreitung von Information ist dabei allerdings nur ein Nebenprodukt. Dies gilt insbesondere für die großen Fernsehdebatten, wie wir sie vor allem vor Wahlen kennen. Zumindest bei den kommerziellen (amerikanischen) Fernsehanstalten ist es dabei oberstes Interesse, hohe Einschaltquoten zu erzielen, um die Werbeeinnahmen zu steigern. Hauptinteresse der Kandidaten ist die Vermittlung ihrer ideologischen Position, um die entsprechenden Wählerschichten an sich zu binden. Das Publikum schließlich erwartet vor allem eine interessante Show, d.h. Unterhaltung. Alle drei Ziele können im Allgemeinen jedoch nur dann erreicht werden, wenn nicht nur über persönliche Charakteristika der Kandidaten, sondern auch über Sachfragen diskutiert wird.
31
Dadurch, dass zum einen für Wahlen weniger Information notwendig scheint als für Sachabstimmungen und dass zweitens Vertreter (Repräsentanten) bei schwierigen Sachfragen besser informiert entscheiden können, erhält die repräsentative Demokratie gegenüber der direkten Demokratie eine informationstheoretische Rechtfertigung: Es wird unterstellt, dass die Bürger bei direkten Sachentscheidungen wegen der Komplexität dieser Entscheidungen häufig oder sogar fast immer überfordert sind, was, wie oben erwähnt wurde, eines der häufigsten Argumente gegen direkte Volksrechte ist (siehe hierzu z.B. die Auflistung und Diskussion der in der gemeinsamen Verfassungskommission vorgebrachten Argumente in T. Paterna 1995, S. 128 ff. sowie in H.-P. Hufschlag 1999, S. 279 ff.).
32
Tatsächlich benötigen die Bürgerinnen und Bürger in der direkten Demokratie deutlich mehr Information als in der repräsentativen Demokratie. Schließlich sollen sie über einzelne Gesetzesvorlagen direkt entscheiden. Bei der Annahme oder Ablehnung von Vorlagen wird gelegentlich die Auffassung vertreten, mangelnde Information über die sich aus einer Ablehnung bzw. Annahme ergebenden Konsequenzen habe zu einer (aus der Sicht des Betrachters) „falschen“ Entscheidung geführt. Ganz allgemein stellt sich auch hier die Frage, ob und wie Anreize gesetzt werden können, damit die Bürger die notwendige Information erhalten, um im Sinne ihrer individuellen Präferenzen sachgerecht entscheiden zu können.
33
Im Vergleich mit der repräsentativen Demokratie spielen hier die Parteien eine untergeordnete Rolle. Wichtiger für den Entscheidungsprozess der Bürger sind die Stellungnahmen derjenigen, die durch die zur Diskussion stehenden Regelungen direkt betroffen werden, insbesondere der Interessengruppen. So hat F. Schneider (1985) gezeigt, dass die „Parolen“, d.h. die öffentlich abgegebenen Abstimmungsempfehlungen der Interessenverbände in der Schweiz, einen deutlich stärkeren Einfluss auf den Ausgang von Referenden haben als die Parolen der Parteien (zu einem ähnlichen Resultat gelangen A. Lupia 1994 sowie S. Bowler und T. Donovan 1998 für die USA).
34
Der im Vorfeld einer Volksabstimmung in der Schweiz stattfindende Diskurs ist von vier Eigenschaften geprägt (siehe hierzu auch B.S. Frey und G. Kirchgässner 1993):
35
1. Die Vorlagen werden immer im Vergleich zu Alternativen - meist dem Status quo - erörtert. Die Kosten der Durchführung sind ein wichtiger Bestandteil der Diskussion. Beides bewirkt, dass der Austausch der Argumente nicht auf allgemeiner und unverbindlicher Ebene bleibt.
36
2. Der Diskurs ist um so intensiver, je wichtiger eine Vorlage ist, d.h. je stärker sich die Bürger in den betreffenden Gebietskörperschaften, einer Gemeinde, einem Kanton oder dem Bund, davon betroffen fühlen. Die Inhalte mancher Volksabstimmungen werden als unbedeutend angesehen, so dass auch die Diskussion wenig intensiv ist. Bei anderen Abstimmungen erfolgt ein längerer und grundsätzlicherer Austausch von Argumenten. Der einem Urnengang vorangehende Diskurs ändert sich somit je nach der Bedeutung des Themas für die Stimmbürger.
37
3. Am Diskurs beteiligen sich sowohl Organisationen wie Parteien und Verbände, als auch Einzelpersonen, und er findet auf den verschiedensten Niveaus der Gesprächskultur statt. Er ist nicht auf Intellektuelle beschränkt, sondern auch im Rahmen eines Sportklubs oder Stammtisches möglich. Auch die Beteiligung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger weist je nach perzipierter subjektiver Bedeutung bzw. Betroffenheit erhebliche Schwankungen auf. So lag auf Bundesebene die durchschnittliche Beteiligung seit den siebziger etwas über 40 Prozent der Stimmberechtigten, wobei in jüngster Zeit wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist (siehe Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2010, S. 392, S. 404). Wie die Beispiele der Abstimmungen über die Abschaffung der Armee oder den EWR-Beitritt zeigen, kann bei Entscheidungen, die als wichtig eingestuft werden, die Beteiligung jedoch deutlich darüber liegen Die entsprechenden Werte der Stimmbeteiligung sind: Abschaffung der Armee (26. 11. 1989): 62.9 Prozent, EWR-Beitritt (6. 12. 1992): 78,3 Prozent. Ganz allgemein gilt, dass bei Abstimmungen über kontroverse Vorlagen, z.B. in den Bereichen Verkehrs-, Ausländer- und Sicherheitspolitik, die Stimmbeteiligung in den letzten Jahren regelmäßig über 50 Prozent lag (siehe hierzu auch A. Eschet-Schwarz 1989).
38
4. Im Verlauf dieses Diskurses findet zumindest bei Teilen der Bevölkerung ein Lernprozess statt (siehe hierzu auch N. Kostede, Das Plebiszit als Lernprozess, DIE ZEIT Nr. 15 vom 5. April 1991, S. 5). Dadurch, dass sie mit den Argumenten beider Seiten konfrontiert werden, sehen sich viele dazu veranlasst, die jeweilige Frage genauer zu überdenken. Dies kann dazu führen, dass einige und gelegentlich sogar viele ihre Auffassung ändern. Damit ergibt sich auch die Chance, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihre aktuell wirksamen Präferenzen in Richtung auf Verallgemeinerbarkeit hinterfragen.
39
Man kann davon ausgehen, dass wegen der direkten Betroffenheit der Bürger die Bereitschaft, Informationskosten auf sich zu nehmen, in der direkten Demokratie grösser ist als in der repräsentativen Demokratie. Dazu kommt, dass es für die Bürger auch privat wichtig werden kann, über politische Fragen, die zur Entscheidung anstehen, gut informiert zu sein. Dies geschieht dann, wenn andere Bürgerinnen und Bürger, mit denen man in Kontakt ist, erwarten, dass man gut informiert ist, und wenn die Enttäuschung dieser Erwartung zu einem Verlust an Prestige führen kann. Insofern kann die Informationsaufnahme nicht nur Kosten verursachen, sondern auch Nutzen stiften.
40
Aber auch hier gilt, dass die Informationen so aufbereitet werden müssen, dass sie von den Bürgern ohne allzu große Kosten aufgenommen und verarbeitet werden können. Und auch hier werden – wie bei Wahlen – gelegentlich die „falschen“ Argumente obsiegen. Wichtig ist jedoch, dass sich die Argumente im politischen Diskurs auf Sachfragen beziehen und dass es kaum möglich ist, sich mit dem Herausarbeiten einer ideologischen Position zu begnügen (Eine ähnliche Einschätzung lässt sich wiederum für die USA vornehmen; siehe hierzu A. Lupia 1994, S. Bowler und T. Donovan 1998 sowie E.R. Gerber und A. Lupia 1996). Diese reicht in aller Regel nicht aus, um die Bürger zu einer bestimmten Entscheidung zu motivieren. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn Anhänger einer Partei in größerer Zahl gegen die von ihrer Partei vertretene Linie stimmen, was nicht selten geschieht.
41
Geht man (zu Recht) davon aus, dass es erheblicher Sachkenntnisse bedarf, um politische Entscheide sachgerecht zu treffen, könnte man dennoch die Auffassung vertreten, dass Entscheide in einer repräsentativen Demokratie im allgemeinen mit mehr Sachkenntnis getroffen werden als in einer direkten Demokratie. Schließlich haben die Abgeordneten größere Anreize, sich über politische Angelegenheiten zu informieren, als die einzelnen Bürger. Bei dieser Argumentation gerät man jedoch leicht in die Gefahr, den nicht immer überzeugenden tatsächlichen Zustand der direkten Demokratie mit den idealen Bedingungen einer repräsentativen Demokratie zu vergleichen. Tatsächlich sind die Abgeordneten eines Parlaments über die zur Abstimmung anliegenden Fragen häufig ebenfalls kaum informiert (T. Paterna 1995, S. 154) vermutet, dass „in der Regel bei der Schlussabstimmung im Parlament kaum 1 Prozent der Abgeordneten vollständig aus eigener Sachkenntnis und Überzeugung abstimmt“, während H.-P. Hufschlag (1999, S. 285) dies immerhin zwischen 10 und 30 Prozent der abstimmenden Abgeordneten zubilligt.). Die Entscheidungen werden in Ausschüssen durch eine kleine Zahl Interessierter und Informierter getroffen, und die theoretisch allein ihrem Gewissen verantwortlichen Abgeordneten stimmen im Plenum, soweit sie überhaupt anwesend sind, entsprechend den Vorgaben ihrer Ausschussvertreter. Eine offene Diskussion findet dabei kaum statt. Zudem besteht ein starker Fraktionszwang: Abweichungen von der Partei- bzw. Fraktionslinie können mit erheblichen Sanktionen belegt werden; im schlimmsten Fall droht das Ende der politischen Karriere. Da außerdem in großen Parlamenten eine einzelne (abweichende) Stimme in aller Regel keinen Einfluss hat, haben viele Abgeordnete kaum Anreize, sich über Einzelheiten der zur Abstimmung stehenden Angelegenheiten zu informieren. Dies führt u.a. dazu, dass die Diskussionen im Plenum steril werden: Im Saal muss niemand überzeugt werden, da der Ausgang festliegt. Reden dienen vor allem der parteiinternen Selbstdarstellung sowie – bei Übertragungen im Fernsehen – der Darstellung nach außen. Aber auch dort muss niemand von der konkreten Sache überzeugt werden, da die Bürger keine Möglichkeit haben, auf die Angelegenheiten direkt Einfluss zu nehmen. All dies wirft die Frage auf, „ob das Abstimmungsverhalten eines Bürgers, der im Volksentscheid mangels Sachkunde seiner Parteipräferenz folgt, tatsächlich anders zu bewerten ist als das eines Abgeordneten, der sich in der Schlussabstimmung im Parlament der Fraktionsdisziplin unterwirft.“ (H.-P. Hufschlag 1999, S. 285).
42
Dies führt auch dazu, dass über viele wichtige politische Entscheidungen in der Bevölkerung kaum Diskussionen geführt werden. So wurde z.B. die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland dem Vertrag von Maastricht beitreten soll, vor dem Nein der Dänen in der deutschen Bevölkerung kaum und auch danach nicht sehr ausführlich diskutiert. Immerhin hat die Bundesrepublik mit diesem Vertrag u.a. auf ihre Souveränität in der Geldpolitik verzichtet. Da es deutliche Anzeichen dafür gab, dass dieser Vertrag in der Bevölkerung keine Mehrheit finden würde, hatten die Politiker, die nahezu geschlossen für dieses Vertragswerk eintraten, keinen Anreiz, darüber eine Diskussion auszulösen. Außerdem sahen sie zunächst keine Veranlassung, die Bevölkerung von der Notwendigkeit dieses Vertrags zu überzeugen.
43
Wird in der Konkordanzdemokratie, wie wir sie in der Schweiz auf den Ebenen des Bundes und der Kantone erleben, der Fraktionszwang stark abgeschwächt, müssen sich die Abgeordneten genauer überlegen, ob sie für oder gegen eine Vorlage stimmen wollen. Insbesondere bei den Abgeordneten der Mitteparteien FDP und CVP findet sich sehr unterschiedliches Abstimmungsverhalten im Parlament (Das Abstimmungsverhalten der Nationalratsabgeordneten wird regelmäßig erfasst; siehe hierzu M. Hermann und B. Jeitziner, Bewegung im rot-grünen Lager: Das Parlamentarier Rating 2009, Neue Zürcher Zeitung Nr. 271 vom 21. November 2009, S. 15). Da in der Zeitung regelmäßig berichtet wird, wie die einzelnen Abgeordneten abgestimmt haben, müssen sie sich dafür im Zweifelsfall auch vor ihren Wählerinnen und Wählern verantworten. Damit aber haben sie ein stärkeres Interesse, sich auch über Angelegenheiten außerhalb ihres eigenen Spezialgebiets zu informieren, als dies z.B. im Deutschen Bundestag mit seiner strengen Fraktionsdisziplin der Fall ist. Zudem erhalten die Abgeordneten in der halbdirekten Demokratie durch die Abstimmungen Information über die Präferenzen ihrer Wählerschaft, über welche die Abgeordneten im rein-parlamentarischen System nicht verfügen.
44
Vergleicht man so die Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland mit jener in der Schweiz, kann man durchaus die Frage stellen, ob der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete bei seiner Entscheidung besser informiert ist als der durchschnittliche schweizerische Stimmbürger. Soweit dies nicht der Fall ist, geht aber der wesentliche Vorteil der repräsentativen gegenüber der direkten Demokratie verloren, wobei die repräsentative Demokratie überdies den Nachteil einer schlechter informierten Öffentlichkeit hat (M. Benz und A. Stutzer 2004). So aber sind die Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Schnitt besser über die zur Entscheidung anstehenden politischen Entscheidungen informiert als die deutschen Bundesbürger. Der Grund dafür ist nicht in unterschiedlichen individuellen Einstellungen zu suchen, sondern darin, dass die Institutionen der direkten Demokratie den Stimmbürgern wesentliche zusätzliche Anreize vermitteln, sich über politische Angelegenheiten zu informieren.
45
Was für die einfachen Abgeordneten im Vergleich mit den Bürgern gilt, gilt selbstverständlich nicht für die Spezialisten der verschiedenen Parteien auf den entsprechenden Gebieten. Sie dürften im Allgemeinen gut über die jeweiligen Probleme informiert sein, und sie sind tatsächlich in der Lage, überlegtere und informiertere Entscheidungen zu treffen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Nun können diese Spezialisten – und sie tun dies auch – ihr Fachwissen bei dem einer Volksabstimmung vorangehenden parlamentarischen Entscheidungsprozess einbringen, und sie können sich außerdem im öffentlichen Diskurs vor der Volksabstimmung äußern. Insofern findet dieses Fachwissen auch in direkten Demokratien Berücksichtigung. Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Spezialisten in rein repräsentativen Systemen genügend Anreize haben, die (allgemeinen) Interessen der Bevölkerung zu berücksichtigen, oder ob sie nicht zumeist versuchen, ihre eigenen (partikulären) Interessen bzw. diejenigen ihrer spezifischen Klientel durchzusetzen. Schließlich sind sie häufig Interessenvertreter bestimmter Gruppen, für die sie in den Parlamenten sitzen. Die moderne politische Ökonomie zeigt, dass solche Politiker Anreize haben, systematisch von den Interessen der Bevölkerung abzuweichen. Daher ist zumindest offen, ob die wesentlich durch Spezialisten getroffenen „informierteren“ Entscheidungen in rein repräsentativen Demokratien wirklich „sachgemäßer“ sind als Entscheidungen in direkten Demokratien, wo die Vorschläge der Spezialisten auch die Zustimmung der breiten Bevölkerung finden müssen.
IV. Ergebnisse der direkten Demokratie
46
Um die Ergebnisse der direkten Demokratie zu erfassen, wäre es nützlich, rein repräsentative politische Systeme mit direktdemokratischen Systemen zu vergleichen. Dies ist kaum möglich, da es zumindest auf der nationalen Ebene kaum Staaten mit stark ausgebauten direkten Volksrechten gibt. Eine mögliche Alternative dazu ist, politische Systeme mit unterschiedlich stark ausgebauten direkten Volksrechten miteinander zu vergleichen. Aber auch dies ist auf der internationalen Ebene mangels entsprechender Vergleichsmöglichkeiten sehr schwierig. Daher gibt es bisher nur zwei Arbeiten, die dies versuchen. K.G. Lutz und S. Hug (2006) zeigen für eine Reihe von Staaten, dass die Möglichkeit eines Referendums dazu führt, die Differenz zwischen den Ergebnissen des politischen Prozesses und den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger zu verringern. L. Blume, J. Müller und S. Voigt (2009) versuchen, die finanzpolitischen Auswirkungen dieser Rechte zu erfassen. Dabei ergibt sich u.a., dass Referenden zu niedrigeren, Initiativen dagegen zu höheren Ausgaben führen, während z.B. kein Zusammenhang zwischen öffentlichen Defiziten oder der Produktivität einer Wirtschaft gefunden werden kann.
47
Auch diese Arbeiten kommen nicht daran vorbei, dass es nur ein Land, die Schweiz, gibt, welches auf nationaler Ebene stark ausgebaute Volksrechte hat. Daher sollte man diese Ergebnisse auch mit Vorsicht interpretieren. Die in den anderen Studien begangene Alternative besteht darin, auf die Ebenen der nachgeordneten Gebietskörperschaften, der Länder (Kantone) und Gemeinden zu wechseln. Hier gibt es sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Schweiz erhebliche Varianz in der Ausgestaltung dieser Volksrechte, was erlaubt, die Auswirkungen unterschiedlicher politischer Institutionen im Vergleich zu erfassen. In den Studien für die Schweiz wird dabei häufig ein von A. Stutzer (2003) für das Jahr 1996 und von J.A.V. Fischer (2009) für den Zeitraum von 1997 bis 2003 aufdatierter Gesamtindex der direkten Volksrechte verwendet, aber auch einzelne Indikatoren, insbesondere das obligatorische Finanzreferendum. In den Studien für die US-Bundesstaaten und Gemeinden werden vor allem die finanzpolitischen Auswirkungen der Initiative analysiert.
1. Untersuchungen für die Schweiz
2
Die erste systematische empirische Arbeit über die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der direkten Demokratie in der Schweiz stammt von W.W. Pommerehne (1978). Mit Daten der 110 größten Schweizer Städte hat er für den Durchschnitt der Jahre 1968 bis 1972 die Auswirkungen der direkten Volksrechte auf den lokalen Budgetprozess untersucht. Dabei zeigte sich, dass in Gemeinden mit direkten Volksrechten in diesen Fragen die öffentlichen Ausgaben eher den Bürgerpräferenzen entsprechen als in Gemeinden, die keine solchen Rechte kennen. Für die gleichen Städte haben F. Schneider und W.W. Pommerehne (1983) den Anstieg der Staatsausgaben von 1965 bis 1975 untersucht. Dieser lag in den Gemeinden mit direkter Demokratie – ceteris paribus – um knapp drei Prozent unter dem Anstieg in den übrigen Gemeinden. In den Gemeinden mit repräsentativem System stiegen die Staatsausgaben um durchschnittlich 9,6 Prozent. Eine Simulation ergab, dass dieser Anstieg nur 6,8 Prozent betragen hätte, wenn in diesen Gemeinden die direkten Volksrechte entsprechend ausgebaut gewesen wären.
49
In seiner Analyse der kantonalen und lokalen Staatsausgaben und ihrer Ausgabenstruktur von 1980 bis 1998 findet C.A. Schaltegger (2001) signifikant niedrigere Ausgaben in jenen Kantonen, die eine erleichterte Nutzung direkt-demokratischer Instrumente ermöglichen. Die Reduktion ergibt sich aufgrund signifikant niedrigerer Erziehungs-, Wohlfahrts- und Gesundheitsausgaben, Ausgaben für Polizei und Justiz sowie für Finanzen und Steuern. Diesen Ausgaben dämpfenden Effekten wirken jedoch signifikant höhere Ausgaben für die Volkswirtschaft entgegen, also vor allem Subventionen für die Land- und Forstwirtschaft. Verwaltungs , Kultur-, Verkehrs- und Umweltausgaben werden durch die direkten Volksrechte nicht signifikant beeinflusst.
50
Die Ergebnisse von C.A. Schaltegger (2001) bestätigen sich in einer Studie von L.P. Feld und G. Kirchgässner (2005), die neben signifikant niedrigeren Kantonsausgaben und -einnahmen in der gleichen Zeitperiode auch signifikant niedrigere kantonale Steuereinnahmen in stärker direkt-demokratischen Kantonen, aber keinen signifikanten Einfluss auf die kantonalen Defizite berichten. Das signifikant niedrigere Niveau der kantonalen Steuereinnahmen ist durch niedrigere Einkommen- und Vermögenssteuereinnahmen, nicht aber durch Veränderungen in den Gewinn- und Kapitalsteuern bedingt. Zudem finanzieren, wie L.P. Feld, G. Kirchgässner und C.A. Schaltegger (2010) zeigen, direkt-demokratische Kantone ihre Staatsausgaben stärker über Gebühren und Beiträge als über Steuern.
51
J.A.V. Fischer (2005) findet ebenfalls niedrigere Erziehungsausgaben in den stärker direkt-demokratischen Kantonen. Die geringeren Ausgaben schlagen sich negativ in den Leistungen der Schüler im Lesen, nicht aber in Mathematik und den Naturwissenschaften nieder. Direkte Eingriffsmöglichkeiten der Bürger führen somit nicht nur zu geringeren Erziehungsausgaben, sondern auch zu einer Verschiebung der Mittel zwischen den Fächern.
52
L. Feld, J.A.V. Fischer und G. Kirchgässner (2010) bestätigen den negativen Zusammenhang zwischen direkter Demokratie und den Ausgaben für die soziale Wohlfahrt. Auch die Einkommensverteilung ist in den Kantonen zwischen 1981 und 1997 signifikant weniger ungleich, wenn es sich um stärker direkt-demokratische Kantone handelt. Dies gilt, auch wenn weniger Mittel zur Umverteilung zur Verfügung stehen. A. Vatter und M. Freitag (2002) weisen ähnliche Ergebnisse für den (negativen) Zusammenhang zwischen direkter Demokratie und den kantonalen Staatsausgaben bzw. den Sozialausgaben pro Kopf für die Zeitperiode von 1988 bis 1998 aus. Sie finden dagegen keinen signifikanten Einfluss der direkten Demokratie auf die Verwaltungsausgaben und Steuereinnahmen pro Kopf. Allerdings gilt: Je mehr Finanzreferenden in einem Kanton pro Jahr durchgeführt werden, umso niedriger sind Staatsausgaben, Sozialausgaben und Verwaltungsausgaben pro Kopf.
53
Die Frage ist freilich, ob das niedrigere Ausgabenniveau – gemessen an den Präferenzen der Bürger – effizient ist. Hierzu gesicherte Aussagen zu machen, ist sehr schwierig. Indirekte Evidenz für höhere staatliche Effizienz in direkten Demokratien findet sich in Studien über die Steuermoral. Diese ist gemäß den Ergebnissen von W.W. Pommerehne und H. Weck-Hannemann (1996) in Kantonen mit direkter Demokratie in Finanzfragen höher als in solchen mit rein repräsentativen finanzpolitischen Entscheidungen. So werden Steuern in den Schweizer Kantonen, in denen die Bürger weitgehend über das Budget mitentscheiden, in geringerem Ausmaß hinterzogen. Ein ähnliches Ergebnis finden L.P. Feld und B.S. Frey (2002): Die Steuermoral ist in den Kantonen umso höher, je stärker die direkten Volksrechte ausgebaut sind.
54
Wenn aber, was anzunehmen ist, die Bereitschaft Steuern zu zahlen um so höher ist, je zufriedener die Bürger mit den ihnen angebotenen öffentlichen Leistungen sind, dann spricht dieses Ergebnis für höhere Zufriedenheit und damit auch für höhere Effizienz der staatlich angebotenen Leistungen in direkt-demokratischen Systemen. Gemäß einer Reihe von Arbeiten von B.S. Frey und A. Stutzer sind die Bürger in Kantonen und Gemeinden mit stärker ausgeprägten direkten Volksrechten zufriedener mit ihrer allgemeinen Lebenssituation (siehe z.B. B.S. Frey und A. Stutzer 2000, 2002 sowie A. Stutzer 2003). Eine neuere Studie von A. Dorn et al. (2008) relativiert diese Ergebnisse jedoch. Auch I. Stadelmann-Steffen und A. Vatter (2010) finden keinen signifikanten Einfluss des Ausmaßes direkter Volksrechte auf die allgemeine Lebenszufriedenheit, wohl aber einen, freilich sehr schwachen Einfluss auf die Zufriedenheit mit der Demokratie.
55
L.P. Feld und M.R. Savioz (1997) untersuchen schließlich den Zusammenhang zwischen direkter Demokratie und der Wirtschaftsleistung der Schweizer Kantone, gemessen an ihrem Bruttoinlandsprodukt. Für den Zeitraum von 1984 bis 1993 kommen sie zu dem Ergebnis, dass die Kantone mit direkter Demokratie in Finanzfragen – ceteris paribus – ein um etwa 5 Prozent höheres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf erwirtschafteten als die übrigen Kantone. In dieser Arbeit wird auch untersucht, ob die Kausalität möglicherweise in die umgekehrte Richtung geht: dass sich die reicheren Kantone mehr direkte Demokratie leisten können. Die empirische Evidenz spricht jedoch dagegen. Zudem wird der Einfluss der direkten Demokratie kaum geschmälert, wenn weitere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Diese Ergebnisse für die Schweizer Kantone werden auch in einer neueren Studie von M. Freitag und A. Vatter (2000) für den Zeitraum von 1983 bis 1997 bestätigt.
56
Die bisher referierten Arbeiten verwenden zumeist den oben angesprochenen Gesamtindikator für das Ausmaß der direkten Volksrechte. Was die öffentlichen Finanzen anbetrifft, interessiert jedoch vor allem die Wirkung des Finanzreferendums, da sein Zweck die Begrenzung der öffentlichen Ausgaben ist. L.P. Feld und G. Kirchgässner (2001) analysieren die Auswirkungen des obligatorischen Finanzreferendums auf die Staatsausgaben pro Kopf der 26 Kantone mit Daten von 1986 bis 1997. Sie finden, dass die Ausgaben– ceteris paribus – in Kantonen mit Finanzreferendum signifikant niedriger sind als in den übrigen Kantonen, wobei sich die Reduktion auf 6.5 Prozent beläuft. Für die Zeit von 1980 bis 1998 finden L.P. Feld und J.G. Matsusaka (2003) um 18 Prozent niedrigere Staatsausgaben pro Kopf in Kantonen mit obligatorischem Finanzreferendum, wobei sie die unterschiedlichen Betragsgrenzen berücksichtigen. P. Funk und C. Gathmann (2009) bestätigen diese Ergebnisse in einer Langzeitstudie. Für den Zeitraum von 1890 bis 2000 finden sie eine Verringerung der kantonalen Ausgaben durch das obligatorische Finanzreferendum von 9 Prozent. (Sie untersuchen auch den Einfluss der Zahl der Unterschriften, die zur Einreichung einer Initiative erforderlich sind, und finden, dass die kantonalen Ausgaben umso höher sind, je höher deren Anzahl im Vergleich zur Zahl der Stimmberechtigten ist.)
57
Formen des Finanzreferendums existieren in der Schweiz auch auf Gemeindeebene. L.P. Feld und G. Kirchgässner (2001) untersuchen die Auswirkungen des obligatorischen Finanzreferendums auf die Staatsausgaben pro Kopf von 132 der 137 größten Schweizer Städte und Gemeinden in einer Querschnittsanalyse für das Jahr 1990. Die kantonalen Ergebnisse bestätigen sich qualitativ: Die Ausgaben der Gemeinden mit Finanzreferendum sind – ceteris paribus – signifikant niedriger als in Gemeinden ohne Finanzreferendum. Quantitativ ergibt sich auf der lokalen Ebene jedoch ein stärker restriktiver Effekt des Finanzreferendums auf die Staatsausgaben: Städte und Gemeinden mit Finanzreferendum haben um etwa 20 Prozent niedrigere Staatsausgaben pro Kopf als Gemeinden ohne Finanzreferendum.
58
Ähnliche Ergebnisse wie für die Staatsausgaben erhalten L.P. Feld und G. Kirchgässner (2001) für die kantonalen Staatseinnahmen pro Kopf. In einer Panelanalyse mit Daten von 1986 bis 1997 ergeben sich in Kantonen und Gemeinden mit Finanzreferendum signifikant niedrigere Einnahmen als in denjenigen Gebietskörperschaften, die kein obligatorisches Finanzreferendum haben. Die restriktive Wirkung des Finanzreferendums ist auf kantonaler Ebene mit 11 Prozent deutlich niedriger als auf lokaler Ebene mit 21 Prozent. Hinsichtlich der Struktur der Einnahmen stellen L.P. Feld und J.G. Matsusaka (2003a) einen stärker dämpfenden Effekt des Finanzreferendums auf die Einnahmen aus (direkten) Steuern pro Kopf als auf die Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen pro Kopf fest. Die Ergebnisse, welche L.P. Feld, G. Kirchgässner und C.A. Schaltegger (2010) für den Index für direkte Demokratie erhalten, bestätigen sich somit hier für das obligatorische Finanzreferendum. Dies spricht erneut dafür, dass die Finanzierung der Staatstätigkeit in Systemen mit stärker ausgebauten direkten Volksrechten stärker nach dem Äquivalenzprinzip erfolgt.
59
L.P. Feld, C.A. Schaltegger und J. Schnellenbach (2008) belegen Auswirkungen des Finanzreferendums auch für das Verhältnis der gebietskörperschaftlichen Ebenen untereinander. Der kantonale Anteil der Summe der kantonalen und lokalen Ausgaben, Einnahmen und Steuereinnahmen ist in Kantonen mit Finanzreferendum – ceteris paribus – niedriger als in den übrigen Kantonen. Hier findet sich ein Einfluss des Finanzreferendums auf die Zentralisierung der Staatstätigkeit in der Struktur der Ausgaben und Einnahmen in differenzierter Weise wieder. Insbesondere die Ausgaben für Erziehung, Gesundheit, Wohlfahrt und Volkswirtschaft sind in Kantonen mit Finanzreferendum signifikant weniger zentralisiert. Zudem ist sowohl der kantonale Anteil der Einnahmen aus Einkommen- und Vermögensteuern sowie aus Gebühren und Beiträgen signifikant niedriger in Kantonen mit Finanzreferendum. Einer Auswirkung des Finanzreferendums auf den Zentralisierungsgrad der Ausgaben von Kantonen und Gemeinden widersprechen jedoch P. Funk und C. Gathmann (2009).
60
Ein Einfluss des Finanzreferendums findet sich auch in der Staatsverschuldung wieder. Für die 131 größten Schweizer Städte zeigen L.P. Feld und G. Kirchgässner (2001a), dass der Bruttoschuldenstand pro Kopf – ceteris paribus – in den Städten ohne obligatorisches Finanzreferendum um 45 Prozent niedriger gewesen wäre, wenn jene über dieses Instrument verfügt hätten.
2. Untersuchungen für die Vereinigten Staaten
61
Amerikanische Autoren verwenden von Beginn an Indikatoren für einzelne direkt-demokratische Instrumente. Nach den Schätzungen von J.G. Matsusaka (1995) waren die Ausgaben in US-Bundesstaaten und Gemeinden mit Verfassungs-initiative im Zeitraum von 1960 bis 1990 signifikant um etwa vier Prozent niedriger als in den übrigen Bundesstaaten und Gemeinden. Ähnliche Ergebnisse legt er für die Einnahmen der US-Bundesstaaten vor. Auch hier wirkt die Initiative restriktiv. Der Rückgang der Einnahmen und Ausgaben auf der Ebene der Bundesstaaten wird jedoch teilweise durch einen Anstieg der Ausgaben und Einnahmen auf der lokalen Ebene kompensiert. In Bundesstaaten mit Verfassungsinitiative geben die Gemeinden signifikant mehr aus und nehmen signifikant mehr ein. Es findet somit eine Dezentralisierung der Staatstätigkeit statt. Schließlich ändert sich auch die Struktur der Staatseinnahmen. Bundesstaaten mit Initiativrecht finanzieren ihr Budget signifikant stärker durch Gebühren und Beiträge als durch Steuern. Damit erfolgt eine stärkere Finanzierung nach dem Äquivalenzprinzip. Zudem zeigt sich, dass ein statistisch signifikanter Effekt der Initiative in den USA nur resultiert, wenn weniger als 10 Prozent der Stimmberechtigten für das Zustandekommen einer Initiative erforderlich sind.
62
Für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts legt J.G. Matsusaka (2000, 2004) gegensätzliche Evidenz vor: Die Staatsausgaben pro Kopf sind in den Jahren 1902, 1913, 1932 und 1942 in Bundesstaaten mit Initiativrecht signifikant höher. Vor dem Zweiten Weltkrieg führte die Initiative also nicht zu einer Verringerung, sondern zu einer Erhöhung der Ausgaben der Bundesstaaten einschließlich ihrer lokalen Gebietskörperschaften um sechs Prozent. J.G. Matsusaka (2004) erklärt diese auf den ersten Blick überraschenden, unterschiedlichen Ergebnisse dadurch, dass direkte Volksrechte nicht per se zu weniger oder mehr Staatstätigkeit führen, sondern Instrumente zur Durchsetzung der Bürgerpräferenzen darstellen. Eine stärkere Orientierung an den Bürgerpräferenzen deutet jedoch auch darauf hin, dass durch direkte Volksrechte ein Umfeld geschaffen wird, in welchem sich produktive Tätigkeiten und die Akkumulation von Wissen lohnen. S.B. Blomberg, G.D. Hess und A. Weerapana (2004) legen ähnliche Ergebnisse für 48 Bundesstaaten der USA von 1969 bis 1986 wie L.P. Feld und M.R. Savioz (1997) für die Schweiz vor: Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf näherte sich in Bundesstaaten mit Verfassungsinitiative mit einer Wachstumsrate an das langfristige Gleichgewicht an, die um 3 Prozentpunkte höher war als diejenige der Bundesstaaten ohne Initiativrecht.
63
Auch bei den Schulden ergeben sich für die Bundesstaaten in den U.S.A. ähnliche Ergebnisse wie für die schweizerischen Kantone. D.R. Kiewiet und K. Szakaly (1996) weisen um 33 Prozent niedrigere Staatsschulden pro Kopf in Bundesstaaten mit einem Referendum für neue Staatsschuldverschreibungen aus. Hingegen finden sich für die lokale Ebene Ergebnisse, die teilweise im Widerspruch zu denen aus der Schweiz stehen.
V. Problemfelder der direkten Demokratie
64
Auch wenn die empirischen Arbeiten zeigen, dass die Ergebnisse des Einsatzes direkter Volksrechte im Allgemeinen recht positiv sind, lässt sich doch nicht bestreiten, dass damit auch Probleme verbunden sind oder zumindest sein können. Andererseits werden gelegentlich Erwartungen an diese Rechte gestellt, die sich kaum erfüllen dürften. Auf einige dieser Problembereiche soll im Folgenden eingegangen werden (siehe hierzu auch G. Kirchgässner 2010).
1. Direkte Demokratie als permanenter Prozess
65
Politiker (aber nicht nur sie) fordern in (fast) rein repräsentativen Systemen in bestimmten Fällen gerne Volksabstimmungen, wenn sie erwarten, ihre eigenen politischen Ziele damit besser durchsetzen zu können. Dabei geht es um ad hoc angesetzte Plebiszite. Mit einem generellen Bekenntnis zur Einführung direkter Volksrechte hat dies im Allgemeinen wenig zu tun. Die Motivation dazu kann sein, dass man eine negative Entscheidung wünscht, die Verantwortung dafür aber nicht übernehmen will, oder dass man sich durch die Abstimmung für das eigene Handeln eine zusätzliche Legitimation erhofft. Wie verschiedene Beispiele in Frankreich zeigen, kann letzteres jedoch schief gehen. So trat Präsident Charles de Gaulle am 28. April 1969 zurück, nachdem er am Tag zuvor eine von ihm selbst angesetzte Abstimmung über ein Gesetz zur Schaffung von Regionen und zur Erneuerung des Senats verloren hatte. Und auch Präsident Jaques Chirac scheiterte mit seinem Versuch, sich durch eine Abstimmung über die Europäische Verfassung zusätzliche Legitimation zu verschaffen. In beiden Fällen ging es den Stimmbürgern weniger um das zur Abstimmung stehende Problem, sondern darum, ihrem Unmut über die Politik des französischen Präsidenten auf diese Art und Weise Luft zu verschaffen (siehe z.B. Stefan Tomik, der „politische Unfall“, FAZ.NET ( (02/08/10))). Mit solchen Reaktionen ist immer dann zu rechnen, wenn es sich um Plebiszite handelt, die überdies selten durchgeführt werden. Die direkten Volksrechte werden damit ihrer eigentlichen Funktion entleert und in gewisser Weise missbraucht, und zwar sowohl von den Regierenden, welche die Plebiszite ansetzen, als auch von den Stimmbürgern, die diese weitgehend unabhängig von der zu entscheidenden Frage als Mittel zum Protest einsetzen. Bei regelmäßig durchgeführten Referenden sowie bei Abstimmungen über Initiativen kann ein solches Verhalten zwar nicht völlig ausgeschlossen werden, aber es ist sehr viel weniger wahrscheinlich.
66
Aber nicht nur dann, wenn es sich um einzeln angesetzte Plebiszite handelt, sondern auch bei ,normalen‘ Referenden können die Resultate im Widerspruch zu dem sein, was man sich wünscht bzw. für wirtschaftlich sinnvoll hält. In jüngerer Zeit gilt dies vor allem für Anliegen der Deregulierung und der Privatisierung von Aktivitäten, die traditionell als Staatsaufgaben galten. Seit den achtziger Jahren hat sich hier unter Führung von Ökonomen ein erheblicher Wandel vollzogen, wobei in Westeuropa die Europäische Union die treibende Kraft war. Dabei zeigte sich freilich, dass Privatisierungen ein sehr viel schwierigeres Unterfangen sind, als man sich dies in den siebziger und achtziger Jahren vorstellte. Zudem ist nach der Privatisierung nicht alles erledigt. Vielmehr bedarf es in vielen Fällen aufwendiger Regulierungsmechanismen, um letztlich ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Das mangelnde Vertrauen darauf, dass dies erreicht werden kann, hat in jüngerer Zeit in der Schweiz mehrere von der Politik geplante Privatisierungen scheitern lassen (siehe hierzu L.P. Feld und G. Kirchgässner 2003, S. 262 f.). Offensichtlich möchte die (politisch aktive) Bevölkerung bestimmte Angelegenheiten nicht gerne aus der Hand geben, bzw. sie vertraut nicht ohne weiteres darauf, dass bei einer Privatisierung die Qualität der angebotenen Leistungen, mit der sie nach Umfrageergebnissen heute zufrieden ist, erhalten bleibt.
67
Aber nicht nur Privatisierungen sind gescheitert, mit der Ablehnung des Elektrizitätsmarktgesetzes vom 22. September 2002 ist in der Schweiz auch ein wichtiges Deregulierungsvorhaben von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zurückgewiesen worden. Dabei war hier – genau wie bei den gescheiterten Privatisierungen – neben der Mehrheit der politischen Repräsentanten auch die Mehrheit der Ökonomen für diese Änderung. Es ist – zumindest prima facie – ein merkwürdiges Ergebnis, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Bereich jener Aufgaben, welche dem Staat zugewiesen werden, weiter ausgedehnt sehen möchten, als es den Vorstellungen der (Mehrheit der) sie repräsentierenden Politiker entspricht.
68
Offenbar vertrauen die Bürger darauf, dass ihr politischer Einfluss auf staatliche Unternehmen in dieser Hinsicht stärker zu ihrem Vorteil gereicht, als dies bei privaten Aktiengesellschaften der Fall wäre. Als Staatsbürger hat man in einer direkten Demokratie diese Entscheidungen der Stimmbürger zu respektieren. Soweit wir als Wissenschaftler davon überzeugt sind, dass eine (rein) privatwirtschaftliche Lösung in solchen Fällen effizienter gewesen wäre, und soweit wir deshalb auch dafür eingetreten sind, stellt sich freilich die Frage, weshalb die Stimmbürger in diesen Fällen offensichtlich eine andere Auffassung vertreten als wir und die von uns beratenen Politiker. Wie G.J. Stigler (1979) hervorgehoben hat, sollte man vorsichtig damit sein, dies (ad hoc) auf mangelnde und/oder verzerrte Information der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die „wahren“ Nutzen und Kosten solcher politischer Maßnahmen zu schieben.
69
Insofern liegen A. Brunetti (1997) und S. Borner (2005) mit ihrer Kritik an der direkten Demokratie nicht falsch, wenn man daraus auch nicht ihre Schlüsse ziehen muss. Auf jeden Fall aber sollte man die direkte Demokratie nicht nach dem Ausgang einzelner Entscheidungen beurteilen, sondern nach der zu erwartenden durchschnittlichen Qualität der Gesamtheit aller Entscheidungen. Und als Vergleich sind die tatsächlichen Situationen in repräsentativen Demokratien heranzuziehen, nicht irgendwelche Idealbilder. Vergleiche tatsächlicher Situationen mit Idealbildern haben keine Aussagefähigkeit. Auch dann aber spricht, wie z.B. in G. Kirchgässner, L.P. Feld und M.R. Savioz (1999) herausgearbeitet wurde, viel für die direkte Demokratie.
2. Direkte Demokratie und Menschenrechte
70
Der moderne, in der abendländischen Tradition stehende Staat ist durch zwei Prinzipien gekennzeichnet, die in einem Spannungsfeld zueinander stehen: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit (siehe hierzu auch A. D’Atena 1999 – Selbstverständlich bedarf die Demokratie eines bestimmten Regelwerks, damit überhaupt Entscheidungen zustande kommen und durchgesetzt werden können. Hierfür sind rechtliche Vorkehrungen notwendig. Dies ändert aber nichts am prinzipiellen Spannungsfeld zwischen beiden Prinzipien.). So kann eine (extrem ausgebaute) direkte Demokratie dazu führen, dass vom Volk willkürliche Entscheide getroffen werden, die elementaren Menschen- bzw. Bürgerrechten, wie sie heute in der westlichen Welt weitgehend oder sogar allgemein akzeptiert sind und wie sie sich in der Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen finden, eindeutig widersprechen. Dies kann aber auch in einer rein repräsentativen Demokratie geschehen, wie die Beibehaltung (bzw. Reaktivierung) der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten zeigt.
71
Der Grundwiderspruch zwischen dem (häufig als „Rule of Law“) bezeichneten Rechtsstaatsprinzip und dem Demokratieprinzip ist zwar pragmatisch regelbar, aber nicht wirklich lösbar. Wie immer die verwendete Argumentation zur Legitimation bestimmter Normen auch aussehen mag, es gibt letztlich nur positives Recht, d.h. es muss eine (menschliche) Instanz geben, die jegliches – und damit auch das grundlegende Verfassungsrecht – setzt. Dies gilt insbesondere für den säkularen Staat. In modernen Gesellschaften geschieht dies mit Hilfe demokratischer Verfahren, wobei unterschiedliche Verfahren und Quoren auf unterschiedliche Bereiche angewendet werden können. Damit können insbesondere die wesentlichen Menschen- und Bürgerrechte abgesichert werden. Das Verfassungsgericht hat dann die Aufgabe der Hüterin dieser Rechte und vertritt damit – auch gegenüber der demokratisch legitimierten gesetzgebenden Körperschaft – das Rechtsstaatsprinzip. Dies kann aber nicht verhindern, dass – ebenfalls auf demokratischem Weg – eine neue Verfassung in Kraft gesetzt wird, welche die demokratischen Mitwirkungsrechte und/oder die bürgerlichen Freiheitsrechte beschneidet, wie dies z.B. vor einigen Jahren in Liechtenstein (sogar unter Anwendung eines direkt-demokratischen Verfahrens) geschehen ist (siehe hierzu z.B.: Scharfe Kritik am Fürsten: Bericht von Europarats-Delegierten erschüttert Liechtenstein, NZZ am Sonntag vom 14. September 2003, S. 15; Drohende Überwachung des Fürstentums: Liechtensteins Verfassungsstreit vor dem Europarat, Neue Zürcher Zeitung Nr. 250 vom 28. Oktober 2003, S. 17).
72
Man kann sich fragen, inwieweit Einschränkungen individueller Freiheitsrechte durch Volksentscheide tatsächlich ein relevantes Problem darstellen, oder ob es sich hier nur um rein theoretische Überlegungen handelt, die in der Praxis keine Rolle spielen. Hierzu gibt es einige empirische Arbeiten, die untersuchen, inwiefern direkte Volksrechte zur Einschränkung oder Ausweitung individueller Freiheitsrechte geführt haben (siehe hierzu die Übersicht in G. Kirchgässner 2009). Die Ergebnisse sind uneinheitlich, und sie hängen stark von der Einschätzung ab, welche Initiativen bzw. Referenden die Volksrechte einschränken. Insofern kann man diese Frage anhand dieser Studien kaum eindeutig beantworten. Andererseits hat die Frage der Vereinbarkeit von Volksentscheiden und individuellen Freiheitsrechten in der Schweiz in jüngerer Zeit an Bedeutung gewonnen. Dies spricht jedoch nicht gegen diese Volksrechte, sondern allenfalls dagegen, wie diese Fragen in der Schweiz behandelt werden. Man könnte (und sollte wohl auch) dieses Problem lösen, indem man z.B. eine verfassungsgerichtliche Überprüfung von Initiativen einführt, um zu verhindern, dass mit den individuellen Menschenrechten nicht verträgliche Initiativen zur Abstimmung gelangen. Zudem kann es, wie das deutsche Beispiel in den siebziger Jahren oder die jüngere Entwicklung in den Vereinigten Staaten zeigen, auch in rein repräsentativen Systemen massive Einschränkungen individueller Freiheitsrechte geben. Diese Gefahr ist nicht auf direkte Demokratien beschränkt.
3. Der Finanzvorbehalt
73
Es gibt die Befürchtung, dass die Bevölkerung Maßnahmen beschließen könnte, ohne die Möglichkeiten ihrer Finanzierung zu berücksichtigen, und dass sich daraus Probleme für die öffentlichen Haushalte ergeben könnten. Dies kann nicht a priori ausgeschlossen werden, und es liefert die Begründung für den Finanzvorbehalt, den die Verfassungen aller deutschen Bundesländer kennen: Haushaltsrelevante Entscheidungen bleiben dem Parlament vorbehalten und dürfen nicht Gegenstand eines Volksentscheids sein (siehe hierzu z.B. J. Krafczyk 2005). Da es nur wenige politische Entscheidungen gibt, die überhaupt keine fiskalischen Auswirkungen haben, bedeutet dies eine massive Einschränkung der direkten Volksrechte.
74
Ist dieser Vorbehalt gerechtfertigt? Ist diese theoretisch existierende Möglichkeit praktisch relevant? Eine erste Antwort darauf gibt ein Vergleich zwischen der Schweiz und Deutschland: Während in der Schweiz, in der es keinen solchen Vorbehalt gibt, bisher kein Kanton eine Haushaltsnotlage erklärt und von den anderen Kantonen und/oder vom Bund zusätzliche Mittel verlangt hat, haben dies in Deutschland sowohl Bremen als auch das Saarland im Jahr 1992 getan, und sie haben mit ihrer Klage beim Bundesverfassungsgericht Erfolg gehabt. Das Land Berlin hat es im Jahr 2006 ebenfalls versucht, ist aber abgewiesen worden. Im Rahmen der Föderalismusreform II sind diesen Ländern weitere Finanzhilfen zugesprochen worden (Grundgesetz Artikel 143d (2), eingefügt mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl 2009, Teil 1, Nr. 48, S. 2248 – 2250). Anscheinend ergeben sich in deutschen Bundesländern trotz Finanzvorbehalt massive Finanzschwierigkeiten, während Vergleichbares in der Schweiz auch ohne Finanzvorbehalt nicht auftritt.
75
Ein wesentlicher Grund, weshalb sich die Situation in der Schweiz anders darstellt, obwohl einige Kantone, insbesondere Genf und das Waadtland, sehr stark verschuldet sind, ist die Steuerhoheit der Kantone: Wenn entsprechende Probleme auftreten, können die Kantone ihre Steuereinnahmen erhöhen. Da die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sie im Zweifelsfall mit ihren Steuern für die öffentlichen Ausgaben aufkommen müssen, sind sie dabei entsprechend zurückhaltend. Die deutschen Bundesländer haben keine derartige Steuerkompetenz. Dementsprechend könnte es für deren Stimmbürger auch weniger Hemmungen geben, Ausgaben zu beschließen.
76
Diese Argumentation deckt jedoch nur einen Teil ab. Sie reduziert die direkte Demokratie zumindest implizit auf das Instrument der Initiative (bzw. des Volksbegehrens und des Volksentscheids), was aus deutscher Perspektive zwar verständlich ist, weil dort nur diese Instrumente zur Verfügung stehen, aber wesentliche Aspekte ausklammert. Das wichtigste direktdemokratische Instrument der Finanzpolitik ist, wie oben dargestellt wurde, das Finanzreferendum. Das zweite wichtige Instrument ist das (fakultative) Gesetzesreferendum. Auch dieses Instrument dämpft eher die Ausgaben, als dass es sie erhöht, wenn nämlich vom Gesetzgeber beschlossene ausgabenwirksame Gesetze vom Volk verworfen werden. Tatsächlich zeigen empirische Untersuchungen, dass eine Vorlage – ceteris paribus – umso eher verworfen wird, je kostspieliger sie ist (siehe hierzu G. Kirchgässner, und T. Schulz 2005). Es ist freilich auch möglich, dass eine Vorlage, die Einsparungen bringen soll, vom Volk verworfen wird. Insofern kann es gelegentlich auch vorkommen, dass ein erfolgreiches Referendum eine solide Finanzpolitik erschwert.
77
Deswegen Gesetzesreferenden mit finanziellen Auswirkungen dem Finanzvorbehalt zu unterstellen und damit grundsätzlich zu untersagen, ist schon deshalb nicht angebracht, weil dieses Instrument, wie gesagt, in aller Regel dämpfend auf die Staatsausgaben und damit auch auf die öffentlichen Schulden wirkt. Viel sinnvoller ist es, auf den Ebenen des Bundes wie auch der untergeordneten Gliedkörperschaften, der Bundesländer bzw. Kantone wie auch der Gemeinden, „Schuldenbremsen“ einzuführen, wie sie seit längerem eine Reihe von Kantonen aber auch die Schweizerische Eidgenossenschaft und seit 2009 auch die deutschen Bundesländer und der Bund kennen. Wie empirische Ergebnisse zeigen, haben Kantone mit Schuldenbremsen signifikant niedrigere Defizite und Schulden als Kantone, die keine solchen Institutionen kennen (siehe hierzu, aber auch zu den unterschiedlichen Regelungen auf kantonaler bzw. auf eidgenössischer Ebene L.P. Feld und G. Kirchgässner 2007 sowie G. Kirchgässner 2009a). Es ist somit möglich, Gefährdungen der finanziellen Solidität auch der untergeordneten Gliedkörperschaften zu begegnen, ohne jene direkten Volksrechte, von denen solche Gefährdungen ausgehen könnten, deshalb einschränken zu müssen.
4. Direkte Demokratie und politische Reformen
(Zur Frage, inwieweit die direkte Demokratie Reformen entgegensteht, siehe auch G. Kirchgässner 2008).
78
Wie gerade ausgeführt wurde, kann das fakultative Gesetzesreferendum nicht nur dazu führen, dass ausgabenträchtige Gesetze nicht erlassen werden, sondern es kann auch notwendige Reformen blockieren. Dieser Vorwurf wird von denjenigen, die die direkten Volksrechte in der Schweiz einschränken wollen, immer wieder erhoben. Nun lässt sich kaum bestreiten, dass durch das Referendum wichtige Entscheidungen verzögert wurden. So wurde z.B. am 1. Februar 1959 von der Mehrheit der männlichen Stimmbürger zum letzten Mal das Frauenstimmrecht auf Bundesebene abgelehnt; die Frauen bekamen dieses Recht erst am 7. Februar 1971. Noch bedenklicher sah es auf kantonaler Ebene aus. Während die meisten Kantone, soweit sie das nicht schon davor getan hatten, das kantonale Frauenstimmrecht kurz nach der Abstimmung vom Februar 1971 einführten, weigerten sich die beiden Appenzell weiterhin. In Appenzell Ausserrhoden wurde es erst auf der Landsgemeinde im Jahr 1989 eingeführt, und die Innerrhoder Landsgemeinde lehnte es noch im Jahr 1990 ab. Erst eine im gleichen Jahr ergangene Entscheidung des Bundesgerichts, die auch diesen letzten Kanton zur Einführung des Frauenstimmrechts zwang, stellte sicher, dass Frauen auf allen Ebenen in ihren politischen Rechten den Männern gleichgestellt wurden.
79
In der politischen Diskussion der jüngeren Zeit war es aber weniger dieser Anachronismus, sondern es waren bestimmte wirtschaftspolitische Entscheidungen, wie z.B. die Ablehnung des Beitritts zum EWR am 6. Dezember 1992, die eine Rolle spielten. Sie hatte negative wirtschaftliche Folgen für die Schweiz, und die Politik der bilateralen Verträge, die seitdem eingeschlagen und in der Abstimmung vom 8. Februar 2009 vom Volk eindrücklich bestätigt wurde, konnte dies zwar weitgehend, aber nicht vollständig kompensieren, und sie wird im Zeitablauf zunehmend schwieriger. Daher ist die Frage berechtigt, ob die direkte Demokratie der Schweiz nicht ein Hindernis für die weitere wirtschaftliche Entwicklung darstellt.
80
Es ist freilich hoch problematisch, solche Fragen anhand des Ausgangs einer einzelnen Abstimmung oder auch einiger weniger Abstimmungen entscheiden zu wollen. Auch in rein repräsentativen Systemen gibt es einzelne Entscheidungen, die negative wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die relevante Frage ist, ob die direkte Demokratie im Vergleich mit einem real existierenden rein repräsentativen System zu im Durchschnitt „besseren“ Entscheidungen führt, wobei der Maßstab für „besser“ und „schlechter“ erst noch festgelegt werden müsste. Die wirtschaftlichen Aussichten der Schweiz sind heute, nach Überwindung der Wachstumsschwäche der neunziger Jahre (zur Diskussion der Wachstumsschwäche der Schweiz siehe z.B. die Beiträge in L. Steinmann und H. Rentsch 2005), eher besser als diejenigen ihrer europäischen Nachbarn. Und was Reformen anbetrifft, kann sich die Schweiz zumindest in jüngerer Zeit durchaus mit ihren größeren Nachbarstaaten messen: Reformstaus gibt es in Deutschland, Frankreich und Italien mindestens so sehr wie in der Schweiz (zur Notwendigkeit von Reformen in Deutschland siehe z.B. die Beiträge in K.F. Zimmermann 2006). So hat die Schweiz z.B. in den letzten Jahren eine Reform ihres Föderalismus vollzogen, die sehr viel weitgehender ist, als alle Reformen, die in Deutschland überhaupt ernsthaft in Erwägung gezogen wurden (zur Reform in der Schweiz z.B. C.A. Schaltegger und R.L. Frey 2003). Dabei sind die deutschen Probleme seit langem bekannt: F.W. Scharpf hat bereits im Jahr 1985 auf die „Verflechtungsfalle“ hingewiesen, der die deutsche Politik ausgesetzt ist und die sie häufig lähmt. Das Problem des Reformstaus kann daher nicht auf die Frage rein-repräsentative versus halb-direkte Demokratie reduziert werden.
81
Andererseits gibt es durch das Referendum eine „Status-Quo-Verzerrung“, d.h. der Status Quo hat bei einer Abstimmung unter sonst gleichen Bedingungen einen Vorteil. G. Kirchgässner, und T. Schulz (2005) haben gezeigt, dass in einem Abstimmungskampf ein Franken, der zur Werbung gegen eine Vorlage eingesetzt wird, fast die doppelte Wirkung hat wie ein Franken, der zur Unterstützung eingesetzt wird. Dies entspricht auch den Ergebnissen von E.R. Gerber (1999) für die Vereinigten Staaten. Sie zeigt, dass es für Interessengruppen leichter ist, gegen als für eine Vorlage zu mobilisieren.
82
Dieser Verzerrung, die durch das Referendum bewirkt wird, steht jedoch die beschleunigende Wirkung der Initiative gegenüber (An Anlehnung an einen verbreiteten Sprachgebrauch spricht W. Linder (1999, S. 259) in diesem Zusammenhang vom „Gaspedal“ als Gegenstück zum Referendum, der „Bremse“). Sie ermöglicht, Probleme auf die politische Tagesordnung zu setzen, die von den Parteien (bisher) negiert werden. So konnte die schweizerische Bevölkerung z.B. bereits im Jahr 1979 über ein Moratorium für die Kernenergie abstimmen, als in Deutschland noch alle im Bundestag vertretenen Parteien nahezu geschlossen für diese Energieform eintraten. In Deutschland benötigte man die Gründung einer neuen Partei, die sich speziell dafür einsetzte, in der Schweiz „nur“ eine Initiative, um dieses Problem in die ernsthafte politische Diskussion zu bringen.
83
Insofern kennt die direkte Demokratie in der Schweiz beides, eine Bremse und ein Gaspedal. Nun kann man argumentieren, dass das Problem darin liegt, dass die Bremse stärker bzw. zu stark ist. Dies mag zumindest für wirtschaftspolitische Reformen gelten. Schließlich wird kaum eine solche Reform durch eine Initiative gefordert und durchgesetzt, aber mehrere Reformen sind in der jüngeren Vergangenheit am Referendum gescheitert. Aber selbst wenn man dies so sieht, stellt sich die Frage, ob es nicht trotzdem sinnvoll ist, dem Status Quo eine bestimmte Priorität einzuräumen.
84
Für Verfassungsfragen (und damit für das obligatorische Referendum bei Verfassungsänderungen in der Schweiz) dürfte dies unstrittig sein. Schließlich verlangen alle Länder dafür höhere Quoren als die einfache Mehrheit; in Deutschland müssen sowohl Bundestag als auch Bundesrat mit jeweils zwei Dritteln zustimmen. Dies ist eine sehr viel höhere Hürde als in der Schweiz, die bei einer Verfassungsinitiative nur das Volks- und das Ständemehr verlangt. Nicht zufällig wird die Schweizerische Bundesverfassung sehr viel häufiger geändert als die Verfassungen Deutschlands oder gar der Vereinigten Staaten. Insofern könnte man sogar argumentieren, dass das retardierende Element bei Verfassungsfragen in der Schweiz zu gering ist.
85
Etwas anders sieht es beim fakultativen Gesetzesreferendum aus. Hier kann man argumentieren, dass der Status Quo gegenüber neuen Vorschlägen nicht bevorzugt sein sollte. Auch dieses Argument ist jedoch nicht unproblematisch. Zum einen wird gerade aus der Sicht der Wirtschaft häufig gefordert, dass die Politik stetig und berechenbar sein sollte. Die Status-Quo-Verzerrung verstetigt die Politik. Offensichtlich gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen Berechenbarkeit und der Politik und ihrer Offenheit für neue Lösungen. Wie dies optimal aufgelöst werden sollte, ist nicht a priori gegeben. Ein gewisser, nicht zu starker Status-Quo-Bias kann hier durchaus von Vorteil sein.
86
Zweitens aber ist die entscheidende Frage aus demokratietheoretischer Sicht nicht die, ob der Status Quo einen Vorteil hat, sondern welches System Lösungen hervorbringt, die näher an den Präferenzen der Bevölkerung sind. Wie empirische Untersuchungen zeigen, hat das dieser Hinsicht direkt-demokratische System eindeutige Vorteile (siehe hierzu W.W. Pommerehne 1978, E.R. Gerber 1996, 1999, S. Hug 2004, 2010, J.G. Matsusaka 2006, K.G. Lutz und S. Hug 2006 sowie D. Bochsler und S. Hug 2009). Wenn Reformen in diesem System tatsächlich länger dauern sollten als in rein repräsentativen Systemen, dann sind dies aus demokratietheoretischer Sicht Kosten dafür, dass die Präferenzen der Bevölkerung besser berücksichtigt werden. Und es ist völlig offen, ob dies wirtschaftliche Nachteile mit sich bringt. Die oben vorgestellten Untersuchungen für die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sowie für die Schweizer Kantone durchgeführt wurden, zeigen eher das Gegenteil. Man mag einwenden, dass sie sich nur auf die Ebene der Bundesstaaten und Kantone beziehen und dass es offen ist, ob diese Ergebnisse auf die nationale Ebene übertragen werden können. Es gibt gute Argumente dafür, auch wenn dies gelegentlich in Zweifel gezogen wird. Auf jeden Fall aber ist die Entwicklung der Schweiz im Vergleich mit ihren Nachbarstaaten auch in jüngerer Zeit, insbesondere auch in der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise, nicht so verlaufen, dass man daraus folgern müsste, dass die direkte Demokratie auf Dauer erhebliche wirtschaftliche oder politische Nachteile mit sich bringt.
VI. Abschließende Bemerkungen
87
Auch wenn sich die Diskussion über Vorzüge und Nachteile direkter Volksrechte gegenüber früher deutlich versachlicht hat, ist sie insbesondere in Deutschland nach wie vor stark polarisiert. Grundsätzlichen Befürwortern, die sich in Deutschland insbesondere im Umkreis der Bürgeraktion „Mehr Demokratie e.V.“ sowie des jetzt in Marburg beheimateten „Initiative and Referendum Institute Europe“ finden, stehen überzeugte Gegner gegenüber, die solche Rechte auf Bundesebene entweder vollständig ablehnen (siehe H.-P. Hufschlag 1999, S. 305 oder P. Lerche 1995) oder auf das obligatorische Staatsvertragsreferendum (siehe z.B. S. Jung 2001, S. 294) oder das obligatorische Verfassungsreferendum (siehe z.B. J. Giehl 1996, S. 294) begrenzen wollen. Die Einführung jenes Instruments, welches den Bürgerinnen und Bürgern die größten Möglichkeiten zur Kontrolle der Regierung und des Parlaments einräumt, des fakultativen Referendums, lehnen sie explizit ab (Strikte Gegner der direkten Demokratie gibt es selbstverständlich auch außerhalb Deutschlands, so z.B. J. Haskel 2001 in den Vereinigten Staaten oder W. Wittmann 1998, 2001 in der Schweiz.). Dabei gestehen auch sie zu, dass die bisherigen Erfahrungen mit Volksentscheiden in den Ländern und Gemeinden eher positiv sind (So bezeichnet z.B. H.-P. Hufschlag 1999, S. 266, S. 269 die in den deutschen Bundesländern mit Volksabstimmungen gemachten Erfahrungen zweimal explizit als „ermutigend“, während Volksabstimmungen auf Bundesebene seiner Meinung nach „weder geboten noch zu empfehlen“ (S. 305) sind.). Sie stellen freilich die Übertragbarkeit auf die Bundesebene in Zweifel.
88
Bei dieser ablehnenden Haltung wird zwar immer wieder auf die angeblich negativen Erfahrungen in der Weimarer Republik verwiesen, die bereits in den Diskussionen im Parlamentarischen Rat sowie in der Gemeinsamen Verfassungskommission eine wenn auch untergeordnete Rolle gespielt haben (zu den Erfahrungen in der Weimarer Republik siehe z.B. O. Jung 1989 sowie G. Kirchgässner, L.P. Feld und M.R. Savioz 1999, Kapitel 6, zur Diskussion im Parlamentarischen Rat O. Jung 1994, zur Diskussion in der Gemeinsamen Verfassungskommission H.-P. Hufschlag 1999, S. 279 ff.), aber erstaunlich wenig auf die konkreten Erfahrungen in anderen Ländern eingegangen. Es wird eher formal argumentiert, dass man sich damit „dauerhaft von einem System majoritär-parlamentarischer Natur zu verabschieden“ hätte (S. Jung 2001, S. 294; siehe auch P. Badura 1993, S. 120 sowie die Diskussion in T. Paterna 1995, S. 135 ff.) bzw. den deutschen Föderalismus schwächen würde (siehe z.B. H.-P. Hufschlag 1999, S. 290 ff. oder T. Paterna 1995, S. 135 ff.) oder dass dies nur den Einfluss organisierter Interessengruppen und/oder der Parteien stärken würde. Schließlich wird die Kompromissunfähigkeit der Volksgesetzgebung behauptet, da man hier nur mit Ja oder Nein abstimmen könne, während das parlamentarische Verfahren für Kompromisslösungen offen sei (H.-P. Hufschlag 1999, S. 282 ff.).
89
Bei dieser Argumentation wird zum einen nicht gesehen, dass die anderen europäischen Länder, wenn auch in sehr geringem Umfang, Volksabstimmungen auf nationaler Ebene durchführen, ohne dass damit die Natur ihres politischen Systems grundsätzlich verändert würde. Die Schweiz mit ihrem Konkordanzssystem ist ja eher ein Ausnahmefall (Dies hängt freilich mit der Definition der Konkordanz zusammen. Hierzu gibt es im Anschluss an G. Lehmbruch 1967 und A. Lijphart 1968 eine intensive Diskussion in der Politikwissenschaft.). Andererseits ist Deutschland schon heute relativ nahe am Konkordanzmodell: Da in den letzten Jahrzehnten die Bundesregierung fast durchgängig keine Mehrheit im Bundesrat hatte, können wesentliche Fragen häufig nur im Zusammenwirken zwischen Regierung und parlamentarischer Opposition entschieden werden, ohne dass letztere freilich dafür die Verantwortung übernehmen müsste. Dies verursacht ja die von F.W. Scharpf (1985) beschriebene Politikverflechtungsfalle.
90
Zweitens wird übersehen, dass in der Schweiz die direkte Demokratie zur Stärkung des Föderalismus beigetragen hat, indem häufig Vorlagen von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern verworfen wurden, die eine Zentralisierung und/oder eine Verlagerung von Kosten auf die Kantone mit sich gebracht hätten. Drittens zeigt die Erfahrung der Schweiz, dass die Parteien durch die direkten Volksrechte eher geschwächt werden, da Themen auch an ihnen vorbei auf die politische Tagesordnung gesetzt werden können und sie damit ihr Monopol in diesem Bereich verlieren. Dem widerspricht nicht, dass Parteien häufig versuchen, Initiativen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Auch ist richtig, dass es zum Starten eines Abstimmungskampfes im Allgemeinen einer entsprechenden Organisation bedarf. Dies wird freilich dadurch relativiert, dass gelegentlich auch ganz kleine, unabhängige Gruppen mit ihren Anliegen Erfolg haben (siehe z.B. die am 8. Februar 2004 angenommene Initiative „Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter“, die von zwei Frauen gestartet wurde).
91
Was den Einfluss der Interessengruppen angeht, so wird für die entsprechenden Behauptungen keine empirische Evidenz vorgelegt; es handelt sich um reine Spekulation. Es gibt auch keine empirische Untersuchung darüber. Rein theoretisch betrachtet aber haben die Interessengruppen im rein-parlamentarischen System eher eine stärkere Stellung als in der halb-direkten Demokratie, da sie dort „nur“ die Vertreter der Regierungskoalition im Fachausschuss überzeugen müssen und nicht – im Falle eines Referendums – auch die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Wie oben bereits ausgeführt wurde, ist dies nicht einfach, und gerade wirtschaftliche Interessengruppen scheitern damit häufig trotz des Einsatzes erheblicher finanzieller Mittel.
92
Schließlich ist das Argument der Kompromissunfähigkeit bestenfalls für die Initiative, nicht aber für das Referendum relevant, da dort ja nur der im Parlament ausgehandelte Kompromiss zur Abstimmung steht. Dabei zeigt die Erfahrung der Schweiz, dass der Zwang zum Kompromiss im Parlament unter der Drohung eines möglichen Referendums sehr viel stärker ist als im rein parlamentarischen System: Beschlüsse, die im Parlament nur die Zustimmung einer knappen Mehrheit finden, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, im Referendum zu scheitern. Was die Initiative angeht, so stimmt dieses Argument für Kalifornien, wo Initiativen dem Volk vorgelegt werden, ohne dass das Parlament dazu Stellung nehmen kann. In der Schweiz und in den deutschen Bundesländern hat das Parlament immer die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Damit existieren hier die gleichen Kompromissmöglichkeiten wie im rein parlamentarischen System. In der Schlussabstimmung muss man sich freilich in der halb-direkten wie auch der rein parlamentarischen Demokratie für Ja oder Nein entscheiden.
93
Bei allen Problemen, die mit direkten Volksrechten verbunden sein können, zeigt sich doch, dass viele der Argumente, die gegen sie vorgebracht werden, nicht stichhaltig sind. Andererseits sollte man auch die direkte Demokratie weder idealisieren, noch in ihren positiven Auswirkungen überschätzen. Auch in der Schweiz gibt es Politikverdrossenheit, und wenn sich bei einer erfolgreichen Initiative anschließend zeigt, dass sie nicht korrekt umsetzbar ist, kann dies die Verdrossenheit noch erhöhen (Dies gilt z.B. für die o.e. Initiative „Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter“. Bei ihr stellte sich heraus, dass eine EMRK-konforme Umsetzung nicht möglich ist.). Wesentlich ist aber, dass, wie eine ganze Reihe von Untersuchungen zeigt, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sich im Ergebnis der politischen Prozesse dann stärker widerspiegeln, wenn diese über direkte politische Rechte verfügen (siehe hierzu die Verweise in Rz. 86). Allein dies sollte ein hinreichender Grund sein, die ablehnende Haltung einer Einführung direkter Volksrechte auf Bundesebene zu überdenken.
94
Andererseits sollte man zurückhaltend bezüglich der zukünftigen Rolle der elektronischen Medien für die direkte Demokratie sein. Manche versprechen sich davon ein Aufblühen, da es in Zukunft immer einfacher möglich sein wird, immer mehr Bürgerinnen und Bürger auch sehr kurzfristig nach ihrer politischen Meinung zu befragen. Die Technik gibt uns Mittel in die Hand, um Abstimmungen in immer größeren Staaten mit immer kürzerer Vorbereitungszeit und mit immer geringeren Kosten durchzuführen (siehe zu entsprechenden Vorstellungen A. Toffler 1980 oder I. Budge 1996). So ist es denkbar, dass die Bürgerinnen und Bürger sich an Volksabstimmungen in Zukunft mit Hilfe eines PC’s von zu Hause aus beteiligen. Man könnte versucht sein, dies als Mittel gegen die häufig beklagte Abstimmungsmüdigkeit und Politikverdrossenheit einzusetzen.
95
Eine solche rein technokratische Betrachtungsweise vergisst jedoch, dass der gesellschaftliche Diskurs, der den einzelnen Abstimmungen vorangeht und in welchem die Informationen von den Bürgern aufgenommen und verarbeitet werden, wesentlich für das Gelingen einer direkten Demokratie ist. Bei der Knappheit der zur Verfügung stehenden Zeit kann ein solcher Diskurs immer nur bei wichtigen Fragen geführt werden; die Zahl der Abstimmungen, die sinnvollerweise in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt werden können, findet darin eine natürliche Grenze. Ein Abstimmungsmechanismus, bei welchem (nahezu) permanent nach der Meinung der Bevölkerung gefragt würde und bei welchem Antworten auf diese Fragen für die Politik ausschlaggebend wären, würde fast zwangsläufig dazu führen, dass die Abstimmenden ihre Entscheidungen eher zufällig treffen. Dann besteht die Gefahr, dass die Entscheidungen von den Unterlegenen zwar möglicherweise noch als legal, aber nicht mehr als legitim anerkannt werden. Dies würde auf Dauer die Akzeptanz der direkten Demokratie bei der Bevölkerung untergraben.
VII. Bibliographie
Andrey, G., Auf der Suche nach dem neuen Staat (1798 – 1848), in: Comité pour une Nouvelle Histoire de la Suisse (ed.), Geschichte der Schweiz – und der Schweizer, Helbing und Lichtenhahn. Basel 1983, S. 177 – 287.
Anguiar-Conraria, L. und Magalhães, P.C., Referendum Design, Quorum Rules and Turnout, Public Choice 144, 2010, S. 63 – 81.
Auer, A. und Bützer, M., Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience, Ashgate, Aldershot et al. 2001.
Badura, P., Thesen zur Verfassungsreform in Deutschland, in: B. Bender, R. Breuer, F. Ossenbühl und H. Sendler (eds.), Rechtsstaat zwischen Sozialgestaltung und Rechtsschutz, Beck, München 2003, S. 111 – 130.
Benz, M. und Stutzer, A., Are Voters Better Informed When They Have a Larger Say in Politics? Evidence for the European Union and Switzerland, Public Choice 119, 2004, S. 31 – 59.
Blomberg, S.B., Hess, G.D. und Weerapana, A., The Impact of Voter Initiatives on Economic Activity, European Journal of Political Economy 20, 2004, S. 207 – 226.
Blume, L., Müller, J. und Voigt, S., The Economic Effects of Direct Democracy: A First Global Assessment, Public Choice 140, 2009, S. 431 – 461.
Bochsler, D. und Hug, S., How Minorities Fare Under Referendum: A Cross-National Study, Paper prepared for presentation at the ECPR General Conference, Potsdam, 2009, September 10–12.
Borner, S., Blockierte Schweiz: Wie weiter?, in: L. Steinmann und H. Rentsch, 2005, S. 201 – 220.
Bowler, S. und Donovan, T., Demanding Choices: Opinion, Voting, and Direct Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1998.
Brennan, G. und Lomasky, L., Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference, Cambridge University Press, Cambridge/New York 1993.
Brunetti, A., Der ‘Status-Quo-Bias’ und die bremsende Wirkung des fakultativen Referendums, in S. Borner und H. Rentsch (eds.), Wieviel direkte Demokratie verträgt die Schweiz, Rüegger, Chur/Zürich 1997, S. 167 – 181.
Budge, I., The New Challenge of Direct Democracy, Polity Press, Cambridge (England) 1996.
Curti, Th., Geschichte der Schweizerischen Volksgesetzgebung, J. Dalp'sche Buchhandlung, Bern 1882.
D’Atena, A., Das demokratische Prinzip im System der Verfassungsprinzipien, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, NF 47, 1999, S. 1 – 14.
Dorn, D., Fischer, J.A.V., Kirchgässner, G. und Sousa-Poza, A., Direct Democracy and Life Satisfaction Revisited: New Evidence for Switzerland, Journal of Happiness Studies 9, 2008, S. 227 – 255.
Downs, A., An Economic Theory of Democracy. New York 1957; deutsche Übersetzung: Ökonomische Theorie der Demokratie. Mohr (Siebeck), Tübingen 1968.
Dunn, J., Democracy: The Unfinished Journey: 508 BC to AD 1993, Oxford University Press, Oxford 1992.
Eschet-Schwarz, A., La démocratie semi directe en Suisse: entre la théorie et la réalité: 1879-1987, Canadian Journal of Political Science 22, 1989, S. 739 – 764.
Feld, L.P. und Frey, B.S., Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated, Economics of Governance 3, 2002, S. 87 – 99.
Feld, L.P. und Kirchgässner, G., The Political Economy of Direct Legislation: Direct Democracy in Local and Regional Decision-Making, Economic Policy 33, 2001, S. 329 – 367.
-- , Does Direct Democracy Reduce Public Debt? Evidence from Swiss Municipalities, Public Choice 109, 2001, S. 347 – 370 (zit.: 2001a).
--, Die Rolle des Staates in privaten Governance Strukturen, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 139, 2003, S. 253 – 285.
--, The Role of Direct Democracy in the European Union, in: Ch.B. Blankart und D.C. Mueller (eds.), A Constitution for the European Union, MIT Press, Cambridge (Mass.) 2004, S. 203 – 235.
--, Sustainable Fiscal Policy in a Federal System: Switzerland as an Example, in: H. Kriesi, P. Farago, M. Kohli und M. Zarin (eds.): Contemporary Switzerland: Revisiting the Special Case. Basingstoke, 2005, S. 281 – 328.
--, Zur Effektivität von Schuldenbremsen: Die Erfahrung der Schweiz, Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich 48, 2007, S. 267 – 296.
Feld, L.P. und Matsusaka, J.G., Budget Referendums and Government Spending: Evidence from Swiss Cantons, Journal of Public Economics 87, 2003, S. 2703 – 2724.
--, The Political Economy of Tax Structure: Some Panel Evidence for Swiss Cantons, mimeo, Universität St. Gallen 2003 (zit.: 2003a).
Feld, L.P. und Savioz, M.R., Direct Democracy Matters for Economic Performance: An Empirical Investigation, Kyklos 50, 1997, S. 507 – 538.
Feld, L.P., Fischer, J.A.V. und Kirchgässner, G., The Effect of Direct Democracy on Income Redistribution: Evidence for Switzerland, erscheint in: Economic Inquiry 48, 2010.
Feld, L.P., Kirchgässner, G. und Schaltegger, C.A., Decentralized Taxation and the Size of Government: Evidence from Swiss State and Local Governments, Southern Economic Journal 77, 2010, S. 27 – 48.
Feld, L.P., Schaltegger, C.A. und Schnellenbach, J., On Government Centralization and Fiscal Referendums, European Economic Review 52, 2008, S. 611 – 645.
Fischer, J.A.V., The Impact of Direct Democracy on Society, Dissertation, Universität St. Gallen, Juni 2005.
--, Development of Direct Democracy in Swiss Cantons between 1997 and 2003, Munich Personal RePEc Archive Paper Nr. 16140, Juli 2009.
Freitag, M. und Vatter, A., Direkte Demokratie, Konkordanz und Wirtschaftsleistung: Ein Vergleich der Schweizer Kantone, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 136, 2000, S. 579 – 606.
Frey, B.S. und Kirchgässner, G., Volksabstimmungen, Politische Ökonomie und Diskursethik, Analyse und Kritik 15, 1993, S. 129 – 149.
Frey, B.S. und Stutzer, A., Happiness, Economy and Institutions, Economic Journal 110, 2000, S. 918 – 938.
--, Happiness, and Economics: How the Economy and Institutions Affect Well-Being, Princeton University Press, Princeton/Oxford 2002.
Funk, P. und Gathmann, C., Does Direct Democracy Reduce the Size of Government? New Evidence from Historical Data, 1890-2000, CESifo Working Paper Nr. 2693, 2009.
Gerber, E.R., Legislative Response to the Threat of Initiatives, American Journal of Political Science 40, 1996, S. 99 – 128.
--, The Populist Paradox: Interest Group Influence and the Promise of Direct Legislation, Princeton University Press, Princeton 1999.
Gerber, E.R. und Lupia, A., Term Limits, Responsiveness and the Failures of Increased Competition, in: B. Grofman (ed.), Legislative Term Limits: Public Choice Perspectives, Kluwer, Boston et al. 1996, S. 87 – 99.
Giehl, J., Direkte Demokratie: Verfassungsrechtliche, verfassungshistorische und verfassungspolitische Überlegungen zu einer Einführung plebiszitären Elemente auf Bundesebene, Dissertation, Universität München 1996.
Haskel, J., Direct Democracy or Representative Government; Dispelling the Populist Myth, Westview Press, Boulder/Oxford 2001.
Hufschlag, H.-P., Einführung plebiszitärer Komponenten in der Grundgesetz?, Nomos, Baden-Baden 1999.
Hug, S., Occurrence and Policy Consequences of Referendums, Journal of Theoretical Politics 16, 2004, S. 321 – 356.
--, Policy Consequences of Direct Legislation Theory, Empirical Models and Evidence, erscheint in: Quantity and Quality 44, 2010.
Jung, O., Direkte Demokratie in der Weimarer Republik: Die Fälle ‘Aufwertung’, ‘Fürstenenteignung’, ‘Panzerkreuzerverbot’ und ‘Young-Plan’, Campus, Frankfurt/New York 1989.
--, Grundgesetz und Volksentscheid, Westdeutscher Verlag, Opladen 1994.
Jung, S., Die Logik direkter Demokratie, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2001.
Kaufmann, B., Büchi, R. und Braun, N., The IRI Guidebook to Direct Democracy, 2007 Edition, Initiative and Referendum Institute Europe, Marburg 2006.
Kiewiet, D.R. und Szakaly, K., Constitutional Limitations on Borrowing: An Analysis of State Bonded Indebtedness, Journal of Law, Economics and Organization 12, 1996, S. 62 – 97.
Kirchgässner, G., Hebt ein knapper Wahlausgang die Wahlbeteiligung?, Eine Überprüfung der ökonomischen Theorie der Wahlbeteiligung anhand der Bundestagswahl 1987, in: M. Kaase und H.-D. Klingemann (eds.), Wahlen und Wähler: Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 1987, Westdeutscher Verlag, Opladen 1990, S. 445 – 477.
--, Direct Democracy: Obstacle to Reform?, Constitutional Political Economy 19, 2008, S. 81 – 93.
--, Direkte Demokratie und Menschenrechte, Jahrbuch für direkte Demokratie 1, 2009, S. 66 – 89.
--, Institutionelle Möglichkeiten zur Begrenzung der Staatsverschuldung in föderalen Staaten, Jahrbuch 2009 der Schweizerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht, 2009, S. 59 – 86 (zit.: 2009a).
--, Zu einigen Problemen der direkten Volksrechte, erscheint in: P. Neumann (ed.), Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und internationalen Kontext, Nomos, Baden-Baden 2010.
Kirchgässner, G. und Schulz, T., Erwartete Knappheit oder Mobilisierung: Was führt zu hoher Abstimmungsbeteiligung? Empirische Ergebnisse für die Schweiz, 1981 – 1999, in: J. Falter, O.W. Gabriel und B. Wessels (eds.), Wahlen und Wähler: Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 2002, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S. 515 – 550.
Kirchgässner, G., Feld, L.P. und Savioz, M.R., Die direkte Demokratie: Modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig, Helbing und Lichtenhahn/Vahlen, Basel/München 1999.
Krafczyk, J., Der parlamentarische Finanzvorbehalt bei der Volksgesetzgebung, Duncker und Humblot, Berlin 2005.
Lerche, P., Grundfragen repräsentativer und plebiszitärer Demokratie, in: P.M. Huber, W. Mößle und M. Stock (ed.), Zur Lage der parlamentarischen Demokratie, Mohr (Siebeck), Tübingen 1995, S. 179 – 193.
Lehmbruch, G., Proporzdemokratie: Politisches System und politische Kultur in der Schweiz und in Österreich, Mohr (Siebeck), Tübingen 1967.
Lijphart, A., Typologies of Democratic Systems, Comparative Political Studies 1, 1968, S. 3 – 44.
Linder, W., Schweizerische Demokratie: Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Haupt, Bern et al. 1999.
Lupia, A., Shortcuts Versus Encyclopaedias: Information and Voting Behavior in California Insurance Reform Elections, American Political Science Review 88, 1994, S. 63 – 76.
Lutz, K.G. und Hug, S., A Cross-National Comparative Study of the Policy Effects of Referendums, Universität Zürich/ETH Zürich, Center for Comparative and International Studies (CIS), Working Paper Nr. 22, August 2006.
Matsusaka, J.G., Fiscal Effects of the Voter Initiative: Evidence from the Last 30 Years, Journal of Political Economy 103, 1995, S. 587 – 623.
--, Fiscal Effects of the Voter Initiative in the First Half of the Twentieth Century, Journal of Law and Economics 43, 2000, S. 619 – 650.
--, For the Many or the Few: How the Initiative Process Changes American Government, Chicago University Press, Chicago 2004.
--, Institutions and Popular Control of Public Policy, mimeo, University of Southern California, Marshall School of Business, Los Angeles, CA, November 2006.
Neumann, P., Sachunmittelbare Demokratie – im Bundes- und Landesverfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der neuen Länder, Nomos, Baden-Baden 2009.
Paterna, T., Volksgesetzgebung: Analyse der Verfassungsdebatte nach der Vereinigung Deutschlands, Lang, Frankfurt a.M. et al. 1995.
Pommerehne, W.W., Institutional Approaches to Public Expenditure: Empirical Evidence from Swiss Municipalities, Journal of Public Economics 9, 1978, S. 255 – 280.
Pommerehne, W.W. und Weck-Hannemann, H., Tax Rates, Tax Administration and Income Tax Evasion in Switzerland, Public Choice 88, 1996, S. 161 – 170.
Schaltegger, C.A., The Effects of Federalism and Democracy on the Size of Government: Evidence from Swiss Subnational Jurisdictions, ifo Studien 47, 2001, S. 145 – 162.
Schaltegger, C.A. und Frey, R.L., Finanzausgleich und Föderalismus: Zur Neugestaltung der föderativen Finanzbeziehungen am Beispiel der Schweiz, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 4, 2003, S. 239 – 258.
Scharpf, F.W., Die Politikverflechtungsfalle: Europäische Integration und deutscher Föderalismus im Vergleich, Politische Vierteljahresschrift 26, 1985, S. 323 – 356.
Schneider, F., Der Einfluss von Interessengruppen auf die Wirtschaftspolitik, Haupt, Bern/Stuttgart 1985.
Schneider, F. und Pommerehne, W.W., Macroeconomia della crescita in disequilibrio e settore pubblico in espansione: il peso delle differenze istituzionali, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali 33, 1983, S. 306 – 420.
Stadelmann-Steffen, I. und Vatter, A., Happy about what? Direct democracy and individual satisfaction in Switzerland“, Paper presented at the ECPR Joint Sessions, Workshop ,The Interrelationship between Institutional Performance and Political Support in Europe: Discussing Causes and Consequences‘, Münster, April 2010.
Steinmann, L. und Rentsch, H., Diagnose: Wachstumsschwäche, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2005.
Stigler, G.J., Why have the Socialists Been Winning?, ORDO 39, 1979, S. 61 – 68.
Toffler, A., The Third Wave, William Morrow, New York 1980.
Stutzer, A., Eine ökonomische Analyse menschlichen Wohlbefindens, Shaker, Aachen 2003.
Vatter, A. und Freitag, M., Die Janusköpfigkeit von Verhandlungsdemokratien: Zur Wirkung von Konkordanz, direkter Demokratie und dezentraler Entscheidungsstrukturen auf den öffentlichen Sektor der Schweizer Kantone, Swiss Political Science Review 8, 2002, S. 53 – 80.
Wittmann, W., Die Schweiz: Ende eines Mythos, Wirtschaftsverlag Langen Müller/Herbig, München 1998.
--, Direkte Demokratie: Bremsklotz der Revitalisierung. Huber, Frauenfeld.
Zimmermann, K.F., (2006) (ed.), Deutschland - was nun?, Reformen für Wirtschaft und Gesellschaft, dtv, München 2001.
VIII. Verwandte Themen
Bürgerrechte | Demokratie | Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Menschenrechte | Positives Recht | Rechtsstaat | Repräsentation | Staat | Souveränität | Verfassung