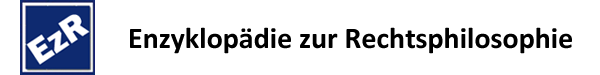Strafe
Erstpublikation: 07.04.2011
I. Einführung
1
Die Frage nach dem Verhältnis von individueller Freiheit und öffentlicher Strafe hat sich erst stellen können, seit die Freiheit des Einzelnen im 17. Jahrhundert zum Ausgangspunkt staatstheoretischen Denkens geworden ist. Sie betrifft zunächst das Recht der Staatsgewalt, mit der Strafe überhaupt in die Freiheit des Einzelnen einzugreifen, schon durch ihre Androhung auf bestimmte Verhaltensweisen, erst recht aber natürlich mit ihrer Verhängung und Vollstreckung. Sie fächert sich dann in eine ganze Reihe von Aspekten auf. Auch wenn solches Recht prinzipiell anerkannt wird, bleiben Art und Maß zulässiger Strafe näher zu bestimmen. So verbieten heute etwa Art. 5 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 und Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 jede grausame, unmenschliche oder erniedrigende Strafe. Damit hängt zusammen, welche Aufgabe die Strafe allgemein und im Einzelfall verfolgen soll und darf, eine Auseinandersetzung, die bis in die Antike zurückreicht. Der legitime Zweck entscheidet zugleich über den möglichen Anwendungsbereich der Strafe, darüber, auf welche Verhaltensweisen sie sich legitimerweise beziehen darf. Und schließlich ist unter dem Aspekt der Freiheit des Einzelnen auch von Bedeutung, dass er wissen kann, was ihm bei Strafe ver- oder geboten ist und was nicht.
2
Alle diese Fragen sind in den letzten Jahrhunderten Gegenstand philosophischer Reflexion gewesen und werden zum Teil weiterhin kontrovers beantwortet. Die sie betreffende Literatur ist längst unübersehbar geworden.
II. Hauptteil
1.
3
Einer Begründung bedarf das Recht zu strafen vor allem dort, wo das Individuum als dem Staatswesen zeitlich oder doch sachlich vorgegeben gedacht wird, wie in der neuzeitlichen Lehre vom Staats-, Gesellschafts- oder Sozialvertrag, das heißt bei der Vorstellung, dass das Gemeinwesen aus einer Übereinkunft der in ihm vereinigten Individuen hervorgegangen oder seine Aufgabe doch entsprechend zu begründen und zu begrenzen sei. Lässt sich sagen, dass der Einzelne mit dem Eintritt in den Staatsverband nicht nur seine (natürliche) Freiheit aufgibt, sondern die mit der Strafe verbundene Einbuße an Lebensgütern (bis zum Verlust des Lebens) zumindest hinnimmt?
4
Die Antwort bereitet Schwierigkeiten, soweit es um die Stellung des von der Strafe betroffenen Rechtsbrechers geht. Das zeigt sich schon bei Hobbes, der den ersten systematischen Entwurf einer solchen Vertragslehre entwickelt hat. Hier gibt der Einzelne mit dem Abschluss des Staatsvertrages (oder dem Eintritt in einen Staatsverband) zwar sein Recht auf Selbstbestimmung auf und überträgt es ohne jede Einschränkung auf die Zentralgewalt, auch die Entscheidung über Leben und Tod. Denn nur auf solchem Wege soll er Schutz gegenüber den Gefahren erlangen können, die ihn, im Naturzustand auf sich allein gestellt, bedrohen, wie vor allem die eines gewaltsamen Todes (1651, c. 17). Insoweit folgt ihm Pufendorf (1688, 7 I 4). Aber das führt im Grenzfall in einen ausweglosen Konflikt. Geht die Gefahr für das Leben von eben dem Staat aus, der es schützen soll, so muss die Gehorsamspflicht des Betroffenen enden. Das bedeutet nichts anderes als die Rückkehr in den (natürlichen) Kriegszustand. Dass Hobbes dem Souverän auch dann noch das Recht zugesteht, jenen mit dem Tode zu bestrafen (1651, c. 18, 21), lässt sich nicht mehr begründen. Radikaler noch war Rousseau: Für ihn hieß der Abschluss des Gesellschaftsvertrages, dass man, um nicht Opfer eines Mörders zu werden, bereit war zu sterben, wenn man selbst zu einem werden sollte. Aber gleichzeitig sagt er auch, dass jeder, der das gesellschaftliche Recht (droit social) angreift, aufhöre, dessen Glied zu sein, weshalb ihm gegenüber Kriegsrecht gelte (1762, II 5). Der Vorgang der Bestrafung vollzieht sich damit, gegenüber dem Betroffenen, in einem rechtsfreien Raum. Das klingt schließlich auch noch bei Kant an, wenn er das öffentliche Verbrechen dahin definiert, dass es denjenigen, der es begeht, „unfähig macht, Staatsbürger zu sein“ (1798, 225). Damit entfielen an sich alle Gründe, ihm gegenüber Gerechtigkeit zu üben: Die Strafe wäre ein bloßer Akt der Selbstverteidigung.
5
Andere kontraktualistische Ansätze haben hier nicht weitergeführt (näher Seelmann 1991, S. 441 ff). Sie hatten schon mit der Schwierigkeit zu kämpfen, verständlich zu machen, wie ein von den ursprünglich Beteiligten (wirklich oder hypothetisch) eingegangener Vertrag nachfolgende Generationen sollte binden können. Pufendorf wollte sich insoweit darauf stützen, dass jene den Staat auch für ihre Nachfolger errichtet hätten (1688, 7 II 20), ohne zu sagen, kraft welcher Vollmacht sie dies hätten tun können. Andere, wie Locke und Rousseau, gingen davon aus, dass sich jeder der Staatsgewalt unterwerfe, der sich auch nur auf ihrem Gebiet aufhält (Locke 1689, II § 119; Rousseau 1762, II 5). Aber das sind, wie bereits Hume eingewandt hat, wirklichkeitsfremde Konstruktionen (1739, S. 547 f.), nicht anders, als die schon bei Grotius zu findende Erwägung, der Rechtsbrecher willige durch die Begehung des Deliktes auch in seine Bestrafung ein (1625, 20 II 3). Ohne realen Bezug bleibt auch der zuerst andeutungsweise bei Kant und dann bei Hegel anzutreffende Gedanke, dass der Rechtsbrecher als Vernunftwesen seine Bestrafung gewollt haben müsse (Seelmann 1995, S. 123 ff). Durchgesetzt hat sich demgegenüber die nüchterne Einsicht, dass sich der Mensch immer schon in einem Staat vorfindet und dass es allerdings in seinem Interesse ist, wenn eine Regierung für Gerechtigkeit sorgt (so in der Sache bereits Pufendorf 1688, 8 III 5; sodann Hume 1739, S. 544 ff.; mit Bezug auf ihn auch Bentham 1789, c. I n. 36). Das Recht zu strafen bedarf danach prinzipiell keiner anderen Begründung als die Staatsgewalt insgesamt, und das ist im Wesentlichen der Stand der Dinge bis heute. Es kann nur noch darum gehen, wie es ausgeübt wird. Umso wichtiger werden damit die Folgefragen.
2.
6
An erster Stelle steht die Notwendigkeit, den Grund zu bestimmen, aus dem im Einzelfall Strafe verhängt werden darf.
7
Dabei hat sich in der abendländischen Tradition, über Jahrhunderte hinweg, das Prinzip durchgesetzt, dass allein die Schuld des Rechtsbrechers eine Bestrafung rechtfertigen kann (Stübinger 2000). Dieser Satz beansprucht heute, im Blick auf die Freiheitsrechte des Betroffenen, verfassungsmäßigen Rang. Er bildet zugleich den Angelpunkt der strafrechtlichen Zurechnung, die sich nunmehr in allen ihren Teilen um die Frage dreht, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Grade jemand für einen Rechtsbruch verantwortlich zu machen ist. Daneben hat sich freilich, im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts, eine zweite «Spur» strafrechtlicher Sanktionen herausgebildet, von Maßregeln, die nicht weniger tief in die Freiheit des Einzelnen eingreifen können, aber eben nicht als Strafe gelten und auch nur auf andere Weise zu rechtfertigen sind.
3.
8
Auch wenn der strafweise Eingriff in die Freiheit des Einzelnen im Prinzip an dessen Schuld anknüpft, ist noch nicht entschieden, welcher Art er sein und welches Maß er haben darf.
9
Was den Charakter der Strafe anbetrifft, so war natürlich niemals zweifelhaft, dass sie in der Zufügung eines Übels bestehen müsse. Ihre Schwere aber hängt zunächst davon ab, welche Lebensgüter sie berührt. Dabei sind die grausamen Lebens- und Leibesstrafen des späten Mittelalters nur sehr allmählich zurückgedrängt worden. Schon Beccaria etwa hat in seinem Hauptwerk „Dei Delitti e delle Pene“, das in kürzester Zeit, in 22 Sprachen übersetzt, zum Gemeingut der zivilisierten Welt geworden ist, die Todesstrafe ausschließen wollen: weil der Einzelne nur ein Mindestmaß seiner Freiheit auf den Staat übertragen habe (1764, XXVIII). Er ist damit aber nicht nur auf den Widerspruch vieler Zeitgenossen, nicht zuletzt Kants (1798, 232), gestoßen. Es gibt diese Strafe vielmehr noch immer in weiten Teilen der Erde. Man kann die weitere Entwicklung des Systems der strafrechtlichen Sanktionen im Ganzen trotzdem als die schrittweise Durchsetzung des rechtsstaatlichen Prinzips der Verhältnismäßigkeit sehen, wonach Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre des Einzelnen nicht weiter gehen dürfen, als ihr Zweck es erfordert. Körperliche Strafen hat das 19. Jahrhundert in der westlichen Hemisphäre weitgehend abgeschafft. Die mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe verbundenen Deprivationen sind zunehmend beseitigt, sie selbst ist wesentlich zurückgedrängt worden. Zum Ausdruck kommt darin auch ein Wandel der Auffassungen über den Sinn der Strafe: ob sie dem Rechtsbrecher die Übeltat (nur) vergelten, ihn (auch) von weiteren Taten abhalten oder auf die Allgemeinheit einwirken soll. Darüber hat es niemals Einigkeit gegeben (vgl. nur Neumann/Schroth 1980; Stratenwerth/Kuhlen 2004, S. 3 ff.).
10
Verändert haben sich zugleich die Vorstellungen über das gerechte Maß der Strafe. Hier ist zuerst Montesquieu für ein angemessenes Verhältnis, die „juste proportion“, zum Verbrechen eingetreten (1748 l. VI c. XVI), und hat es näher dahin bestimmt, dass die Strafe der besonderen Natur des Deliktes entsprechen müsse: Es sollte ein «Triumph der Freiheit» sein, wenn die Strafe auf diese Weise nicht mehr von den Launen des Gesetzgebers abhing. Praktisch bedeutete das für ihn die Einteilung der Straftaten in vier Gruppen, die auf eine Einschränkung der Strafbarkeit, bei den Delikten gegen den Einzelnen letztlich aber auf das Talionsprinzip hinauslief (l. XII c. IV). Auf ihn hat sich wiederum Beccaria bezogen (1764, II, VI). Auch nach Kant konnte nichts anderes als das «Prinzip der Gleichheit», der Wiedervergeltung, über die «Qualität und Quantität der Strafe» entscheiden (1798, S. 227 f.). Wie Delikt und Sanktion, ihrer Natur nach verschieden, bei diesem Vergleich gewichtet werden sollten, blieb dabei freilich offen – eine für Hegel ohnehin nur annähernd zu lösende Aufgabe (1821, § 101 Anm.). Grundsätzlich kann wieder nur das Maß der Schuld auch über das der ihr entsprechenden Strafe entscheiden. Dabei hat sich auch insoweit über längere Zeiträume, in der Gesetzgebung wie in der Praxis, die Tendenz zur Strafmilderung durchgesetzt, weniger als ein bewusst angestrebtes Ziel, als im Gefolge größerer Sensibilität der Allgemeinheit, nicht zuletzt im Blick auf den Rechtsbrecher.
4.
11
Eine weitere Facette des Verhältnisses von Freiheit und Strafgerechtigkeit kommt mit dem Bedürfnis ins Spiel, den Einzelnen auch gegenüber möglichem Missbrauch der Strafgewalt durch den Machthaber zu schützen. Dem dient das Prinzip der Gesetzesherrschaft: Regierungsgewalt darf, wie es zuerst Locke formuliert hat, nur nach festen und öffentlich bekannt gemachten Gesetzen ausgeübt werden, damit jedermann in deren Grenzen ruhig und sicher leben kann (1689, II 137). Montesquieu stimmt dem zu, wenn er den Richter auf das Strikteste an das Gesetz binden will, mit der vielzitierten Konsequenz, das seine Macht „en quelque façon nulle“ sein sollte; nur dann hat der Bürger jene politische Freiheit, die aus dem Bewusstsein hervorgeht, niemanden fürchten zu müssen (1748, l. XI, c. VI). Betont wird das Prinzip wiederum auch von Beccaria (1764, III). Nur wenig später haben amerikanische Einzelstaaten es erstmals zu verfassungsrechtlichem Rang erhoben (näher Schreiber 1976, S. 63 ff.). Vor allem aber wird es, mit dem Anspruch auf weltweite Geltung, in Art. 8 der Menschen- und Bürgerrechtserklärung von 1789 proklamiert: „Nul ne peut être puni qu’en vertue d’une loi établie et promulgée antérieurement au délit et légalement appliquée“. Für Anselm von Feuerbach (1799, S. 63), den Begründer der neueren deutschsprachigen Strafrechtswissenschaft, folgte der Satz dann aus dem Zweck des Strafgesetzes, das Verbrechen durch die Androhung von Strafe zu verhüten. Von ihm stammt auch die nunmehr gebräuchliche latinisierte Fassung „nullum crimen, nulla poena sine lege“ (1801, § 24). Im Prinzip anerkannt ist die Regel heute, nach ihrer Missachtung vor allem während der NS-Gewaltherrschaft (näher Schreiber 1976, S. 191 ff.), in praktisch allen Kulturstaaten der Erde (zu ihrer Begründung in der Gegenwart Rawls 1975, S. 265 ff.). Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 enthält sie ebenso (Art. 11 Ziff. 2) wie die Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 7 Ziff. 1) und wie einzelstaatliche Verfassungen (z.B. Art. 103 Abs. 2 GG).
5.
12
Die Aufgabe jener Gewalt, die der Mensch im Naturzustand hatte und die er in die Hände der Gesellschaft gegeben hat, kann hier nach Locke keine andere sein als dort: „das Leben, die Freiheit und den Besitz der Glieder“ des Gemeinwesens zu erhalten (1689, II 171). Das gilt selbstverständlich auch für die Strafgewalt. Darin aber liegt schließlich noch ein weiterer kritischer Maßstab für den mit ihr verbundenen Eingriff in die Freiheit des Einzelnen, in Gestalt der Frage, welche Verhaltensweisen überhaupt bei Strafe ver- oder geboten sein dürfen. Sie stellt sich mit aller Schärfe dann, wenn das Recht mit Kants berühmter Definition darauf beschränkt wird, die Freiheit eines jeden mit der Freiheit jedes anderen in Einklang zu bringen (1793/94, 234). So hat denn auch Feuerbach, als getreuer Kantianer, „das höchste Princip für alles, was äusserlich recht ist“, dahin formuliert: „daß die Freiheit eines jeden mit der Freiheit aller bestehe“ (1799,S. 26). Hier hat das über zwei Jahrhunderte bis zur Gegenwart andauernde Bemühen der Wissenschaft seinen Ausgang genommen, den möglichen Gegenstand strafrechtlich sanktionierter Verbote und Gebote genauer zu bestimmen (vgl. nur Amelung 1972). Kern der Auseinandersetzung ist dabei heute die Frage, ob Schutzgüter des Strafrechts nur solche sein dürfen, die sich als Interessen des Individuums nachweisen lassen (Hassemer 1989, 91), oder ob es, sehr viel allgemeiner, um die am jeweiligen geschichtlichen Ort als unabdingbar geltenden Regeln menschlichen Zusammenlebens geht (Stratenwerth 2007, S. 107 ff.). Von der einen wie der anderen Position aus steht jedoch außer Frage, dass rechtliche – und damit auch strafrechtliche – Einschränkungen der Freiheit des Einzelnen im Verfassungsstaat der Gegenwart nur im Interesse des menschlichen Zusammenlebens, nicht zur Durchsetzung einer bestimmten Moral zu rechtfertigen sind (näher Forst 1994).
III. Zusammenfassung
13
Die öffentliche Strafe bildet einen der schwersten möglichen Eingriffe der Staatsgewalt in die Freiheit des Einzelnen. Das erfordert, soll sie als gerecht erscheinen, eine ganze Reihe von Sicherungen. Eine erste liegt in dem Grundsatz, dass Strafe Schuld voraussetzt und deren Maß nicht überschreiten sollte. Der mit der Strafe verbundene Vorwurf ist sodann nur zu rechtfertigen, wenn das Gesetz sie zuvor auf das entsprechende Verhalten angedroht hat. Rechtsstaatliche Gesichtspunkte entscheiden schließlich auch über die Art von Verhaltensweisen, die legitimerweise bei Strafe verboten oder geboten werden dürfen.
IV. Bibliographie
(Ältere, häufiger publizierte Werke werden, soweit möglich, nach ihrer Gliederung oder der Originalpaginierung zitiert)
Amelung K., Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1972.
Beccaria Cesare, Dei delitti e delle pene [1764], Milano 2001; dt. Über Verbrechen und Strafe, Aalen 1990.
Bentham Jeremy, A Fragment on Government [1789/1823], ed. Wilfrid Harrison, Oxford 1948.
von Feuerbach P. J.A., Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts [1799], Neudruck Aalen 1966.
—, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden Peinlichen Rechts, Giessen 1801.
Forst Rainer, Kontexte der Gerechtigkeit, Frankfurt a.M. 1994.
Grotius Hugo, De jure belli ac pacis [1625]; dt. Vom Recht des Krieges und des Friedens, hrsgg. von Walter Schätzel, Tübingen 1950.
Hassemer W., Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre, in: FS Arthur Kaufmann, Heidelberg 1989, S. 85 ff.
Hefendehl / von Hirsch / Wohlers (Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie, Baden-Baden 2003 (E).
Hegel G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts [1821], ed. Hoffmeister, 4. Aufl. Hamburg 1955
Hobbes Thomas, Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth [1651], reprinted Oxford 1909.
Hume David, A Treatise of Human Nature [1739], Nachdruck, ed. Selby-Bigge, Oxford 1955.
Kant I., Die Metaphysik der Sitten [1798], in: Werke ed. Weischedel, Bd. IV, Darmstadt 1956, S. 303 ff.
—, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis [1793/94], in: Werke, ed. Weischedel, Bd. VI, Darmstadt 1964, S. 125 ff.
Locke John, Two treatises of Government [1689], ed. Peter Laslett, Oxford 1960.
Montesquieu, De l’esprit des lois [1748], Paris 2008.
Neumann / Schroth, Neuere Theorien von Kriminalität und Strafe, Darmstadt 1980.
Pufendorf Samuel, De jure naturae et gentium libri octo [editio ultima 1688], Vol. I (photographische Reproduktion) London 1934.
Rawls John, A Theory of Justice, Cambridge 1971; dt. Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a.M. 1975.
Schreiber H.-L., Gesetz und Richter, Frankurt a.M. 1976.
Seelmann K., Vertragsmetaphern zur Legitimation des Strafens im 18. Jahrhundert, in: FS Sten Gagnér, München 1991, S. 441 ff.
—, Anerkennungsverlust und Selbstsubsumtion, Freiburg/München 1995.
Stratenwerth G., Freiheit und Gleichheit, Bern 2007.
Stratenwerth / Kuhlen, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 5. Aufl. Köln/Berlin/München 2004.
Stübinger, Stephan, Schuld, Strafrecht und Geschichte, Köln/Weimar/Wien 2000.
V. Verwandte Themen
Beccaria, Cesare | Feuerbach, Paul Johann Anselm Ritter von | Handlung | Hegel, Georg Wilhelm Friedrich | Hume, David | Hobbes, Thomas | Kant, Immanuel | Pufendorf, Rechtsgefühl | Rückwirkung | Rousseau, Jean-Jacques | Schuld | Strafverfahren | Zurechnung