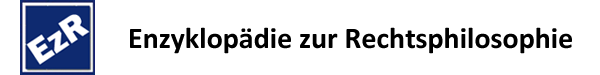Gleichheit
Erstpublikation: 06.04.2011
- Einleitung
- Der Begriff der Gleichheit
- Der Egalitarismus
- Die Kritik am Egalitarismus
- Der Humanismus als Alternative zum Egalitarismus
- Einigung oder Einsicht
- Bibliographie
- Verwandte Themen
I. Einleitung
1
Ein einziger und dazu noch simpler Grundgedanke steht im Herzen dieses Artikels. Es ist ein Grundgedanke sprachlogischer Art. Er lautet, dass man einen eigentlichen Gebrauch des Gleichheitsbegriffes von einem bloß rhetorischen oder redundanten Gebrauch unterscheiden muss.
2
Der Mainstream der politischen Gegenwartsphilosophie von John Rawls über Ronald Dworkin zu Amartya Sen begreift Gerechtigkeit als Gleichheit. Eine gerechte Gesellschaft müsse all ihren Mitgliedern ein gleichermassen gutes Leben ermöglichen. Nimmt man die sprachlogische Unterscheidung zwischen Gleichheit im eigentlichen und Gleichheit im redundanten Sinne ernst, dann steht der Mainstream mit seiner egalitaristischen Grundüberzeugung ohne gute Begründung und ohne besondere Plausibilität da.
3
Dieser Artikel hat fünf Teile. Der erste Teil analysiert den Gleichheitsbegriff über die Ununterscheidbarkeit verschiedener Objekte gemessen an einem relevanten Standard. Der zweite Teil stellt den Egalitarismus als einen Gerechtigkeitsansatz vor, welcher Gleichheit für ein zentrales und unabgeleitetes Ziel von Gerechtigkeit hält. Der dritte Teil bringt die Kritik am Egalitarismus. Der Hauptvorwurf an den Egalitarismus lautet auf Verwechslung der auf Allgemeinheit aufsitzenden redundanten Gleichheit mit „Gleichheit proper“. Der vierte Teil erkundet, wie die Alternative zum Egalitarismus aussieht, und fragt nach der Rolle von Gleichheit in einer nonegalitaristischen Gerechtigkeitstheorie. Überschaut man die Rolle von Gleichheit, dann lässt sich das, was für den Egalitarismus zu sprechen scheint, nonegalitaristisch einholen. Der fünfte Teil wendet sich schliesslich dem Problem der Rechtfertigung zu und damit einem wesentlichen Einwand, den Egalitaristen zur Verteidigung ihrer Position gegen den Nonegalitarismus gerne erheben.
II. Der Begriff der Gleichheit
4
Dem Gleichheitsbegriff nähert man sich am besten über Kontexte, in denen er unproblematisch funktioniert, wie deskriptive Kontexte der Messung verschiedener Objekte auf ihr Gewicht, ihre Länge oder Geschwindigkeit hin.
1. Deskriptive Gleichheit
5
Gleichheit lässt sich in deskriptiven Kontexten fassen als Ununterscheidbarkeit mindestens zweier Objekte in einer relevanten Hinsicht oder gemessen an einem relevanten Standard (So definiert denn auch Peter Westen den Gleichheitsbegriff in seinem Buch Speaking of Equality (Princeton 1990, z.B. S. 39), der derzeit gründlichsten Analyse des Gleichheitsbegriffes.).
6
Der Gleichheitsbegriff steht damit zwischen dem Begriff der Identität, der Ununterscheidbarkeit in jeder Hinsicht (z.B. Gottlob Freges Morgen- und Abendstern), und dem Begriff der Ähnlichkeit, der Fast-Ununterscheidbarkeit in relevanter Hinsicht (z.B. der Geschmack von Pfirsichen und Nektarinen).
7
Stellen Sie sich vor, Sie backen einen „Pfundkuchen“, in den jeweils ein Pfund Mehl, Zucker und Butter gehören. Sie nehmen eine digitale Küchenwaage und schütten zunächst so viel Mehl auf die Waage, dass die Waage 500 Gramm anzeigt. Sie wiederholen diesen Vorgang mit dem Zucker und der Butter. Sie haben dann gleich viel Mehl, Zucker und Butter. Mehl, Zucker und Butter sind ununterscheidbar gemessen an dem für das Backen eines Pfundkuchens relevanten Standard „ein Pfund auf der Küchenwaage“.
8
Anstatt Gewichtsgleichheit mit einer nicht-komparativen Waage, wie der digitalen Küchenwaage, zu messen, kann man sich auch einer komparativen Waage, der Balkenwaage orientalischer Märkte zum Beispiel, bedienen. Die komparative Waage nimmt uns den Vergleich der Messergebnisse ab, sagt uns dafür aber nichts über das absolute Gewicht der gewogenen Objekte. Für das Backen eines Pfundkuchens ist eine komparative Waage daher nicht ohne weiteres geeignet.
2. Normative Gleichheit
9
Normative Gleichheit lässt sich genauso fassen wie deskriptive Gleichheit, nämlich als Identität mindestens zweier Objekte gemessen an einem geeigneten Standard. Nur handelt es sich bei diesem Standard nun um einen präskriptiven Standard, der besagt, was sein soll, und nicht mehr um einen deskriptiven, der nur misst, was der Fall ist. Dass alle Menschen normativ gleich sind, heißt dann, dass sie gleich sind in dem, was für sie sein soll, wie sie behandelt werden sollen oder was sie selbst zu tun haben, in ihren Rechten und Pflichten also.
10
Wie bei deskriptiver Gleichheit muss man auch bei normativer Gleichheit dazu sagen, gemessen an welchem Standard genau man verschiedene Objekte für gleich befindet. Der elliptische Charakter vieler Gleichheitsforderungen – man denke nur an „Alle Menschen sind gleich.“ oder „Chancengleichheit“ oder „Gleichheit vor dem Gesetz“ – war und ist denn auch oft Ursache von Verwirrung.
3. Komparative versus absolute Standards
11
Die Standards zur Messung normativer Gleichheit können, wie im deskriptiven Fall auch, komparativer oder nicht-komparativer Art sein (Der locus classicus für die Unterscheidung zwischen komparativen und nicht-komparativen Gerechtigkeitsstandards ist Joel Feinbergs Aufsatz Noncomparitive Justice. In: Philosophical Review 83 (1974), S. 297-338.).
12
Nicht-komparative oder absolute präskriptive Standards geben absolute Schwellenwerte für alle betrachteten Objekte vor. Ein Beispiel eines nicht-komparativen präskriptiven Standards der Verteilung eines Kuchens an alle Anwesenden ist: „Jeder Anwesende soll satt werden.“
13
Ein Beispiel eines komparativen oder relationalen präskriptiven Standards der Kuchenverteilung ist dagegen: „Alle Anwesenden sollen ein gleich grosses Stück Kuchen erhalten.“
4. Redundante versus eigentliche Gleichheit
14
Nur komparative präskriptive Standards zielen auf Gleichheit. Ihnen kommt es auf die Ununterscheidbarkeit der betrachteten Objekte in der relevanten Hinsicht an. Nicht-komparative Standards zielen gar nicht auf Gleichheit. Ihnen kommt es auf die Erfüllung gewisser absoluter Messwerte für alle Objekte an. Die mit dieser Erfüllung einhergehende Ununterscheidbarkeit der Objekte bezogen auf die absoluten Messwerte ist nur eine Begleiterscheinung der Erfüllung dieser Messwerte für alle. Gleichheit sitzt hier auf Allgemeinheit auf. Die Gleichheitsterminologie ist hier redundant. Es geht nichts verloren, wenn man anstelle von: „Alle Menschen sind normativ gleich darin, dass sie genug zu essen haben sollen.“ einfach nur sagt: „Alle Menschen sollen genug zu essen haben.“
15
Im komparativen Fall ist die Gleichheitsterminologie dagegen nicht redundant. Man kann zwar anstelle von: „Alle Kinder sind normativ gleich darin, dass sie ein gleich grosses Stück Kuchen erhalten sollen.“ auch einfach sagen: „Alle Kinder sollen ein gleich großes Stück Kuchen erhalten.“, aber das „gleich“ in „gleich großes Stück Kuchen“ wird man nicht los.
16
Wir können damit einen redundanten oder rhetorischen Gebrauch der Gleichheitsterminologie von ihrem eigentlichen oder strengen Gebrauch unterscheiden.
5. Gleiche gleich, Ungleiche ungleich behandeln
17
Der Aristotelische Grundsatz, dass man gleiche Personen gleich und ungleiche Personen ungleich behandeln soll, gilt gemeinhin als Grundsatz der formalen Gerechtigkeit. Im Begriff der Gerechtigkeit stecke bereits ein Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit.
18
Der Grundsatz formaler Gerechtigkeit, der absolute wie komparative Gerechtigkeitsstandards unter sich begreifen können muss, ist aber höchstens ein Gleichheitsgrundsatz im Allgemeinheitssinne. Er fordert dazu auf, dass alle, die in den Anwendungsbereich eines Gerechtigkeitsstandards fallen (die also gleich sind darin, dass sie in den Anwendungsbereich fallen) so, wie der Standard es vorschreibt, behandelt werden (ihre Behandlungen sich also darin gleichen, dass sie dem Standard gemäss erfolgen). Härter gesagt, ist der Grundsatz formaler Gerechtigkeit nur ein Gleichheitsgrundsatz im redundanten Sinne, also kein Gleichheitsgrundsatz. Es ist irreführend, Gerechtigkeit formal über Gleichheit zu fassen und damit zu suggerieren, Gerechtigkeit sei prinzipiell etwas Relationales, etwas, das mit der Behandlung der einen Personen im Verhältnis zu anderen Personen zu tun hat.
19
Will man einen Grundsatz formaler Gerechtigkeit ausweisen, sollte man sich daher lieber auf die „Suum Cuique“-Formel zurückbesinnen. Gerecht ist danach eine Handlung, die jedem gibt, was ihm zukommt, oder die Güter und Lasten nach relevanten Gründen verteilt.
III. Der Egalitarismus
20
Eine Konzeption von Gerechtigkeit ist egalitaristisch, wenn sie Gerechtigkeit wesentlich über Gleichheit versteht, Gleichheit also als ein zentrales und unabgeleitetes Ziel von Gerechtigkeit ansieht, als moralischen Selbstzweck oder Eigenwert. Anders gesagt, bestimmt eine egalitaristische Gerechtigkeitstheorie das einem jeden gerechtermaßen Zustehende wesentlich relational oder komparativ, mit Blick auf andere, und nicht absolut, unabhängig von anderen. Die Standardform von Gerechtigkeitsansprüchen im Egalitarismus ist demnach: Person P steht Gut G zu, weil andere Personen G auch haben oder bekommen haben. In den Worten von Derek Parfit: „Für eine wirklich egalitaristische Position hat Gleichheit intrinsischen Wert, ist Gleichheit an sich gut. ... Dem Egalitarismus geht es um Relationen, darum auf welchem Niveau im Vergleich zu anderen sich eine jede Person befindet.“ (S. 86 bzw. 97 aus Parfit, Derek: Gleichheit und Vorrangigkeit. In: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Frankfurt 2000, S. 81-106).
1. Hinsicht der Gleichheit
21
Die Hinsicht, in welcher der moderne Egalitarismus Gleichheit unter den Menschen verwirklichen will, ist gewöhnlich ihre Möglichkeit, gut zu leben, ihre Lebensaussichten. Die sogenannte „Equality-of-What?”-Debatte kreist um die Frage, wie man diese Hinsicht genauer interpretiert. Die einen wollen die Gleichheit der Lebensaussichten festmachen an der Verfügung über gleich viele Ressourcen („equality of resources“: Ronald Dworkin, Eric Rakowski, Philippe Van Parijs) oder Grundgüter (John Rawls). Die anderen bestimmen die Gleichheit der Lebensaussichten als Gleichheit der Gelegenheit zur Erlangung von Wohlergehen („equality of opportunity to welfare“/ „access to advantage“: Richard Arneson, Gerald Cohen, John Roemer). Wieder andere interpretieren das Gleichheitsideal als Gleichheit der Funktionsfähigkeit („equality of capability to function“: Amartya Sen) (Für einen Überblick über die „Equality-of-What?“-Debatte vgl. Cohen, Gerald: Equality of What? On Welfare, Goods, and Capabilities. In: Nussbaum, Martha/Sen, Amartya (Hrsg.): The Quality of Life. Oxford 1993, S. 9-29).
22
Die Hinsicht „Lebensaussichten“ (wie auch immer genauer interpretiert) erfährt im Egalitarismus allerdings meist noch eine Einschränkung auf unverdiente Lebensaussichten, da Menschen mitunter selbst etwas dafür könnten, wie gut oder schlecht sie im Vergleich zu anderen dastehen. Wenn die einen hart arbeiten oder sparen, während die anderen „sich auf die faule Haut legen“ oder „das Geld zum Fenster herausschmeißen“, und die einen fortan über bessere Lebensaussichten verfügen als die anderen, dürfe dies nicht als Verletzung der normativ gebotenen Gleichheit gelten, sondern sei moralisch ganz in Ordnung. Für ihre Entscheidungen müssten die Menschen schon selbst einstehen. Egalisiert müsse nur werden, was Menschen einfach so zufällt, zum Beispiel die Gaben der Natur, der äußeren wie der inneren, Erbschaften oder Geschenke.
2. Gleichheit nicht der einzige Eigenwert
23
Gleichheit muss nicht der einzige Eigenwert sein, den eine egalitaristische Gerechtigkeitstheorie verfolgt. Typischerweise verbindet eine egalitaristische Theorie den Eigenwert von Gleichheit mit dem Eigenwert von Wohlfahrt. Denn Gleichheit unter den Menschen lässt sich schließlich auch dadurch schaffen, dass man alle umbringt, wie in William Frankenas Beispiel: „if a ruler were to boil his subjects in oil, jumping in afterwards himself, it would be ... no inequality of treatment.“ (S. 17 aus Frankena, William: The Concept of Social Justice. In: Brandt, Richard (Hrsg.): Social Justice. Englewood Cliffs 1962, S. 1-29).
24
Dieses Beispiel macht die Notwendigkeit des Übergangs von einem „reinen“ Egalitarismus mit nur dem einen Eigenwert Gleichheit zu einem „pluralistischen“ Egalitarismus mit zumindest einem weiteren Eigenwert für Wohlfahrt deutlich.
25
Der pluralistische Egalitarismus sollte zudem vielleicht „moderat“ genug sein, um im Konfliktfall „Gleichheit versus Wohlfahrt“ nicht immer Gleichheit Trumpf sein zu lassen, sondern Abstriche an Gleichheit um einer höheren Lebensqualität für alle willen hinzunehmen. Ein berühmtes Beispiel für einen moderaten, pluralistischen Egalitarismus ist John Rawls’ Abmilderung des Gleichheitsprinzips zum Differenzprinzip, das Ungleichheiten, welche die absolute Position der am schlechtest Gestellten anheben, als gerecht ausweist (Die Unterscheidungen “pluralistisch versus rein” und “moderat versus stark” gehen terminologisch wiederum auf Parfit, Derek (siehe Rz. 20), S. 85 bzw. 102 zurück.).
26
Damit ist das Grundmuster der egalitaristischen Gerechtigkeitskonzeption vorgestellt: Der Egalitarismus kombiniert in der Regel, als pluralistischer Egalitarismus, ein Gleichheitsprinzip bezüglich unverdienter Lebensaussichten mit einem Wohlfahrtsprinzip und nimmt moderaterweise im Konfliktfall „Gleichheit versus Wohlfahrt“ gewisse Abstriche an Gleichheit um einer größeren allgemeinen Wohlfahrt willen hin.
IV. Die Kritik am Egalitarismus
27
Vier Einwände gegen den Egalitarismus lassen sich in der neuen „Why-Equality?“-Debatte unterscheiden. Der erste und wichtigste Vorwurf an den Egalitarismus lautet auf Verwechslung von Allgemeinheit mit Gleichheit. Dieser Text beschränkt sich auf eine Darstellung dieses Vorwurfes. Die drei anderen Einwände gegen den Egalitarismus seien hier aber zumindest genannt (Ausführlicher dazu Krebs, Angelika: Die neue Egalitarismuskritik im Überblick. In: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Frankfurt 2000, S. 7-37, sowie das dritte Kapitel in Krebs, Angelika: Arbeit und Liebe. Frankfurt 2002).
28
Der zweite Einwand bezichtigt den Egalitarismus der Inhumanität: Zum Beispiel habe die konsequente Durchführung der egalitaristischen Unterscheidung zwischen zu egalisierenden unverdienten Lebensumständen und nicht zu egalisierenden Folgen freier Entscheidungen verheerende Konsequenzen für Menschen, die an ihrem Elend selbst schuld sind. Ihnen stünde dann nämlich gerechtigkeitshalber keine Unterstützung zu.
29
Die dritte Art von Egalitarismuskritik bezichtigt den Egalitarismus einer Verkennung der Komplexität unserer Gerechtigkeitskultur: Neben Prinzipien, die Gleichheit verlangen, gebe es auch Prinzipien, die Ungleichheit verlangen, wie das Verdienstprinzip, das Prinzip der Tauschfreiheit oder das Qualifikationsprinzip. Wenn Ehren nach hervorragender Leistung, Wohlstandsgüter nach freiem Tausch und Ämter nach Qualifikation verteilt würden, sei an diesen Ungleichheiten nichts auszusetzen.
30
Die vierte Gruppe pragmatischer Argumente wendet schliesslich ein, dass Gleichheit ohnehin nicht herstellbar ist, sei es aufgrund des schieren Ausmasses an Kontingenz im menschlichen Leben oder sei es aufgrund der Schwierigkeit, Kontingenz von Eigenverantwortung sauber zu trennen.
1. Der Vorwurf der Verwechslung von Allgemeinheit mit Gleichheit
31
Der Vorwurf der Verwechslung von Allgemeinheit mit Gleichheit wird von einer ganzen Reihe von Philosophinnen und Philosophen erhoben, am deutlichsten von Joseph Raz, Harry Frankfurt und Peter Westen (Raz, Joseph: Strenger und rhetorischer Egalitarismus. In: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Frankfurt 2000, S. 50-80; Frankfurt, Harry: Gleichheit und Achtung. Ebd., S. 38-49 sowie Westen, Peter (siehe Rz. 5), insbes. S. 71-74). Er besagt, dass zumindest die besonders wichtigen, elementaren Standards der Gerechtigkeit nicht-relationaler Art sind und Gleichheit nur als Nebenprodukt ihrer Erfüllung mit sich führen. Gleichheit kann daher als Ziel von Gerechtigkeit nicht so wesentlich sein, wie der Egalitarismus glaubt.
32
Die elementaren Standards der Gerechtigkeit garantieren allen Menschen menschenwürdige Lebensbedingungen. Sie verlangen etwa, dass jeder Mensch Zugang zu Nahrung, Obdach und medizinischer Grundversorgung haben muss. Sie fordern, dass in jedem menschlichen Leben Raum für private wie politische Autonomie, Besonderung und persönliche Nahbeziehungen sein soll. Sie verlangen, dass jeder Mensch sich in seiner Gesellschaft zugehörig, als „einer von uns“, fühlen können soll. Diese Standards geben absolute Schwellenwerte vor, die allerdings noch kulturspezifisch zu konkretisieren sind. So führt zum Beispiel die kulturspezifische Konkretisierung des Rechtes auf soziale Zugehörigkeit in Arbeitsgesellschaften, und nur in diesen, zu einem Recht auf Arbeit (Wie man sich dies genauer vorzustellen hat, habe ich im sechsten Kapitel von Arbeit und Liebe (Frankfurt 2002) ausgeführt.).
33
Wenn nun ein Mensch unter Hunger oder Krankheit leidet, ist ihm zu helfen, weil Hunger und Krankheit für jeden Menschen schreckliche Zustände sind, und nicht deswegen, weil es anderen schliesslich besser geht als ihm. Ob andere Menschen auch unter Hunger oder Krankheit leiden, ist für die Frage, was man diesem einen Menschen schuldet, zunächst einmal nicht von Belang. Das Übel des Hungers und der Krankheit sagt einem vielmehr direkt, was man zu tun hat. Man muss sich nicht erst umsehen und vergleichen. In den Worten von Harry Frankfurt: „Sicherlich sind es nicht formale, sondern substantielle Bestimmungen, die genuin moralische Bedeutung haben. Es kommt darauf an, ob Menschen ein gutes Leben führen, und nicht, wie deren Leben relativ zu dem Leben anderer steht“ (S. 41 aus Frankfurt, Harry (siehe Rz. 31)).
34
Die Gleichheitsrelation, die sich einstellt, wenn im Namen der Gerechtigkeit allen Hilfsbedürftigen geholfen ist und alle tatsächlich menschenwürdig leben können, ist nichts als das Nebenprodukt der Erfüllung der absoluten Gerechtigkeitsstandards für alle. Gleichheit sitzt auf Universalität auf. Die Gleichheitsterminologie ist redundant. Es geht nichts verloren, wenn man anstelle von: „Alle Menschen sollen gleichermassen genug zu essen haben.“ einfach nur sagt: „Alle Menschen sollen genug zu essen haben.“
35
Bei relationalen Standards ist, wie wir im ersten Abschnitt gesehen haben, die Gleichheitsterminologie dagegen nicht redundant. Relationale Standards funktionieren wie eine Balkenwaage, die nur messen soll, ob die betrachteten Objekte gleich schwer sind, aber nicht, wie schwer jedes für sich genommen ist. Absolute Standards funktionieren dagegen wie eine Digitalwaage, die messen soll, ob jedes Objekt einen bestimmten Messwert, ein Kilogramm zum Beispiel, erreicht. Indem der Egalitarismus Gerechtigkeit wesentlich relational, als Gleichheit in unverdienten Lebensaussichten, begreift, verfehlt er die Natur elementarer Gerechtigkeitsansprüche. Menschenwürde ist ein absoluter Begriff.
36
Auch in Mangelsituationen, wo nicht allen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden kann, geben die absoluten Gerechtigkeitsstandards selbst eine Verteilung vor: Je weiter ein Mensch von dem eigentlich gebotenen Niveau entfernt ist, desto dringlicher ist (in der Regel) sein Anspruch auf Hilfe. Die Bedürftigeren haben damit Vorrang. In Mangelsituationen muss man sich also doch, bevor man handelt, umsehen und vergleichen. Aber dieser Vergleich ist den Gerechtigkeitsstandards nachgeordnet, er findet nur auf der Ebene ihrer Umsetzung statt. Die Standards selbst kommen ohne Vergleich aus und bestimmen für Mangelsituationen die Reihenfolge der Hilfe. Der Vergleich dient nur dazu festzustellen, wer wo in der Reihenfolge steht. Dass Gleichbedürftige gleich viel Hilfe erhalten sollen, ist wieder nichts als ein Nebenprodukt absoluter Gerechtigkeitsstandards.
37
In Reaktion auf den Verwechslungsvorwurf mögen manche Egalitaristen, Thomas Nagel (Nagel, Thomas: Justice and Nature. In: Oxford Journal of Legal Studies 17 (1997), S. 303-321) ist ein prominentes Beispiel, bekennen, dass sie in dem Sinn dann wirklich keine Egalitaristen sind und den Verdacht von Jan Narveson bestätigen, „that most who profess egalitarianism are really safetynetters at heart“ (S. 80 aus Narveson, Jan: Egalitarianism: Partial, Counterproductive, and Baseless. In: Mason, Andrew (Hrsg.): Ideals of Equality. Oxford 1998, S. 79-94).
38
Andere Egalitaristen mögen sich mit ihren egalitaristischen Intuitionen aus dem elementaren Bereich auf den Surplus-Bereich zurückziehen und eine Art „Schrumpfegalitarismus“ vertreten. Im Unterschied zum Standardegalitarismus arbeitet der Schrumpfegalitarismus mit absoluten, humanitären Prinzipien im elementaren Bereich und vertritt ein flächendeckendes Gleichheitsprinzip nur noch für den Bereich oberhalb des humanitären Sockels.
39
Was Egalitaristen nach dem Verwechslungsvorwurf jedenfalls nicht mehr tun können, ist die Gegenseite einfach als „Egalitaristen der Menschenwürde oder des guten Lebens“ „eingemeinden“ und die „Why-Equality?“-Debatte für unnötig erklären. Die „Eingemeindungs“- oder „Umarmungsstrategie“ war bisher allerdings die Lieblingsstrategie der Egalitaristen im Umgang mit Kritik an ihrem egalitaristischen Grundprinzip (Vgl. z.B. S. 12/13 in Sen, Amartya: Inequality Reexamined. Oxford 1992).
40
Das heißt dann aber auch, dass die Begründung eines Schrumpfegalitarismus, als verbleibender egalitaristischer Rückzugsposition, kein Kapital mehr daraus schlagen kann, dass „wir“ im elementaren Bereich doch eigentlich alle für Gleichheit, also Egalitaristen, seien und konsequenterweise dann das Gleichheitsprinzip auch im Surplus-Bereich vertreten sollten.
41
Der Egalitarismus gewinnt seine Plausibilität vor allem aus der Ungerechtigkeit der Verletzung menschenwürdiger Lebensbedingungen, die er als Ungleichheiten beschreibt. Wie kann es gerecht sein, fragt der Egalitarist, wenn die einen hungern müssen und die anderen Austern und Champagner schlürfen? Gerechtigkeit muss Gleichheit unter den Menschen schaffen. – Identifiziert man jedoch die vorliegende Ungerechtigkeit richtig, nämlich als Verletzung elementarer, absoluter Gerechtigkeitsstandards, dann verliert der Egalitarismus auch „weiter oben“, im Surplus-Bereich, an Plausibilität. Er kann, bildlich gesprochen, auf dem Sockel nicht mehr Fuss fassen und sich abstossen und hat dann auch keinen Schwung mehr im Surplus-Bereich. Den hätte er aber bitter nötig. Denn im Surplus-Bereich konkurriert das Gleichheitsprinzip, anders als im Sockel-Bereich, gegen eine Fülle fest etablierter Gerechtigkeitsstandards, die Ungleichverteilung verlangen, etwa die Verteilung nach Verdienst oder freiem Tausch.
V. Der Humanismus als Alternative zum Egalitarismus
42
Der Nonegalitarismus misst Gleichheit keinen zentralen Wert an sich zu. Er versteht Gerechtigkeit vielmehr wesentlich über absolute Standards. Je nachdem, welche absoluten Standards das sind, ergeben sich verschiedene Varianten der nonegalitaristischen Gerechtigkeitskonzeption. Es gibt nicht nur eine Alternative zum Egalitarismus, es gibt ihrer viele.
43
So stellt zum Beispiel der Libertarianismus Robert Nozicks eine nonegalitaristische Gerechtigkeitskonzeption dar. Nozick will die negative Freiheit aller schützen. Niemand darf seines Lebens, seiner Gesundheit, seiner Freiheit oder seines Eigentums beraubt werden. Einen Staat, der über die Garantie dieser minimalen Abwehrrechte hinausgeht, begreift Nozick als Unrechtsstaat (Nozick, Robert: Anarchie, Staat, Utopie. München 1976).
44
Die Autoren der neuen Egalitarismuskritik geben sich mit solch minimalen absoluten Standards nicht zufrieden. Die Vision der gerechten Gesellschaft, die sie dem Egalitarismus gegenüberstellen, ist weit attraktiver als der Nozicksche Libertarianismus. Bei den neuen Nonegalitaristen hat der Staat nicht nur die negative Freiheit aller zu schützen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass niemand unter elenden Umständen existieren muss. Jeder muss Zugang zu Nahrung, Obdach, medizinischer Grundversorgung, persönlichen Nahbeziehungen, sozialer Zugehörigkeit, Individualität und privater wie politischer Autonomie haben. Allen muss ein menschenwürdiges Leben effektiv ermöglicht werden.
45
Im nonegalitaristischen Humanismus weitet sich damit der Fokus von negativer Freiheit auf Menschenwürde. Gerechtigkeit muss jedoch im Humanismus nicht einfach mit der unbedingten Garantie eines humanitären Sockels für alle zusammenfallen. Dem Sockel nachgeordnet können vielmehr diverse Verteilungsprinzipien rangieren, wie das Verdienstprinzip, das Qualifikationsprinzip oder das Prinzip der Tauschfreiheit. Die Garantieprinzipien des Sockel-Bereichs sind als „allgemeine Gerechtigkeit“, „Menschenrechte“, „Anstand“ („decency“) oder „politische Solidarität“ terminologisch zu unterscheiden von den darüber liegenden Verteilungsprinzipien der „besonderen Gerechtigkeit“, „Gerechtigkeit (im engeren Sinne)“, „Bindestrich-“ oder „Verteilungsgerechtigkeit(en)“.
46
Die derzeit bekanntesten humanistischen Gerechtigkeitstheorien dürften Michael Walzers Sphärentheorie der Gerechtigkeit (Walzer, Michael: Sphären der Gerechtigkeit. Frankfurt 1992), Martha Nussbaums Aristotelischer Essentialismus (Nussbaum, Martha: Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit. In: Brumlik, Micha/Brunkhorst, Hauke (Hrsg.): Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Frankfurt 1993, S. 323-361) und Avishai Margalits Politik der Würde (Margalit, Avishai: Politik der Würde. Berlin 1997) sein. In der Literatur tritt der humanistische Nonegalitarismus unter verschiedenen Namen auf: „doctrine of sufficiency“ (so Harry Frankfurt, S. 22 in Frankfurt, Harry: Equality as a Moral Ideal. In: Ethics 98 (1987), S. 21-42), „Solidarität und Suffizienz“ oder „Liberalismus sans phrase“ (so Wolfgang Kersting, S. 244 bzw. 237 in Kersting, Wolfgang: Politische Solidarität statt Verteilungsgerechtigkeit. In Kersting, Wolfgang (Hrsg.): Politische Philosophie des Sozialstaats. Weilerwist 2000, S. 202-256) oder, etwas irreführend, „Vorrangposition“ (so Derek Parfit, S. 95 in Parfit, Derek (siehe Rz. 20)) oder, noch irreführender, „komplexe Gleichheit“ (so Michael Walzer, (S. 46 in Walzer, Michael (siehe hier in Rz. 46)) und „demokratische Gleichheit“ (so Elizabeth Anderson, S. 151 in Anderson, Elizabeth: Warum eigentlich Gleichheit? In: Krebs, Angelika (Hrsg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Frankfurt 2000. S. 117-171).
47
Auf die Feinheiten des nonegalitaristischen Humanismus sei hier nicht weiter eingegangen. Stattdessen sei die Frage aufgeworfen, welche Rolle Gleichheit in einer nonegalitaristischen Gerechtigkeitstheorie spielt. Gleichheit kommt im Humanismus an mindestens vier Stellen herein. Erst wenn man diese Rolle genau übersieht, wird man dem „Appeal“ des Egalitarismus nicht mehr erliegen.
1. Gleichheit als ein Eigenwert neben vielen anderen
48
Zunächst einmal muss der Humanismus relationalen Gerechtigkeitsgesichtspunkten nicht jede Geltung absprechen, wenn auch viele Nonegalitaristen diese radikale Gegenposition beziehen. So mögen zum Beispiel beim Verdienstprinzip Gesichtspunkte proportionaler (wenn auch nicht numerischer) Gleichheit eine eigene Kraft entfalten (vgl. z.B. Miller, David: The Concept of Desert. In: Miller, David: The Principles of Social Justice. Cambridge, Mass. 1999, S. 131-155).
2. Gleichheit als Nebenprodukt absoluter Standards
49
Zum zweiten verlangt, wovon bisher schon die Rede war, der Humanismus ein beträchtliches Maß an Gleichheit als Begleiterscheinung der Erfüllung seiner absoluten allgemeinen Standards.
3. Gleichheit als Vorbedingung gewisser absoluter Standards
50
Zum dritten setzen gewisse absolute Standards voraus, dass keine zu große Ungleichheit zwischen den Lebensbedingungen der Menschen besteht. So können zum Beispiel zu große Unterschiede zwischen Arm und Reich das Grundrecht eines Teils der Bürger auf politische Autonomie untergraben und einen „herrschaftsfreien“ politischen Diskurs vereiteln. Außerdem mögen diese Unterschiede das Grundrecht auf soziale Zugehörigkeit, insbesondere in der Konsumgesellschaft, tangieren. Wer zum Beispiel nicht das Geld hat, um sich so anzuziehen, dass er ohne Scham in der Öffentlichkeit auftreten kann, etwa für eine Beerdigung als Mann keinen schwarzen Anzug hat, ist von sozialem Ausschluss bedroht. In soziale Zugehörigkeit und politische Autonomie sind damit relationale Vorbedingungen eingelassen. Als relationale Vorbedingungen gewisser absoluter Standards haben diese Gleichheiten jedoch nur einen vom Wert dieser Standards abgeleiteten Wert. Sie sind nur als Mittel zum Zweck, als Wege zum Ziel geboten.
4. Gleichheit als Ausfluss politischer Autonomie
51
Zum letzten mag sich in gewissen Sondersituationen Gleichverteilung als Ergebnis eines Prozesses politischer Einigung ergeben. Wenn ein Gut, etwa der Reichtum aus der Entdeckung und Erschliessung neuer Erdölfelder, in einem Land zu verteilen ist, und wenn, was selten genug vorkommen dürfte, die Berücksichtigung einschlägiger Gerechtigkeitsstandards, wie der Anerkennung von Verdienst, der Wiedergutmachung vergangenen Unrechts, der Antidiskriminierungsmaßnahmen für benachteiligte Gruppen, der Vorsorge für harte Zeiten und für zukünftige Generationen, der humanitären Hilfe für arme Länder etc., diesen Reichtum nicht erschöpft, mag man sich auf die Gleichverteilung des restlichen Geldes auf alle Bürger des Landes einigen.
52
Diese Gleichverteilungen haben, da sie nur ein Ausfluss des Rechtes aller auf politische Autonomie sind, lediglich einen abgeleiteten Wert. Politische Autonomie realisiert sich in diesen Fällen in Form einer Entscheidung für Gleichverteilung. Gut an der Gleichverteilung ist, dass sie die von allen gewollte Verteilung ist.
53
Allerdings ergibt sich das Ergebnis Gleichverteilung nur, wenn man unterstellt, dass alle Bürger Interesse an dem Geld haben. Es könnte aber wohlhabende Bürger geben, die über genug zum guten Leben verfügen und keine Optimierungsstrategie verfolgen. Mit Aristoteles geredet, besitzen diese Bürger „natürlichen Reichtum“ und sind der Mehrung „abstrakten Reichtums“ um seiner selbst willen vernünftigerweise abgeneigt (1256b, 27-36 und 1257b, 18-1258a, 18 in Aristoteles: Politik. Stuttgart 1989). Oder mit Harry Frankfurt geredet, verfehlt sich selbst, wer den abschätzenden Blick nach rechts und links an die Stelle der Suche nach einem „authentisch“ guten Leben treten lässt (S. 23 in Frankfurt, Harry (siehe Rz. 46) sowie S. 42 und 49 in Frankfurt, Harry (siehe Rz. 31)).
54
Bürger, die nicht an dieser Art von Selbstentfremdung leiden, dürften bei der Frage der Verteilung des Reichtums aus den neu entdeckten Ölfeldern nur abwinken. Ihr Recht auf Autonomie, darauf, dass man auch ihnen gegenüber die Verteilung dieses sozialen Gutes rechtfertigt, ist nicht verletzt, wenn keine Gleichverteilung erfolgt.
55
Neben die beiden Punkte der Suffizienz authentischen Lebens und der Vielfalt erwartbarer Gerechtigkeitsgesichtspunkte tritt ein dritter Grund, der die Plausibilität von Gleichverteilung als Ausfluss politischer Autonomie weiter herabsetzt. Das ist der Nozicksche Hinweis, dass die meisten Güter dieser Welt bereits verteilt sind – die Häuser und Fabriken gehören schon jemandem – und sich in dieser Lage allein schon aus Gründen der Einfachheit das Prinzip, alles so zu lassen, wie es ist, es sei denn, jemand erhebt gerechtfertigte Gerechtigkeitsansprüche, nahe legt. Was in Tabula-rasa-Situationen wie John Rawls’ Urzustand oder Ronald Dworkins Insel der Schiffsbrüchigen (oder eben der Verteilung neu entdeckter Güter) noch ein Quantum an Plausibilität an sich hat, entbehrt der Plausibilität in unseren faktischen, gewachsenen Verhältnissen.
5. Kritik des egalitaristischen Kuchenbeispiels
56
Man sieht nun deutlich, wie geschickt das im Egalitarismus beliebte Kuchenbeispiel gewählt ist. Von Isaiah Berlin über Richard Hare und Ernst Tugendhat bis hin zu Wilfried Hinsch und Stefan Gosepath (S. 305 in Berlin, Isaiah: Equality. In: Proceedings of the Aristotelian Society LVI (1956), S. 301-326; S. 118/119 in Hare, Richard: Freedom and Reason. Oxford 1963; S. 374 in Tugendhat, Ernst: Vorlesungen über Ethik. Frankfurt 1993; S. 169/170 in Hinsch, Wilfried: Gerechtfertigte Ungleichheiten. Berlin 2002 sowie S. 202 in Gosepath, Stefan: Gleiche Gerechtigkeit. Frankfurt 2004) plausibilisieren Egalitaristen ihr Gleichheitsprinzip gerne über das Beispiel einer Mutter, die einen Kuchen unter ihren Kindern aufteilt und normalerweise (wenn keine besonderen Gründe vorliegen) jedem Kind ein gleich grosses Stück Kuchen geben wird.
57
Die Verteilung eines Kuchens an Kinder ist aber eine unterkomplexe Situation, Kinder können im Unterschied zu Erwachsenen zum Beispiel weder selbst Kuchen backen noch kaufen. In realen komplexen Verhältnissen dürfte die Gleichverteilungsoption so gut wie nie durchschlagen.
58
Ferner lässt das Kuchenbeispiel den Suffizienz-Gedanken erst gar nicht aufkommen. Von Süssigkeiten können Kinder nie genug kriegen, und man kann ihnen dies, da sie noch Kinder sind, auch nicht verübeln.
59
Schliesslich fingiert das Kuchenbeispiel eine Tabula-rasa-Situation der Verteilung aller sozialen Güter und nicht die gewordenen Verhältnisse, in denen wir uns nun einmal mit unseren Gerechtigkeitsbestrebungen vorfinden.
VI. Einigung oder Einsicht
60
Bei Gerechtigkeit geht es, so heißt es gern bei Egalitaristen, stets darum, welche Ansprüche auf welche Güter gegenüber wem mit welchen Gründen zu rechtfertigen sind. Das Prinzip der Rechtfertigung sei „konstitutiv“ für Gerechtigkeit. Ein wesentlicher egalitaristischer Einwand gegenüber dem Nonegalitarismus“ lautet denn auch, dass der Nonegalitarismus mit seinem Versuch, Gerechtigkeit direkt über eine Theorie des guten Lebens und ohne Zuhilfenahme des Rechtfertigungsprinzips zu rekonstruieren, scheitern muss. Dort, wo die im Nonegalitarismus formulierten absoluten Ansprüche trivialer- oder selbstevidenterweise gerecht zu sein scheinen, seien sie nur deshalb gerecht, da alle Betroffenen ihnen zustimmen können. Und dort, wo sie nicht selbstevidenterweise gerecht zu sein scheinen, sondern strittig sind, seien sie in „nachmetaphysischen Zeiten“ als nicht allgemein akzeptabel abzulehnen.
61
Dieser aus der Diskussion zwischen Formalethik und Ethik des guten Lebens bekannte Hinweis auf die Idee der Rechtfertigung stellt keinen guten Einwand gegen den Nonegalitarismus dar. Denn der Nonegalitarismus versteht Gerechtigkeit mitnichten an der Idee der Rechtfertigung vorbei. Allerdings versteht er diese Idee anders und weist ihr daher auch einen anderen Platz zu. Anders als bei Egalitaristen wie Stefan Gosepath und vielen anderen gilt im Nonegalitarismus ein Anspruch nicht deswegen als gerecht, weil alle ihm faktisch oder unter idealisierten Bedingungen zustimmen können. Vielmehr gilt ein Anspruch als gerecht, weil für ihn gute Gründe sprechen und gute Gründe ihrer Grammatik nach etwas sind, dem alle zustimmen können müssen. Bei vielen Egalitaristen ist Zustimmung konstitutiv für Gerechtigkeit. Im Nonegalitarismus ist sie das nicht. Hungerhilfe zum Beispiel ist deshalb gerecht, weil ein Leben in Hunger ein elendes Leben ist. Sie ist nicht deshalb gerecht, weil ihr die Hungernden und alle anderen Betroffenen zustimmen würden.
62
Es lohnt sich, die Differenz zwischen diesen beiden Verständnissen von Rechtfertigung genauer auszuloten. Dies soll im folgenden im Anschluss an eine Unterscheidung geschehen, die Friedrich Kambartel einst in Frankfurt gegen die Diskursethik von Jürgen Habermas in Anschlag brachte (Kambartel, Friedrich: Unterscheidungen zur Praktischen Philosophie. Im Blick auf die Diskursethik, Manuskript; vgl. auch die Brandomsche Kritik an Ich-Wir-Auffassungen von Objektivität in Brandom, Robert: Expressive Vernunft, Frankfurt: Suhrkamp 2000, Kap. 8.6., insbes. S. 831-834). Kambartel unterscheidet zwischen konsensueller und kognitiver Zustimmung oder Einigung und Einsicht. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind in untenstehender Tabelle aufgeführt.
|
Einigung |
Einsicht |
|
1. Eine Einigung ist die Bildung eines gemeinsamen Willens zur Bewältigung eines Interessenkonfliktes. |
1. Eine Einsicht ist ein Widerfahrnis, das oft durch Begründungen vorbereitet wird. |
|
2. Die Zustimmung zu einer Einigung ist performativ. |
2. Die Zustimmung zu einer Einsicht ist expressiv. |
|
3. Einigungen gelten auch, wenn man sich nicht daran hält. |
3. Einsichten drücken sich in einem ihnen gemässen Handeln aus. |
|
4. Man ist in seiner Zustimmung zu einer Einigung vertretbar. |
4. Man ist in seiner Zustimmung zu einer Einsicht unvertretbar. |
|
5. Eine Einigung richtet sich an interne Adressaten. |
5. Eine Einsicht kann zu jedermanns Einsicht werden (Unterstellung der Allgemeinheit, keine Prognose allgemeiner faktischer Zustimmung). |
|
6. Die Zustimmung gemäss Verfahren (z.B. Vertretung aller Betroffenen, Zwanglosigkeit, Unvoreingenommenheit, Wahrhaftigkeit) ist konstitutiv für die Geltung einer Einigung. |
6. Zwanglose, unvoreingenommene, wahrhaftige Diskurse mit allen Betroffenen dienen als Kontrolle für die Geltung einer Einsicht. |
1. Willensbildung oder Widerfahrnis
63
Eine Einigung ist die Bildung eines gemeinsamen Willens zur Bewältigung eines Interessenkonfliktes. Ein Beispiel einer Einigung gibt der am Ende einer kontroversen Diskussion stehende Beschluss einer Fakultät ab, in den Bolognaprozess einzutreten. Eine Einsicht ist dagegen ein Widerfahrnis, etwas, das einem zustößt, in der Regel nicht aus heiterem Himmel, sondern vorbereitet durch Begründungen. Begründungen verursachen allerdings die Einsicht nicht. Wenn eine „Begründung“ eine „Einsicht“ verursacht, handelt es sich nicht um eine Begründung und eine Einsicht, sondern um Manipulation. Ein Beispiel einer Einsicht ist, wenn ein Schüler im Mathematikunterricht plötzlich versteht, wieso die Rechnung der Lehrerin 5x15=75 richtig ist und seine eigene Rechnung falsch. Andere Beispiele von Einsichten sind, dass die deutsche Wiedervereinigung 1989 erfolgte oder dass ein Dach über dem Kopf zu einem anständigen menschlichen Leben dazugehört. In Einigungen gehen häufig Begründungen und Einsichten ein, wie das Beispiel des Fakultätsbeschlusses zu Bologna zeigt. Am Ende solcher Prozesse der auch argumentativen Willensbildung steht jedoch ein Beschluss.
2. Zustimmung performativ oder expressiv
64
Die Zustimmung zu einer Einigung ist performativ. Das Heben der Hand oder das Ja-Sagen konstituiert die Einigung, setzt sie in Kraft, so wie das „Ich will“ in der Kirche die Ehe besiegelt. Im Gegensatz dazu ähnelt die Zustimmung zu einer Einsicht dem Ausdruck des Schmerzes. Der charakteristische Ausdruck des Schmerzes steht zwar in einem grammatischen Zusammenhang zum Schmerz, aber die expressive Handlung konstituiert den Schmerzzustand nicht.
3. Rolle des Handelns
65
Einsichten drücken sich nicht nur über Akte der Zustimmung aus, sondern auch über ein einsichtsgemässes Handeln. Ob eine Zustimmung, etwa dazu, dass Rauchen der Gesundheit schadet, ernst gemeint oder wahrhaftig war, erweist sich praktisch. Die Zustimmung zu einer Vereinbarung gilt dagegen unabhängig davon, ob die Betroffenen sich in ihrem Handeln auch daran halten.
4. Vertretbarkeit oder Unvertretbarkeit
66
Man kann jemanden beauftragen, für einen einer Vereinbarung zuzustimmen. Zustimmung im Sinne der Einsicht kann man dagegen so wenig an eine andere Person delegieren, wie man eine andere Person bitten kann, den eigenen Schmerz für einen zu empfinden.
5. Interner Adressat oder Allgemeinheit
67
Von einer Einsicht kann man nicht erwarten, dass sie faktisch von allen geteilt wird. Solange etwa etliche Weltreligionen Frauen nur beschränkt die Fähigkeit zu vernünftiger Selbstbestimmung zusprechen und sie männlicher Führung unterstellen, wird die Einsicht, dass Frauen genauso zu vernünftiger Selbstbestimmung fähig und berechtigt sind wie Männer, strittig bleiben. Das ändert aber nichts daran, dass es sich bei dieser Einsicht um eine Einsicht handelt. Denn zur Grammatik von Einsichten gehört lediglich, dass sie für jeden, der sich auf die entsprechenden Begründungen einlässt, einsehbar sind. Zu sagen, etwas sei eine Einsicht, ohne dabei zu unterstellen, dass diese Einsicht (bei hinreichender Sachkunde und gutem Willen) zu jedermanns Einsicht werden kann, ist begrifflich falsch. Der in Einsichten grammatisch eingearbeitete Bezug auf Allgemeinheit geschieht im Modus einer Unterstellung und nicht im Modus einer Prognose. Einigungen haben im Unterschied dazu einen internen Adressaten. Es gehört zum Inhalt von Einigungen, dass man weiß, wer ihnen unterliegt.
6. Diskurse konstitutiv oder nur als Kontrolle
68
Fügt man den in Einsichten eingearbeiteten Bezug auf alle vernünftigen Menschen zusammen mit der Einsicht, dass jeder auch noch so vernünftige Mensch fehlbar ist, sich mitunter täuschen kann, dann erhält man die Empfehlung, den Anspruch, dass man alle von etwas überzeugen könnte, in einem wirklichen zwanglosen, unvoreingenommenen und wahrhaftigen Gespräch mit anderen, in dieser Sache besonders Kompetenten zu kontrollieren. Leuchtet das, was man selbst für ein schlagendes Argument hält, partout niemandem sonst ein, dann sind Zweifel an der Richtigkeit des Argumentes angebracht. Anders im Einigungsfall: dort ist das verfahrensgemässe Ja der anderen konstitutiv für Geltung.
69
Der Nonegalitarismus versteht Moral und Gerechtigkeit im wesentlichen über Einsichten und verlangt von diesen Einsichten dieselbe Universalität, wie wir sie von mathematischen oder empirischen Einsichten gewohnt sind. Wie man bei einer Rechnung oder einem Experiment nicht auf seine eigenen Interessen abstellen darf, so muten uns auch moralische Einsichten das Absehen von unseren besonderen, in der Regel partikularen Interessen zu. Für das Moralische geht es, mit Kants Worten, um die „Menschheit in unserer Person“ und das heißt um unser menschliches Wesen. Für die Begründung moralischer Einsichten stehen uns damit insbesondere diejenigen Bedürfnisse und Fähigkeiten zur Verfügung, die mit unserem Menschsein verbunden sind. Mit Kambartel:
70
„Die moralphilosophischen Rückgriffe auf einen faktisch oder unter idealen Bedingungen gewinnbaren Konsens gehen von den wirklichen, eventuell den wohlverstandenen Interessen der Betroffenen aus. Sie lassen es so erscheinen, als ob das moralisch Einsichtige in unserem (in jedermanns) modifizierten Interesse liegt. Dies ist aber nicht evident. Moralische Problemlösungen können von uns nämlich wirkliche Opfer fordern, sie sind im allgemeinen im Interesse der Schwachen, nicht der Starken, der Benachteiligten, nicht der Privilegierten. – Die moralische Perspektive verlangt von uns eben eine Einsicht, nicht lediglich eine (unter den faktischen oder unter idealen Argumentationsbedingungen) allgemein akzeptable Einigung.“
VII. Bibliographie
Aristoteles, Politik. Schriften zur Staatstheorie, hrsg. v. Franz Schwarz, Stuttgart: Reclam Verlag 1989.
Berlin, Isaiah, “Equality”, in: Proceedings of the Aristotelian Society LVI, 1956.
Cohen, Gerald, “Equality of What? On Welfare, Goods, and Capabilities”, in: The Quality of Life, hrsg. v. Martha Nussbaum und Amartya Sen, Oxford: Clarendon Press 1993, S. 9-29.
Feinberg, Joel, “Noncomparitive Justice”, in: Philosophical Review 83, 3, 1974, S. 297-338.
Frankena, William, “The Concept of Social Justice”, in: Social Justice, hrsg. v. Richard Brandt, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall 1962, S. 1-29.
Frankfurt, Harry, “Equality as a Moral Ideal”, in: Ethics 98, 1987, S. 21-42.
--, “Gleichheit und Achtung”, in: Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, hrsg. v. Angelika Krebs, Frankfurt: Suhrkamp Verlag 2000, S. 38-49.
Gosepath, Stefan, Gleiche Gerechtigkeit. Grundlagen eines liberalen Egalitarismus, Frankfurt: Suhrkamp Verlag.
Hare, Richard, Freedom and Reason, Oxford: Clarendon Press 1963. Deutsch: Freiheit und Vernunft, Düsseldorf: Patmos Verlag 1973.
Hinsch, Wilfried, Gerechtfertigte Ungleichheiten. Grundsätze sozialer Gerechtigkeit. Berlin: de Gruyter 2002.
Kambartel, Friedrich, „Unterscheidungen zur Praktischen Philosophie. Im Blick auf die Diskursethik“, Manuskript, Frankfurt 1993.
Kersting, Wolfgang, “Politische Solidarität statt Verteilungsgerechtigkeit. Eine Kritik egalitaristischer Sozialstaatsbegründung“, in: Politische Philosophie des Sozialstaats, hrsg. v. Wolfgang Kersting, Weilerwist: Velbrück Verlag 2000a, S. 202-256.
Krebs, Angelika, “Die neue Egalitarismuskritik im Überblick“, in: Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, hrsg. v. Angelika Krebs, Frankfurt: Suhrkamp Verlag 2000, S. 7-37.
--, Arbeit und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit. Frankfurt: Suhrkamp Verlag 2002.
Margalit, Avishai, The Decent Society, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1996. Deutsch: Politik der Würde, Berlin: Alexander Fest Verlag 1997, Frankfurt: Fischer Verlag 1999.
Miller, David, “The Concept of Desert“, in: Miller, David, The Principles of Social Justice, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press 1999, S. 131-155.
Nagel, Thomas, “Justice and Nature”, in: Oxford Journal of Legal Studies 17, 2, 1997, S. 303-321.
Narveson, Jan, “Egalitarianism: Partial, Counterproductive, and Baseless”, in: Ideals of Equality, hrsg. v. Andrew Mason, Oxford: Basil Blackwell 1998, S. 79-94.
Nozick, Robert, Anarchy, State, and Utopia, Oxford: Basil Blackwell 1974. Deutsch: Anarchie, Staat, Utopia, München: Wolfgang Dummer Verlag 1976.
Nussbaum, Martha, “Human Functioning and Social Justice“, in: Political Theory 20, 2, 1992, S. 202-246. Deutsche, kürzere Fassung in: Gemeinschaft und Gerechtigkeit, hrsg. v. Micha Brumlik und Hauke Brunkhorst, Frankfurt: Fischer Verlag 1993, S. 323-361.
Parfit, Derek, “Equality and Priority“, in: Ideals of Equality, hrsg. v. Andrew Mason, Oxford: Basil Blackwell 1998, S. 1-20. Deutsch in: Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, hrsg. v. Angelika Krebs, Frankfurt: Suhrkamp Verlag 2000, S. 81-106.
Raz, Joseph, “Strenger und rhetorischer Egalitarismus“, in: Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, hrsg. v. Angelika Krebs, Frankfurt: Suhrkamp Verlag 2000, S. 50-80.
Sen, Amartya, Inequality Reexamined, Oxford: Clarendon Press 1992.
Taylor, Charles, “The Nature and Scope of Distributive Justice”, in: Charles Taylor, Philosophy and the Human Sciences, Cambridge, England: Cambridge University Press 1985, S. 289-317. Deutsch in: Charles Taylor, Negative Freiheit, Frankfurt: Suhrkamp Verlag 1988, S. 145-187.
Tugendhat, Ernst, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt: Suhrkamp Verlag 1993.
Walzer, Michael, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism an Equality, Oxford: Basil Blackwell 1983. Deutsch: Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralismus und Gleichheit, Frankfurt: Campus Verlag 1992.
Westen, Peter, Speaking of Equality. An Analysis of the Rhetorical Force of “Equality” in Moral and Legal Discourse, Princeton: Princeton University Press 1990.
VIII. Verwandte Themen
Dworkin, Ronald M. | Freiheit | Gerechtigkeit | Gesetz | Habermas, Jürgen | Humanismus | Kant, Immanuel | Kommunitarismus | Liberalismus | Nussbaum, Martha | Margalit, Avischai | Menschenrechte | Menschenwürde | Naturrecht | positives Recht | Rawls, John | Recht | Sen, Amartya K. | Taylor, Charles | Rechtssicherheit | Walzer, Michael