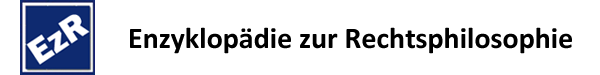Methodenlehre, historisch
Erstpublikation: 25.08.2013
I. Begriff
1
Unter juristischer Methode versteht man das Verfahren, festzustellen, was abstrakt oder in einem konkreten Fall Recht ist. Die juristische Methodenlehre ist die Theorie dieses Verfahrens (im Gegensatz zur Rechtsdogmatik, der Theorie des geltenden Rechts selbst). Sie umfasst die juristische Logik, das heißt die Theorie der Bildung von Begriffen, Sätzen und Schlüssen, und die Theorie der Gesetzesinterpretation. Im weiteren Sinne gehört zu ihr aber auch die Lehre vom Recht und von den Rechtsquellen, mit deren Hilfe das jeweils anzuwendende Recht erst einmal ermittelt wird. Eine historische Darstellung erstreckt sich zweckmäßigerweise auf alle diese innerlich verwandten Gebiete, obwohl sie jahrhundertelang als separate Disziplinen nebeneinander existiert haben. „Die Entwicklung der juristischen Methodenlehre steht in engstem Zusammenhang mit der Entwicklung des Rechtsbegriffs und lässt sich ohne sie nicht verstehen“ (Schröder 2012 a, S. V).
2
Die einzelnen Bestandteile der Methodenlehre wachsen erst in der jüngeren Neuzeit zu einem einheitlichen Fachgebiet zusammen. Schon das Wort „Methode“ (methodus) gewinnt erst allmählich seinen heutigen Sinn. Im Mittelalter wird es sehr selten, seit 1500 dann häufiger verwendet. Es bedeutet zunächst nur ein kurzes Lehrbuch, später die wissenschaftliche Ordnung einer Disziplin und schließlich das wissenschaftliche Erkenntnisverfahren selbst. Noch sehr viel jünger ist das Wort „(juristische) Methodenlehre“. Erst im späten 18. Jahrhundert bürgert sich der Ausdruck „juristische Methodologie“ ein, worunter man aber zunächst nur eine Anleitung zum Lehren und Lernen der Rechtswissenschaft versteht. Dem modernen Begriff nähert sich wohl erstmals Friedrich Carl von Savigny in seiner Vorlesung „Anleitung zu einem eigenen Studium der Jurisprudenz“ (1802/3) an.
II. Geschichte von 1500 bis 1945
1. Früheste Neuzeit (1500 bis 1650)
3
a) Rechtsbegriff und Rechtsquellenlehre
4
Im Mittelalter und in der frühesten Neuzeit herrscht ein „werthaltiger“ Rechtsbegriff. Recht ist nicht jede beliebige, sondern nur eine gerechte oder vernünftige Regelung. Dementsprechend ist auch ein „Gesetz“, wie schon Thomas von Aquin definiert hatte, nur eine „vernünftige Anordnung desjenigen, dem die Sorge für die Gemeinschaft obliegt“ (Thomas von Aquin, qu. 90, art. 4). Ein Gesetz, das nicht dem Naturrecht oder dem geoffenbarten göttlichen Recht entspricht, ist schon gar kein Gesetz, vielmehr erscheint auch noch das positive Recht als eine Art von Naturrecht, dessen letzte, „ausgeformteste“ Stufe (Zasius, zu D. 1, 1, 2 § „Huius studii“, Nr. 41, S. 128). Auch die zweite positive Rechtsquelle, das Gewohnheitsrecht, muss vernünftig, „rationabilis“ sein, darf also nicht gegen natürliches oder göttliches Recht verstoßen.
5
b) Methodenlehre im engeren Sinne
6
Man kann drei Hauptteile unterscheiden: Topik (Argumentationstheorie), Interpretationstheorie und Theorie der wissenschaftlichen Rechtsfindung oder -darstellung.
7
(1) Die Topik wird als Teil der Lehre von den Schlüssen, also der Logik aufgefasst. Meistens unterscheidet man zwischen den „apodiktischen“ Schlüssen der klassischen aristotelischen Syllogistik und den „dialektischen“, topischen. Die „apodiktischen“ führen zu sicheren Wahrheiten. Im Recht dienen sie vor allem zur Anwendung von Rechtssätzen auf den Einzelfall. So könnte man etwa im „modus Barbara“ der ersten Figur schließen: „Alle Rechtsgeschäfte eines Kindes sind unwirksam. A ist ein Kind, also...“. Großen Nutzen haben diese Schlüsse nicht, da sie keine neuen Rechtsregeln hervorbringen.
8
Ergiebiger sind die topischen Schlüsse, deren Ergebnisse allerdings nur wahrscheinlich sind. Die reichhaltige Topik-Literatur des 16. und frühen 17. Jahrhunderts baut auf der von Aristoteles begründeten und von Cicero und Boethius weiter ausgeführten antiken Topik auf. Danach gibt es eine Reihe von Topoi (loci, Orte) der Argumentation, wie etwa das Gleiche, das Ähnliche, das Entgegengesetzte, die Konsequenz usw., aber auch das göttliche und menschliche Zeugnis. Mit jedem dieser Topoi sind bestimmte Maximen verbunden, die man als Prämissen in einen Schluss einbauen kann. So ist z.B. mit dem „Ähnlichen“ (simile) die Maxime verbunden „Ähnliches ist ähnlich zu behandeln“. Daraus können sich dann die Schlüsse ergeben: „Geisteskranke sind den Kindern ähnlich. Rechtsgeschäfte von Kindern sind unwirksam. Ähnliches ist ähnlich zu behandeln, also...“. Der Topos „a simili“ ist überhaupt derjenige, der im Recht am häufigsten verwendet wird. Vergleichbare Bedeutung hat nur noch der Topos des menschlichen Zeugnisses oder der Autorität. Zu ihm gehört die Maxime „Jedem bewährten Fachmann ist in seiner Disziplin zu glauben“, vor allem dann, wenn die meisten oder die besten Fachleute übereinstimmen. In diesem Fall ist sogar nach der von Aristoteles begründeten und bis zum Ende des 17. Jahrhunderts herrschenden Lehre das Wahrscheinlichkeitskriterium schlechthin erfüllt. Der Topos des menschlichen Zeugnisses bildet die Grundlage für die Theorie der „communis opinio“, deren Voraussetzungen im 16. Jahrhundert in einer Fülle von Traktaten erörtert werden.
9
Bis heute wird das richtige Verständnis der alten Topik erschwert durch die Topik-Theorie, die Theodor Viehweg 1954 bei seiner „Wiederentdeckung“ der Topik entwickelt hat. Viehweg verstand unter „Topoi“ allgemeine rechtliche Aussagen, „Gemeinplätze“, die in zweifelhaften Fällen als Argumente eingesetzt werden können. Mit der alten Topik hat das nichts zu tun. Sie bietet nicht selbst fertige Rechtsregeln an, sondern nur Prämissen für Schlüsse, sozusagen Formulare, die erst mit konkreten Rechtsinhalten ausgefüllt werden müssen. Was man früher Topoi nannte, sind heute bestimmte Argumentationsformen wie Analogie und argumentum e contrario, aber nicht komplette Rechtsregeln. Zutreffend ist allerdings Viehwegs Beobachtung, dass sich das Denken in koordinierten, nicht hierarchisch geordneten Topoi nicht mit dem systematischen Rechtsdenken der jüngeren Neuzeit verträgt.
10
(2) Die Theorie der Gesetzesinterpretation hat sich im Recht autochthon auf der Grundlage verschiedener Regeln des römischen Rechts (vor allem Digesten 1, 3 und 50, 17) entwickelt. Erste Spezialabhandlungen zu einzelnen Themen entstehen im späten Mittelalter, umfassendere Darstellungen dann seit dem 16. Jahrhundert.
11
Die Juristen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts unterscheiden zwei Arten der Interpretation, die komprehensive und die extensive. Die komprehensive besteht in der Erklärung, Ausdehnung oder Einschränkung des Gesetzes aus seiner „mens“; im Gegensatz zu anderen Perioden geht also in der frühen Neuzeit die Sinnauslegung der Wortlautauslegung vor. Von extensiver Auslegung in eigentlicher Bedeutung spricht man dann, wenn das Gesetz entsprechend einem der „mens“ ähnlichen Gedanken ausgedehnt wird. Dieser Fall ist allerdings von der Anwendung des Topos „a simili“, der heutigen Analogie, kaum noch zu unterscheiden. Für die Juristen des 16. Jahrhunderts war das kein Problem, weil ihnen die verschiedenen Wurzeln der beiden Verfahrensweisen (hier Interpretationslehre, dort Topik) noch deutlich vor Augen standen. Erst nachdem die alte Topik in Vergessenheit geraten war, konnte es überhaupt zu einer Diskussion darüber kommen, wie sich Analogie und ausdehnende Auslegung „unterscheiden“. Es gibt aber auf die Frage nach der sachlichen Abgrenzung von Ausdehnung und Analogie keine überzeitliche Antwort, weil sich die Vorstellungen vom Wesen der Analogie und von der Reichweite der Gesetzesinterpretation im Laufe der Geschichte immer wieder wandeln.
12
Die Grundhaltung der Interpretationstheorie des 16. Jahrhunderts ist, entsprechend dem werthaltigen Rechtsbegriff der Zeit, vernunft- und gerechtigkeitsbezogen. Die „mens“ des Gesetzes wird mit der „ratio“ gleichgesetzt. Diese findet man in den Wertvorstellungen der Zeit, wie sie sich vor allem im Naturrecht, im geoffenbarten göttlichen Recht und im rezipierten römischen „ius commune“ niederschlagen. Damit setzt sich der Vorrang des göttlich-natürlichen und des römischen Rechts, der die Rechtsquellenlehre beherrscht, in der Interpretationslehre fort. So sind z. B. Statuten, also territoriales und lokales Recht, eng auszulegen, soweit sie nicht mit der „ratio“ übereinstimmen. Nur geringe Bedeutung für die „ratio“ hat der Wille des Gesetzgebers. Dementsprechend ist, abgesehen von der Erklärung alter Wörter und Bräuche, eine historische, nach der Entstehungsgeschichte fragende Auslegung überhaupt unbekannt.
13
(3) Die Theorie der Rechtswissenschaft ist im 16. und frühen 17. Jahrhundert noch wenig entwickelt. Hauptsächlich beschäftigt sie sich mit der Ordnung und Darstellung des Stoffs. Für die Gesamtordnung einer Wissenschaft waren aus der antiken Methodenlehre Galens drei Verfahren überliefert: Die analytische, resolutive, die vom Zweck zu den Mitteln fortschreitet, die synthetische, kompositive, die mit den einfachsten Elementen einer Disziplin beginnt und dann zu den komplexeren übergeht, und die dihairetische, definitive, die den Grundbegriff der jeweiligen Wissenschaft in immer weitere Arten und Unterarten aufspaltet (die beiden letzten werden auch heute noch als axiomatische bzw. klassifikatorische Methode diskutiert). Die Juristen bevorzugten bei ihren systematisierenden Versuchen die dihairetische Methode, die schon Cicero empfohlen hatte und die bei den Humanisten des 16. Jahrhunderts den größten Anklang fand. Entsprechende, meistens aber unvollständige, Systematisierungen des römischen Rechts legen etwa Sebastian Derrer (gest. 1541), Conrad Lagus (gest. 1546), Nicolaus Vigelius (1529-1600), Hugo Donellus (1527-1591) und Johannes Althusius (1557-1638) vor. Im Laufe des 17. Jahrhunderts tritt dann die analytische Methode in den Vordergrund, die angeblich der Jurisprudenz und der überkommenen Ordnung des römischen Rechts besser entsprach.
14
Für die Darstellung einzelner Materien entwickelte Philipp Melanchthon eine „Methode des einfachen Themas“, die darin besteht, dass die Aussagen über einen Gegenstand in der Reihenfolge bestimmter Topoi (Definition, Gattungen, Arten, Ursachen, Wirkungen usw.) zusammengestellt werden. Dieses unverwüstliche, auch heute noch beliebte Ordnungsschema wurde von den Juristen sofort übernommen und hat sich lange behauptet.
15
Dagegen ist die Vorstellung eines „inneren“ Systems des Rechts, aus dem neue Rechtssätze entwickelt werden können, den Juristen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts fremd. Sie verträgt sich nicht mit dem topischen Denken, das überhaupt keine Erfindung und „Forschung“ kennt, sondern annimmt, dass alle Wahrheiten in der Welt schon entdeckt sind, und es nur darauf ankommt, ihren Ort (Topos) zu finden. Zu diesem Zweck reichten die überkommenen Ordnungsverfahren aus. Dass sie tatsächlich zuweilen auch neue Rechtserkenntnisse hervorgebracht haben, ist zwar nicht zu bestreiten, nur fehlte eben die entsprechende methodologische Theorie.
2. Vernunftrecht und beginnender Positivismus (1650 bis 1800)
16
a) Rechtsbegriff und Rechtsquellenlehre
17
Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts entwickelt sich ein dualistischer Rechtsbegriff. Positives Recht und Naturrecht trennen sich deutlicher voneinander als zuvor. Dieser beginnende Positivismus steht offenbar im Zusammenhang mit dem überall vordringenden empirischen Denken, aber auch mit den Bürgerkriegen und Religionskämpfen des 16. und 17. Jahrhunderts, die es vor allem wichtig erscheinen ließen, überhaupt ein sicheres Recht zu haben. Auf die Gerechtigkeit und Vernünftigkeit des positiven Rechts kommt es nicht mehr an. Gesetz und positives Recht überhaupt sind nichts anderes mehr als der Befehl eines Gesetzgebers („Dekrete des bürgerlichen Oberherrschers“: Pufendorf 1673 /1997, lib. 2, cap. 12, § 1, S. 80).
18
Folgerichtig macht man nun auch das Gewohnheitsrecht von der Zustimmung des Gesetzgebers abhängig. Zwar soll im Allgemeinen ein „Generalkonsens“ genügen, ein gesetzesderogierendes Gewohnheitsrecht unterliegt aber schärferen Anforderungen.
20
Das Naturrecht wird jetzt nur noch aus der menschlichen Vernunft hergeleitet. Das führt zu einer enormen inhaltlichen Ausweitung, aber auch zu einem Verlust seiner ursprünglichen göttlichen Legitimation. So gewinnt das positive Recht, spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, in der praktischen Rechtsanwendung den Vorrang. Naturrecht „bricht“ nicht mehr positives Recht, sondern steht nur noch hinter ihm als subsidiäre Rechtsquelle.
21
b) Methodenlehre im engeren Sinne
22
Die Entdeckung von Geschichte (Positivität des Rechts) und Vernunft, aber auch ihr Spannungsverhältnis durchzieht die gesamte Rechtstheorie der Aufklärung. Die Topik verschwindet, dagegen wird einerseits die Interpretation des positiven Rechts historisiert, andererseits die Naturrechtslehre systematisiert und zu einer produktiven Rechtswissenschaft ausgebaut.
23
(1) Die Topik fällt dem Empirismus der naturwissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts und seinem selbstbewussten Vernunftgebrauch zum Opfer. Man erkennt jetzt, dass ihre Anweisungen nur formal sind und auf die entscheidenden Fragen keine Antwort geben. So ist die Plausibilität eines Ähnlichkeitsschlusses ganz davon abhängig, dass wirklich Ähnliches (z. B. Kinder und Geisteskranke) miteinander verglichen wird. Ob das der Fall ist, ergibt sich aber nicht aus der Topik, sondern aus Geschichte, Erfahrung und Vernunft. Angesichts der begrenzten Möglichkeiten der Jurisprudenz, durch Vernunft und Erfahrung zu sicheren Einsichten zu kommen, behaupten sich allerdings doch das - mehr und mehr als „Analogie“ bezeichnete - „argumentum a simili“ und das „argumentum e contrario“. In die Kritik gerät auch der Topos des fachmännischen Zeugnisses. Eine „communis opinio“ soll jetzt nicht einmal mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben, sondern anhand von Vernunft und Erfahrung überprüft werden. Abgesehen davon ist sie nur ein „Vor-Urteil“. Damit wird die „communis opinio“ aus der wissenschaftlichen Diskussion, wenn auch nicht unbedingt aus der Praxis des Rechtslebens, verbannt.
24
(2) Unter dem Eindruck des beginnenden Positivismus steht vor allem die Interpretationstheorie, die es ja nur mit positivem Recht zu tun hat. Christian Thomasius (Thomasius, 3. Hauptstück, Nr. 34, S. 166) begründet eine Unterscheidung zwischen „grammatischer“ und „logischer“ Interpretation. Diese ermittelt den wirklichen Sinn eines Textes, gehört also nach einer sich im 17. Jahrhundert durchsetzenden Vorstellung in die Logik, jene stellt den üblichen Sprachsinn fest. Diese Einteilung hat sich sofort durchgesetzt; sie bleibt in Deutschland bis zum späten 19. Jahrhundert und in Frankreich noch länger herrschend. Die logische Interpretation wiederum kann erklärend, ausdehnend oder einschränkend sein. Sie darf zwar immer noch über den gewöhnlichen Sprachsinn, aber nicht mehr, wie noch im 16. Jahrhundert, über den wirklichen Sinn hinausgehen. Schon hier machen sich die positivistischen Tendenzen der neuen Rechtslehre bemerkbar.
25
Sie zeigen sich noch deutlicher in einer Vermehrung und Neugewichtung des interpretatorischen Handwerkszeugs. Kam es früher vor allem auf die Vernünftigkeit und Gerechtigkeit eines Rechtssatzes an, so wird jetzt nach dem Willen desjenigen gefragt, der den Gesetzesbefehl erlassen hat. Um ihn zu festzustellen, bedarf es historischer Untersuchungen, so dass seit Thomasius auch die Geschichte zum Hilfsmittel der Interpretation aufrückt. Demgemäß wird von den bisher schon bekannten Gesichtspunkten Wortsinn, Kontext, „ratio“ die letzte jetzt mehr im Sinne des historischen gesetzgeberischen Zweckes verstanden. Nur wenn dieser nicht zu ermitteln ist, kann der Interpret den Zweck unterstellen, der ihm vernünftig erscheint; das Naturrecht kommt also, wie in der Rechtsquellenlehre, nur noch subsidiär zum Einsatz. Die neuen Auslegungsprinzipien führen dazu, dass altbekannte Fälle jetzt anders gelöst werden als vorher. So war aus dem Mittelalter das Problem überliefert, ob ein Verbot, Getreide auszuführen, auf die Ausfuhr von Mehl erstreckt werden kann. Noch im 16. Jahrhundert hatte man das überwiegend verneint, weil das Verbot als „irrational“, nämlich freiheitsbeschränkend, und daher nicht ausdehnungsfähig erschien. Im 18. Jahrhundert wird die Ausdehnung dagegen durchweg bejaht, weil der Wille des Gesetzgebers dahin geht, eine Nahrungsmittelknappheit zu verhindern.
26
3) In der Rechtswissenschaft des 18. Jahrhunderts spielt dagegen die Entdeckung der Vernunft eine größere Rolle. Zum ersten Mal entwickelt sich eine Theorie der produktiven Rechtssatz- und Systembildung. Der Siegeszug der rationalistischen, demonstrativen Methode seit Descartes legte es nahe, nun auch in der Jurisprudenz eine synthetische Rechtserzeugung durch Schlüsse aus einigen Grundsätzen und Axiomen zu versuchen. Ihr Ort ist vor allem das neue Naturrecht. Die großen Naturrechtssysteme des 18. Jahrhunderts sind durchweg rationalistische Konstruktionen aus (nicht immer übereinstimmenden) obersten Rechtsgrundsätzen. Sie bedienen sich zuweilen auch in der Darstellung der demonstrativen, syllogistischen Methode, wie vor allem das achtbändige „Ius Naturae“ Christian Wolffs. Im positiven Recht dagegen kam eine solche Rechtskonstruktion aus rationalen Grundsätzen nicht ohne weiteres in Betracht, da es definitionsgemäß nur ein Befehl des Gesetzgebers war und auch „nackte Willkür“ sein konnte (Pufendorf 1672 / 1998, lib. 2, cap. 3, § 24, S. 163). Daher blieb umstritten, ob die demonstrative Methode auch für das positive Recht passte. Die Wolff-Schule behauptete das, stieß dabei jedoch auf heftigen Widerstand anderer, positivistischer denkender Autoren.
27
Nur noch wenig Interesse hatten die Aufklärungsjuristen an den alten Ordnungs- und Darstellungsschemata. Sie werden zunehmend als scholastisch und einengend empfunden und verlieren sich im Laufe des 18. Jahrhunderts.
3. Historische Rechtsschule (1800 bis 1870)
28
a) Rechtsbegriff und Rechtsquellenlehre
29
Nach 1800 setzt sich bis zum zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts der Rechtsbegriff der historischen Rechtsschule durch. Danach gibt es keinen Dualismus mehr zwischen Naturrecht und positivem Recht, sondern nur noch positives, empirisches, historisch gegebenes Recht. Das Naturrecht verliert seinen Charakter als Rechtsquelle, bleibt jedoch als philosophisch-politische Theorie bestehen. Das positive Recht soll aber nicht einfach durch den Willen und Befehl des Gesetzgebers entstehen. Vielmehr wächst es in der Volksüberzeugung, dem „Volksgeist“ heran, ist deshalb auch nicht mehr willkürlich und zufällig, sondern „mit innerer Nothwendigkeit“ (Savigny 1815, S. 6) gegeben. Die innere Vernunft des Volksgeists teilt sich dem durch ihn hervorgebrachten Recht mit, so dass das Recht im Ganzen - wenn auch nicht immer im Einzelnen - als „ein Vernünftiges“ (Puchta, § 2, S. 5) erscheint und sich seine Vorschriften zu einem einheitlichen, innerlich geordneten System zusammenschließen.
30
In der historischen Schule wird das Gewohnheitsrecht zur ursprünglichen Rechtsquelle. Es bedarf nicht der Zustimmung des Gesetzgebers und kann das Gesetz auch aufheben. Allerdings verkennen die Anhänger der historischen Schule nicht, dass das Volks-Gewohnheitsrecht im Laufe der Geschichte mehr und mehr durch das Gesetz verdrängt worden ist. Ihr Interesse gilt deshalb vor allem dem Juristen-Gewohnheitsrecht. Entsteht Juristenrecht nicht durch die Rechtspraxis, sondern durch theoretische Ableitung aus dem Rechtssystem, dann soll es als „wissenschaftliches Recht“ sogar eine eigenartige, dritte Rechtsquelle ausmachen.
31
b) Methodenlehre im engeren Sinne
32
Die Volksgeistlehre hat unterschiedliche Konsequenzen für die Theorie der Gesetzesinterpretation und der Rechtswissenschaft. Während die Auslegung des einzelnen Rechtssatzes historisch-exegetisch sein soll, wird die innere Vernunft des Rechtsganzen von der Rechtswissenschaft logisch-systematisch entfaltet.
33
(1) Die Interpretationstheorie vor allem des jungen Savigny, aber auch vieler anderer Autoren des frühesten 19. Jahrhunderts, läuft auf eine reine Exegese der Rechtstexte hinaus. Der Interpret darf nur das berücksichtigen, was sich aus dem Wortlaut und dem Kontext des Gesetzes ergibt. Später lockert Savigny, wie die meisten Juristen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die strenge Bindung an den Gesetzeswortlaut wieder auf. Der berühmte Abschnitt über die Gesetzesauslegung im „System des heutigen Römischen Rechts“ nennt vier Elemente der Interpretation: das grammatische, historische, logische und systematische, ergänzt diese jedoch für „mangelhafte“ Gesetze noch insbesondere um den Zweck. Die „ratio“ darf jetzt also auch wieder zur Korrektur des Gesetzeswortlauts herangezogen werden. In der Sache sind damit diejenigen Hilfsmittel der Auslegung beisammen, welche auch schon Thomasius kannte. Neu ist lediglich das an die Stelle des Kontextes tretende „systematische“ Element. Von ihm macht Savigny aber in der Interpretationslehre nur sehr vorsichtigen Gebrauch, seine eigentliche Bedeutung gewinnt es erst bei der wissenschaftlichen Rechtsfindung aus dem Ganzen des Rechts.
34
Savignys vier Elemente, „canones“, werden in der modernen Literatur zwar unablässig zitiert, jedoch in der Regel ungenau und unter Vernachlässigung des Kontextes und der größeren historischen Zusammenhänge. Um Savignys Lehre richtig einordnen zu können, muss man sich einerseits klar machen, wie sehr sie in manchen Punkten der hermeneutischen Tradition folgt, andererseits, dass sie den Zeitgenossen nur als eine - nicht immer vorzugswürdige - Variante der damals gängigen Auslegungslehren erschien. Über ihre heute weniger beachteten, aber wichtigen Grundprinzipien dürfte im mittleren 19. Jahrhundert weitgehende Einigkeit geherrscht haben, nämlich, dass der Gedanke des Gesetzes (nicht ein davon unterschiedener aktueller „objektiver“ Sinn) zu ermitteln ist, dass es unter den Hilfsmitteln keine Rangfolge gibt, sie vielmehr als Beweismittel für den „Gedanken“ frei abzuwägen sind und dass dabei der gewöhnliche Wortsinn auch über- oder unterschritten werden kann.
35
(2) Mit ihrer Lehre von der produktiven, logisch-systematischen Rechtsfindung begründet die historische Schule die positive Rechtswissenschaft. Meistens wird diese Theorie Puchta und Jhering zugeschrieben, sie findet sich aber schon beim jungen Savigny. Sie läuft darauf hinaus, dass aus den vorfindbaren Normen des Gesetzes- und Gewohnheitsrechts durch „Abstraktion“ allgemeinere Rechtsbegriffe und -prinzipien gewonnen werden, die zur Ausfüllung von Lücken und zur Korrektur einzelner misslungener Rechtssätze dienen. Logisch betrachtet handelt es sich um eine unvollständige Induktion. Deren bekannte Unsicherheit wird auf der Grundlage der Volksgeistlehre - wie auch generell in der zeitgenössischen Logik - durch die idealistische Vorstellung eines systematischen Zusammenhangs der einzelnen Rechtssätze überwunden. Auf diese Weise entdeckt die deutsche Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Rechtsbegriffen und -prinzipien, wie die Juristische Person, den dinglichen Vertrag, die Geschäftsfähigkeit, das Persönlichkeitsrecht u. a., die heute selbstverständlich geworden sind.
36
Inwieweit diese Art von Rechtsproduktion die historische Schule überhaupt charakterisiert, ist in der heutigen rechtshistorischen Literatur allerdings zweifelhaft geworden. Unstreitig dürfte inzwischen sein, dass die Juristen des frühen und mittleren 19. Jahrhunderts keineswegs nur mit „formalen“ Induktions- und Analogieschlüssen arbeiten, sondern durchaus auch „materiale“ Gerechtigkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen anstellen. Das darf jedoch nicht zu dem Fehlschluss verleiten, es hätte eine logisch-systematische Rechtswissenschaft (deren Bezeichnung als "Begriffsjurisprudenz" freilich unzulänglich und irreführend ist) niemals gegeben. Das Argumentieren mit Begriffen, Konstruktionen und Abstraktionen ist bis in das mittlere 19. Jahrhundert allgegenwärtig und durchweg akzeptiert. Verpönt wird es erst, als sich ein neuer, positivistischer Rechtsbegriff durchsetzt, der die logischen Operationen der idealistischen historischen Schule als fehlerhaft empfindet und ein „teleologisches“ Denken verlangt.
4. Kaiserreich und Weimarer Republik (1870 bis 1933)
37
a) Rechtsbegriff und Rechtsquellenlehre
38
Dieser rein positivistische Begriff bildet sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aus. Recht ist nun nur noch die Willensäußerung eines Gesetzgebers oder auch einer nichtorganisierten Rechtsgemeinschaft. Damit wird der voluntaristische Rechtsbegriff des 17. /18. Jahrhunderts wieder aufgegriffen, allerdings entfällt der frühere Dualismus von positivem Recht und Naturrecht. Entsprechend umgeformt werden die Begriffe von Gesetz und Gewohnheitsrecht.
39
Zu ihnen tritt als dritte Rechtsquelle das „Richterrecht“. Da das Recht jetzt als willkürliches, zufälliges Produkt des Gesetzgebers erschien, war seine systematische Einheit nicht mehr gewährleistet. Lücken konnten also nicht mehr aus der inneren Vernunft des positiven Rechts (und schon seit langem nicht mehr aus dem Naturrecht) geschlossen werden, sondern nur noch durch den Rechtsanwender selbst. Neues Recht setzt nunmehr also auch der Richter, wenn auch immer nur im einzelnen Fall und ohne präjudizielle Bindung für andere.
40
Im Einzelnen kann man drei Varianten des neuen Rechtsbegriffs unterscheiden. Eine idealistische, nach der das positive Recht Vernünftigkeit und „Richtigkeit“ doch wenigstens anstrebt, eine geschichtlich-soziologische, die das Recht aus seinen faktischen Entstehungsursachen erklären will (so u. a. die Interessenjurisprudenz), und eine normative, nach der es nur auf die Norm selbst ankommt (Reine Rechtslehre). Zwischen den ersten beiden Spielarten gibt es natürlich auch Mischformen und Vermittlungsversuche.
41
b) Methodenlehre im engeren Sinne
42
(1) Entsprechend den Varianten des Rechtsbegriffs entstehen in der Theorie der Gesetzesinterpretation drei verschiedene Richtungen, eine idealistische („objektive“ Auslegungstheorie), eine historische („subjektive“ Auslegungstheorie) und eine normative. Die Unterschiede machen sich bei der Wertschätzung der historischen Interpretationshilfsmittel, vor allem aber beim Verständnis der „ratio legis“, des Zweckes bemerkbar. Während für die subjektive Theorie der historische Zweck eines Gesetzes maßgeblich ist, kommt es der objektiven auf den aktuell vernünftigen an, womit dem Wandel gesellschaftlicher Wertvorstellungen Rechnung getragen werden soll.
43
Eine „Auslegung“, oder eher Rechtsfindung, praeter legem wird erforderlich bei Lücken des Gesetzes. Allerdings ist, entsprechend den unterschiedlichen Rechtsbegriffen, schon umstritten, wann überhaupt eine Lücke vorliegt. Ob etwas im Gesetz fehlt und was, soll entweder am Plan des historischen Gesetzgebers gemessen werden (subjektive Theorie) oder am aktuellen Bedürfnis (objektive Theorie). Die strikt positivistische Reine Rechtslehre bestreitet überhaupt die Existenz von Lücken. Uneinigkeit besteht auch darüber, wie die Lücken geschlossen werden: ob allein nach dem Ermessen des Rechtsanwenders oder mit methodischen Hilfsmitteln wie der Analogie. Von den „äußeren“ Lücken, die sich aus der Unvollständigkeit des Gesetzes ergeben, kann man die „inneren“ Lücken unterscheiden, die aus der Undeutlichkeit der Sprache resultieren. Vor allem auf dieses Problem hat die Freirechtsbewegung (Freirecht) hingewiesen. Können solche Unklarheiten nicht durch Kontext, Geschichte oder Zweck des Gesetzes aufgeklärt werden, dann wird wiederum eine richterliche Rechtsschöpfung erforderlich.
44
(2) In der Theorie der Rechtswissenschaft setzen sich die Juristen des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, wiederum entsprechend dem neuen voluntaristisch-positivistischen Rechtsbegriff, deutlich von der historischen Schule ab. Logisch-systematische Rechtsfindung durch Konstruktion und Prinzipienbildung aus dem vorhandenen Rechtsmaterial verwerfen sie als „Begriffsjurisprudenz“. Überhaupt wird der Anspruch einer produktiven Rechtswissenschaft aufgegeben; an die Stelle der wissenschaftlichen Rechtsfindung tritt die bloße Rechtsbearbeitung. Dafür maßgebend soll, da jedem Willen ein Zweck zugrunde liegt, überall der Zweck sein. Begriffe sind teleologisch zu bilden, das Rechtssystem ist nicht mehr aus überzeitlichen Wesens-, "Substanz"-Begriffen, sondern entsprechend den jeweils wechselnden Zwecken aufzubauen. Beispiele für die teleologische Systematisierung eines größeren Rechtsgebiets hat die Rechtswissenschaft des frühen 20. Jahrhunderts allerdings nicht geliefert.
5. Nationalsozialismus (1933-1945)
45
a) Rechtsbegriff und Rechtsquellenlehre
46
Die nationalsozialistischen Juristen gehen zu einem "völkischen" Rechtsbegriff über. Danach ist "Urquelle" des Rechts das Volksbewusstsein, welches sich inhaltlich mit den Wertvorstellungen des Nationalsozialismus decken soll. Dieser neue werthaltige Rechtsbegriff steht allerdings im Widerspruch zu den Einzelheiten der Rechtsquellenlehre. Unumstritten ist nämlich, dass das Gesetz als "Führerbefehl" gegenüber dem Volksbewusstsein auch neutral sein, ihm sogar widersprechen kann und dass es abweichendem Gewohnheits- und "Volks-Recht" vorgeht. Nur bei altem oder überhaupt fehlendem geschriebenem Recht kommt das "völkische" Recht zum Zuge. Letztlich setzt sich also, soweit vorhanden, immer das Führer-Recht durch. Es gibt auch keine richterliche Normenkontrolle wie im bürgerlichen Verfassungsstaat, und überhaupt lehnen die NS-Juristen ein Richterrecht, jedenfalls eigene Wertungen des Richters, ab.
47
b) Methodenlehre im engeren Sinne
48
Der Widerspruch zwischen völkischem und autoritärem Rechtsbegriff setzt sich in der Theorie der Gesetzesinterpretation fort. Nach der einen, "völkischen" Meinung sollen Gesetze entsprechend den nationalsozialistischen Vorstellungen ausgelegt werden. Nach der anderen soll es auf den Willen und Zweck des Gesetzgebers, d. h. des "Führers" ankommen. Größeren Zuspruch fand die erste Ansicht, da sie die alten, vor 1933 erlassenen Gesetze leichter im Sinne des "völkischen" Denkens umdeuten konnte. Aber auch neue, nationalsozialistische Gesetze wurden durch "völkische" Interpretation, nämlich unter Rückgriff auf die Rassen- und die Gemeinschaftsideologie im vermuteten Einverständnis mit der Führung "verbessert". Ebenso schließt man Gesetzeslücken durch Anwendung völkisch-nationalsozialistischer Rechtsprinzipien.
49
Die Theorie der Rechtswissenschaft ist zersplittert. Zum Teil hält sich das ältere legalistische und teleologische Denken, zum Teil entwickelt sich eine "völkische" Rechtswissenschaft. Diese knüpft vor allem an Carl Schmitts Lehre vom "konkreten Ordnungsdenken" an und läuft auf ein Fallrecht hinaus, so dass das Interesse an der Systematisierung des Rechts schwindet. Bei der Begriffsbildung dringt im Zivilrecht das "typologische" Verfahren vor; im Strafrecht propagieren verschiedene Autoren eine "Wesensschau", die sich nicht mehr an positivrechtlichen Vorgaben orientiert. Die irrationalistischen Züge dieser Lehren sind offenkundig und werden von ihren Anhängern auch nicht geleugnet.
III. Bibliographie
1. Quellen
Heck, Philipp, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Tübingen 1914
Puchta, Georg Friedrich, Cursus der Institutionen, I (1841), 9. Aufl., besorgt von Paul Krüger, Leipzig 1881
Pufendorf, Samuel, De jure naturae et gentium libri octo (1672), in ders., Gesammelte Werke, IV, hrsg. von Frank Böhling, Berlin 1998
––, De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo (1673), in ders., Gesammelte Werke, IV, hrsg. von Gerald Hartung, Berlin 1997
Savigny, Friedrich Carl von, Über den Zweck dieser Zeitschrift, in: Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 1 (Berlin 1815), S. 1-17.
––, System des heutigen Römischen Rechts, I, Berlin 1840, S. 206-330
––, Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842, hrsg. v. A. Mazzacane, Frankfurt am Main1993
Thomas von Aquin, Summa Theologiae, Ia IIae
Thomasius, Christian, Ausübung der Vernunft-Lehre, Halle 1691 (Nachdruck Hildesheim 1968), S. 149-230
Zasius, Ulrich, Opera omnia, hrsg. von Johann Ulrich Zasius und Joachim Münsinger von Frundeck, I, Lyon 1550 (Nachdruck Aalen 1966)
 
2. Literatur
Fikentscher, Wolfgang, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, I, Tübingen 1976
Herberger, Maximilian, Dogmatik. Zur Geschichte von Begriff und Methode in Medizin und Jurisprudenz, Frankfurt am Main 1981
Lange, Hermann / Kriechbaum, Maximiliane, Römisches Recht im Mittelalter, I, München 1997, S. 111-117, II, München 2007, 264-354
Otte, Gerhard, Dialektik und Jurisprudenz. Untersuchungen zur Methode der Glossatoren, Frankfurt am Main 1971
Raisch, Peter, Juristische Methoden. Vom antiken Rom bis zur Gegenwart, Heidelberg 1995
Rüthers, Bernd, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus (1968), 7. Aufl., Tübingen 2012
Schröder, Jan, Rechtswissenschaft in der Neuzeit. Geschichte, Theorie, Methode. Ausgewählte Aufsätze 1976-2009, hrsg. von Thomas Finkenauer, Claes Peterson, Michael Stolleis, Tübingen 2010
––, (2012 a) Recht als Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methodenlehre in der Neuzeit (1500-1933), 2. Auflage, München 2012
–-, (2012 b) Juristische Methode, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hrsg. von Albrecht Cordes u. a., 2. Auflage, II, Berlin 2012, S. 1449-1456
– , Zur Rechtsquellenlehre des Nationalsozialismus im Kontext der neuzeitlichen Entwicklung, in: Recht im Wandel - Wandel des Rechts. Festschrift für Jürgen Weitzel zum 70. Geburtstag, hrsg. von Ignacio Czeguhn, Köln etc. 2014, S. 597-615
Viehweg, Theodor, Topik und Jurisprudenz (1954), 5. Aufl., München 1974
Vogenauer, Stefan, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent, Tübingen 2001
Wieacker, Franz, Römische Rechtsgeschichte, 1. Abschnitt, München 1988, S. 572-675, 2. Abschnitt, München 2006, S. 44-52, 90 f.
IV. Verwandte Themen
Analogie | Begriff des Rechts | Begriffsjurisprudenz | Freirecht | Gesetz | Gewohnheitsrecht | Heck, Philipp | historische Rechtsschule | Interessenjurisprudenz | Interpretation | Jhering, Rudolph von | Juristenrecht | Lücken im Recht | Methodenlehre (Grundlagen) | Nationalsozialismus (Rechtstheorie) | Naturrecht | Puchta, Georg Friedrich | Pufendorf, Samuel | Ratio legis | Recht, positives | Rechtsdogmatik | Rechtsquellen | Rechtswissenschaft | Richterrecht | Savigny, Friedrich Carl von | System | Thomasius, Christian | Topik | Zweck des Rechts